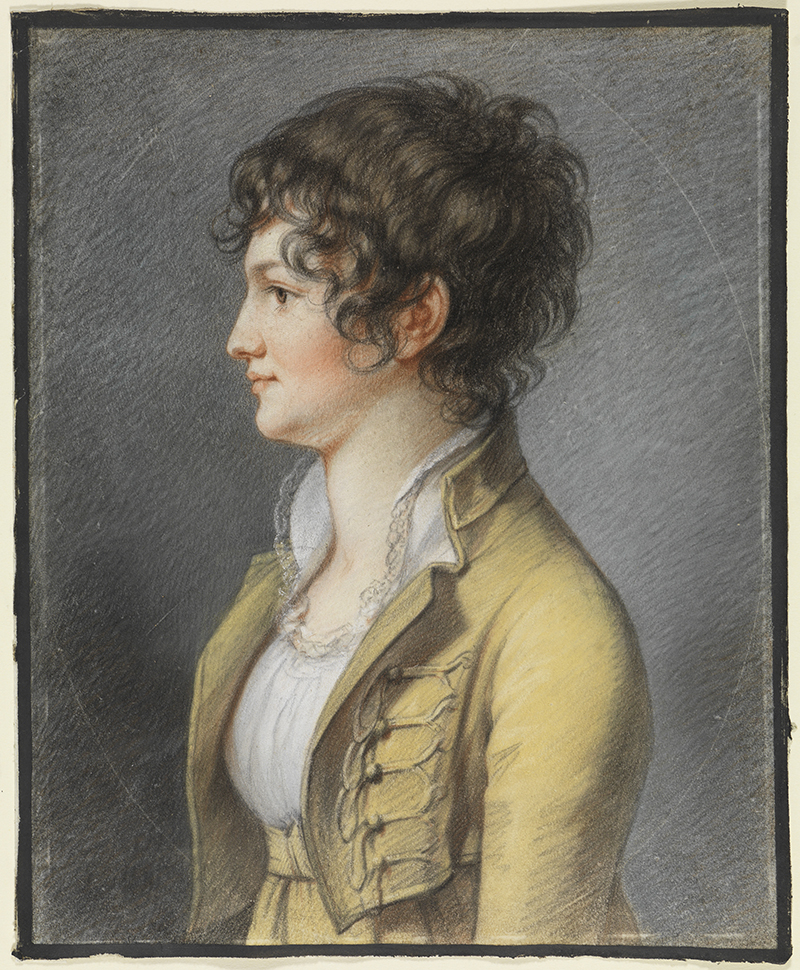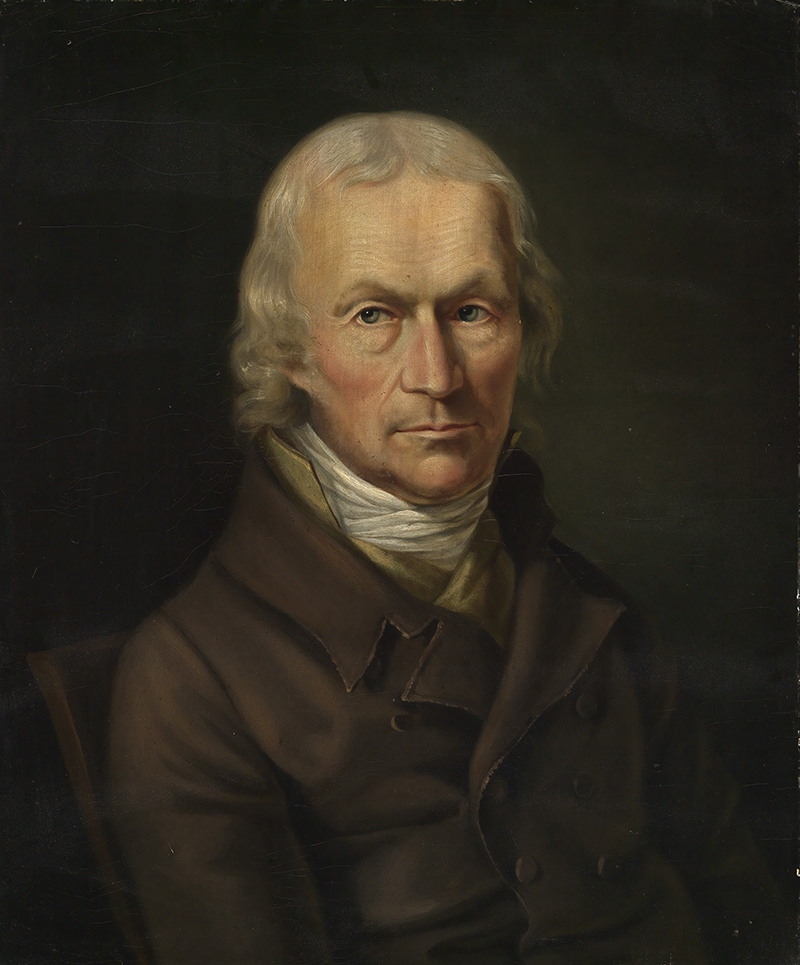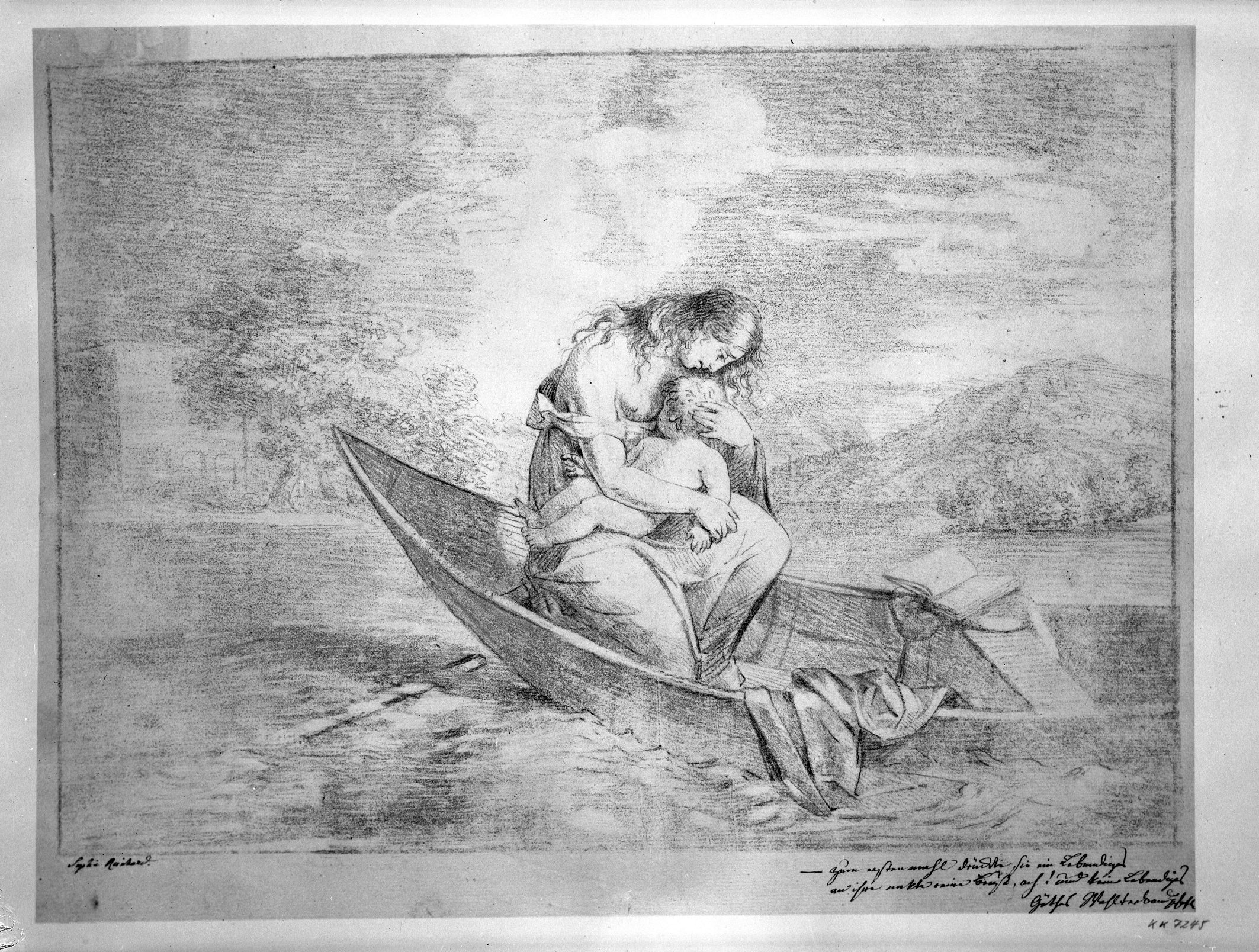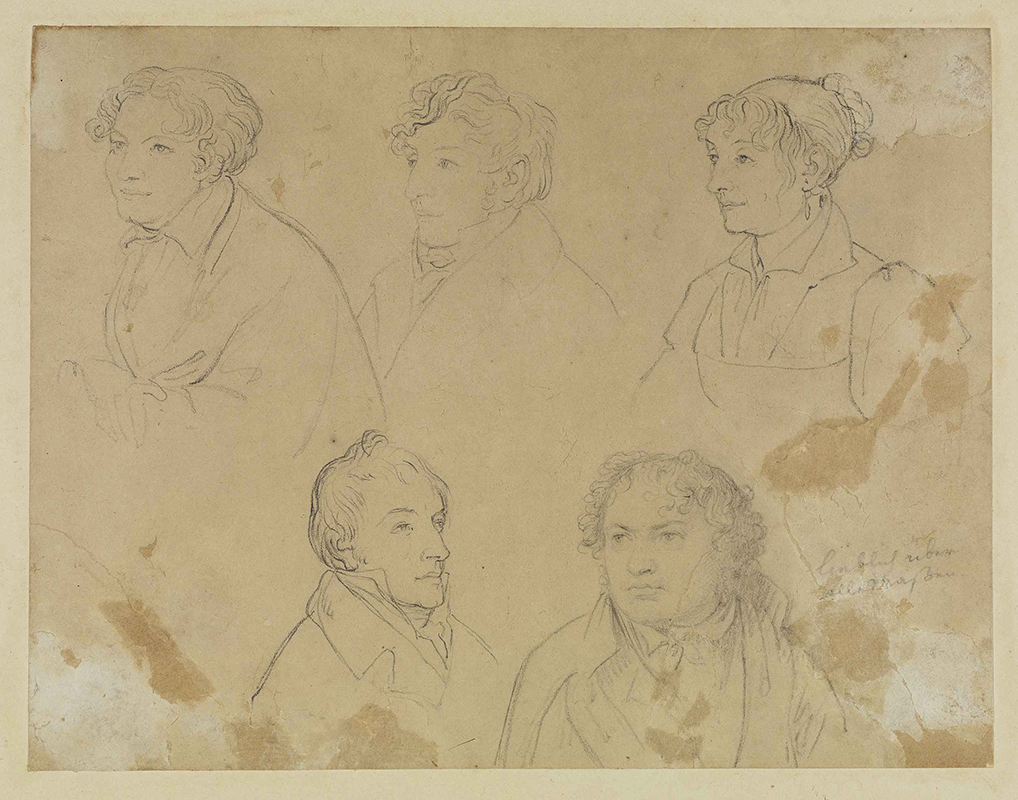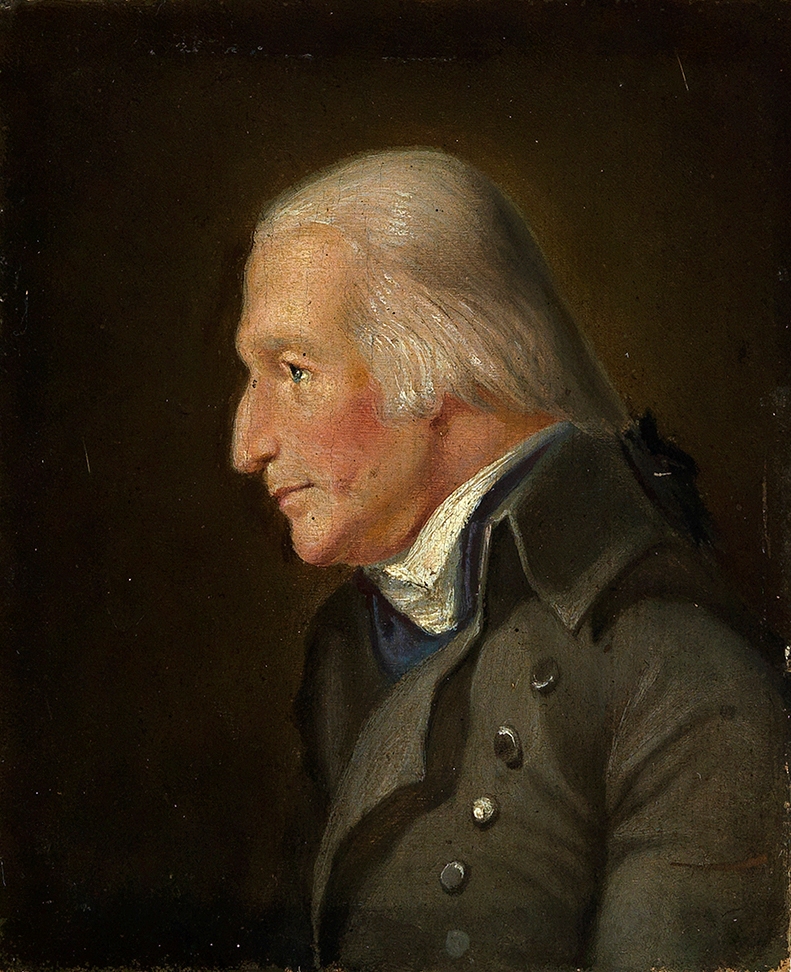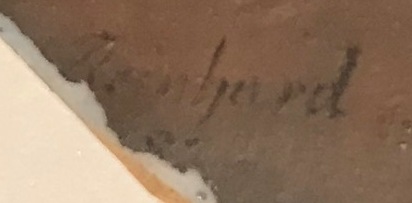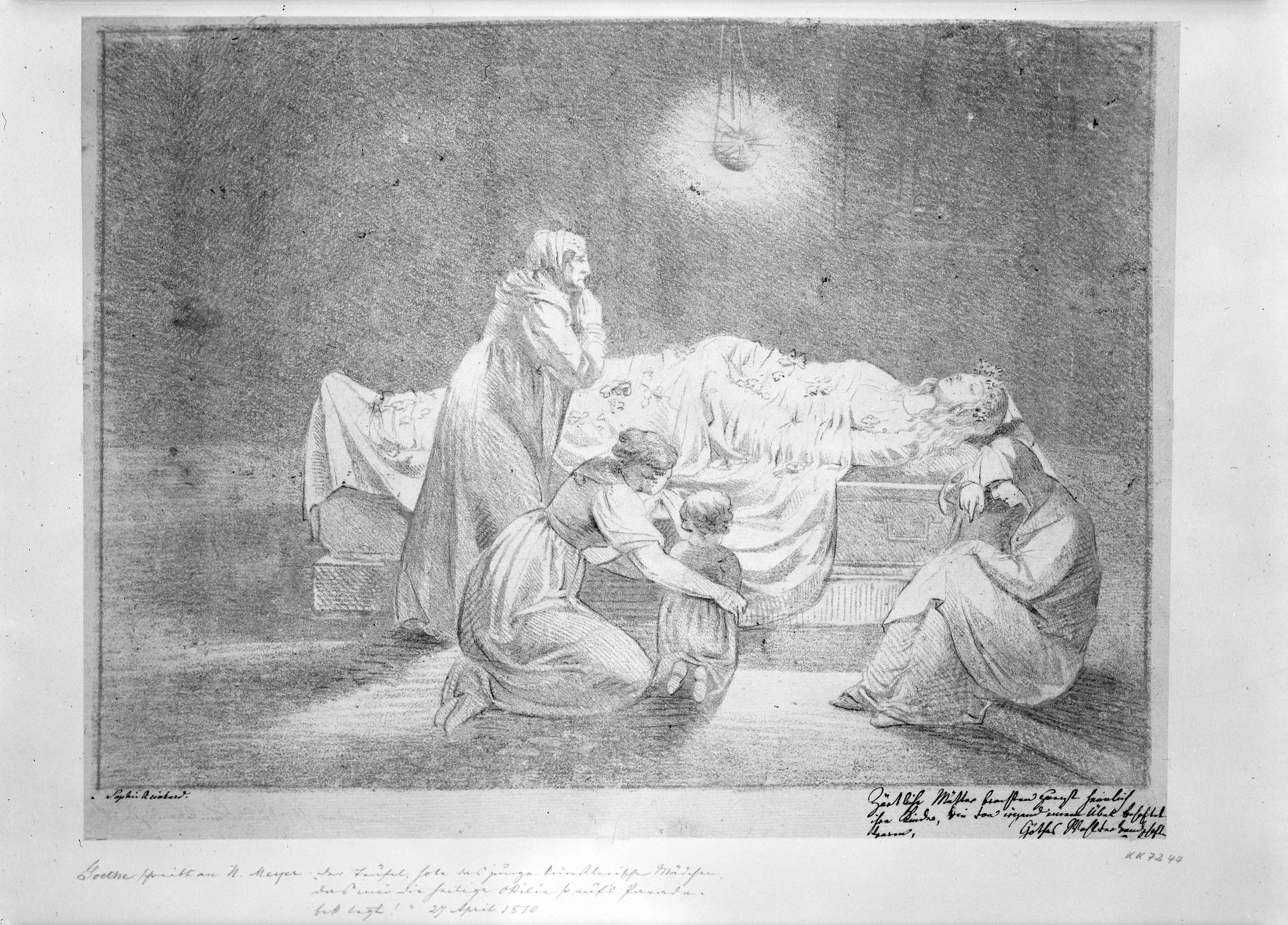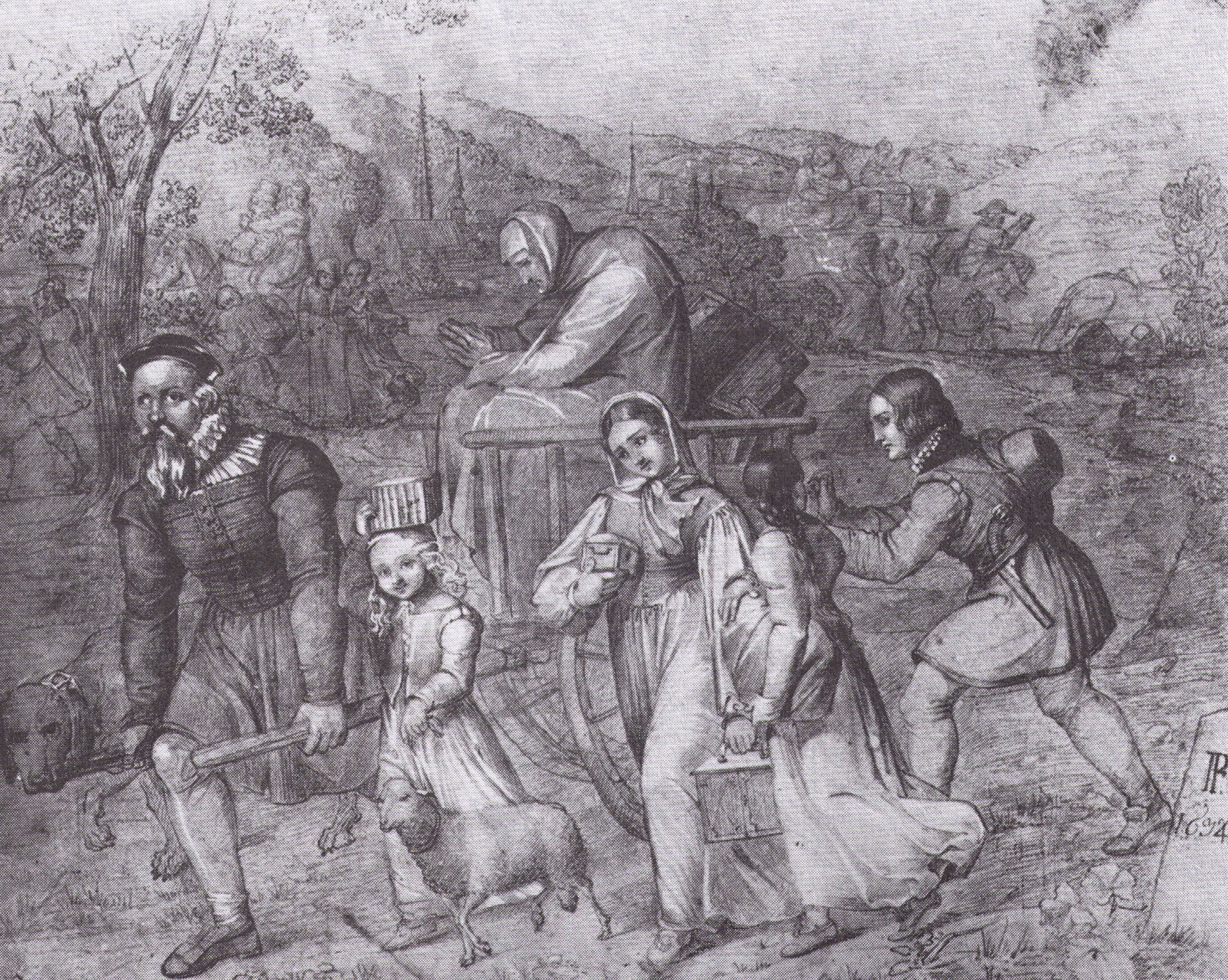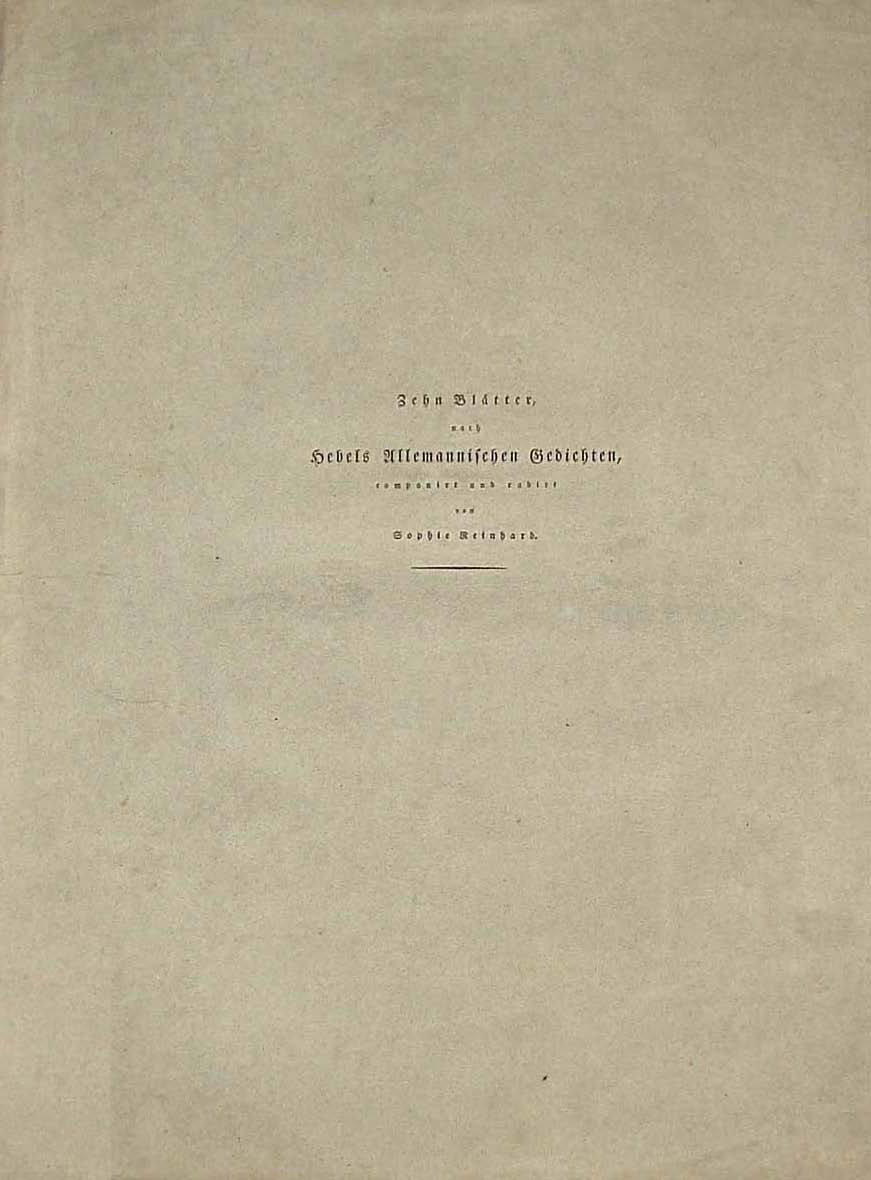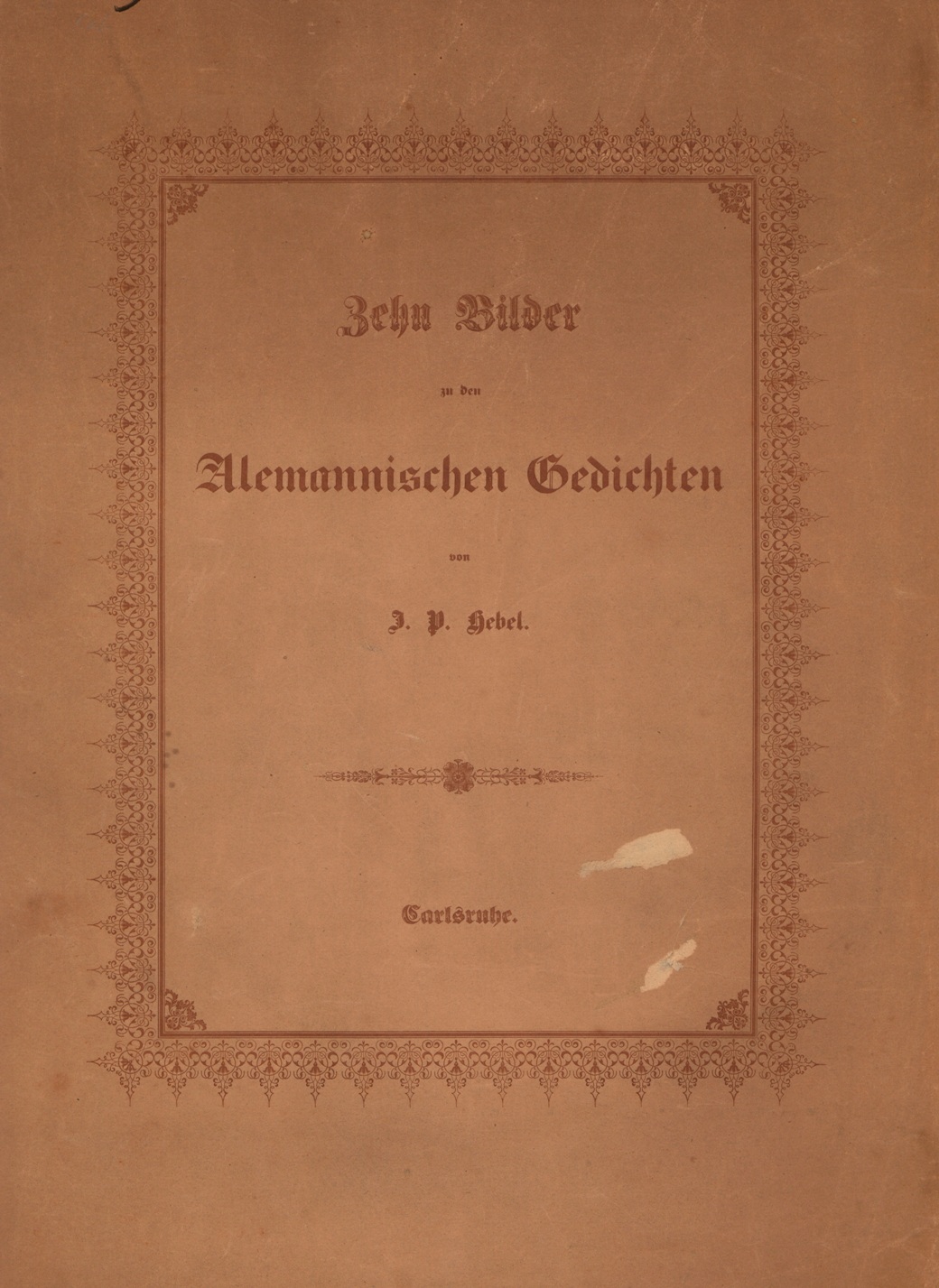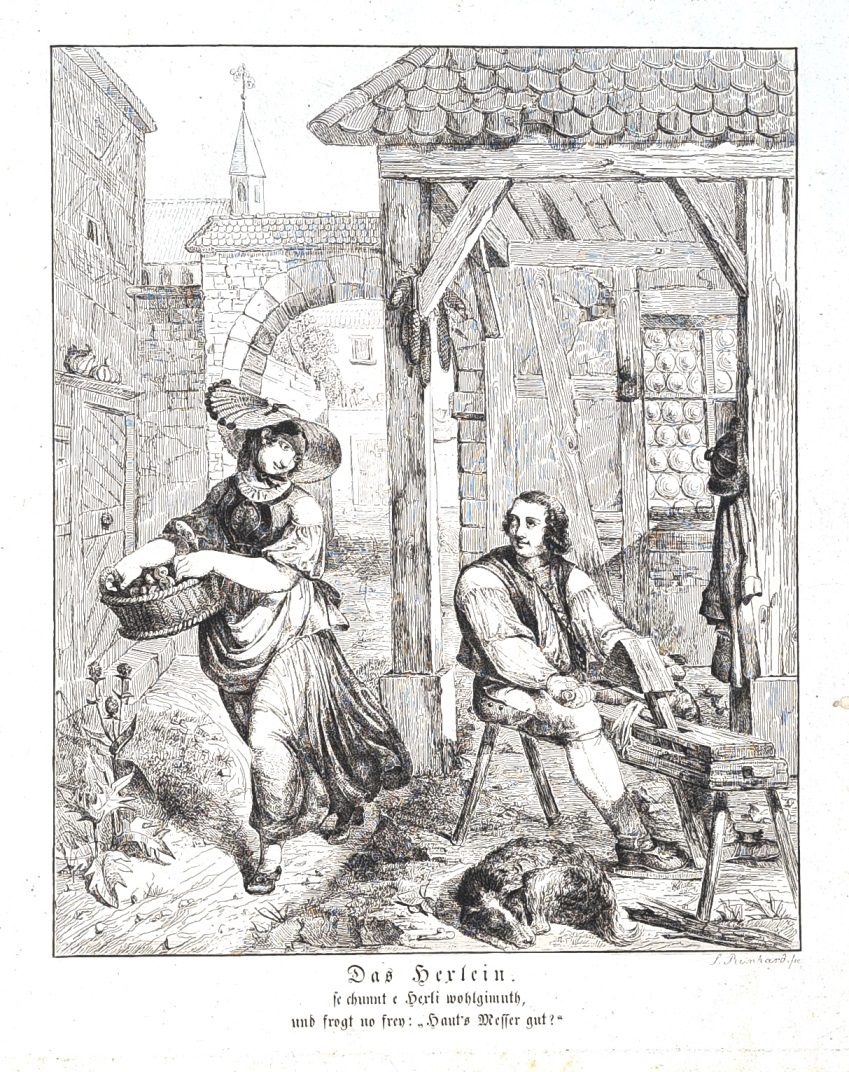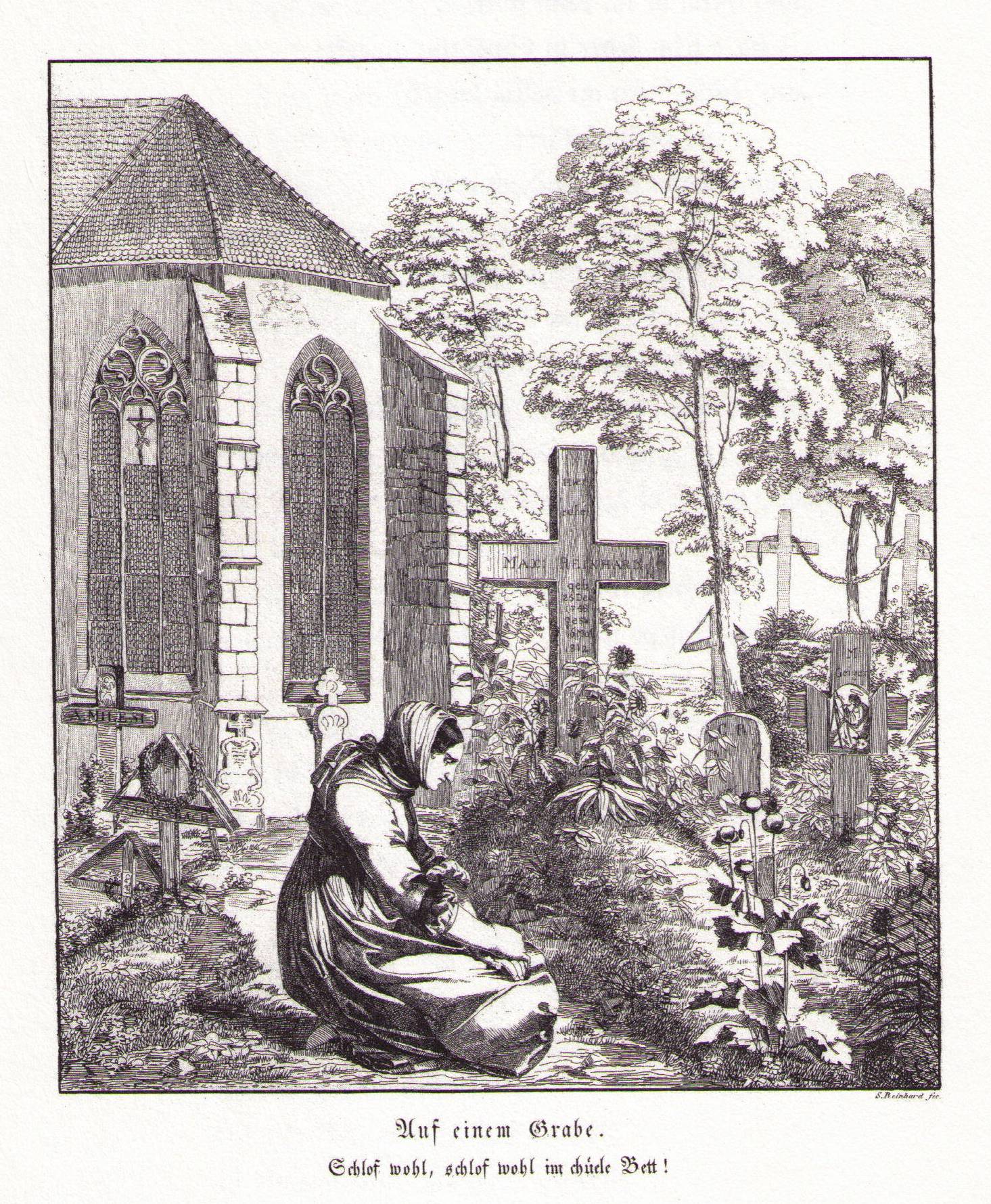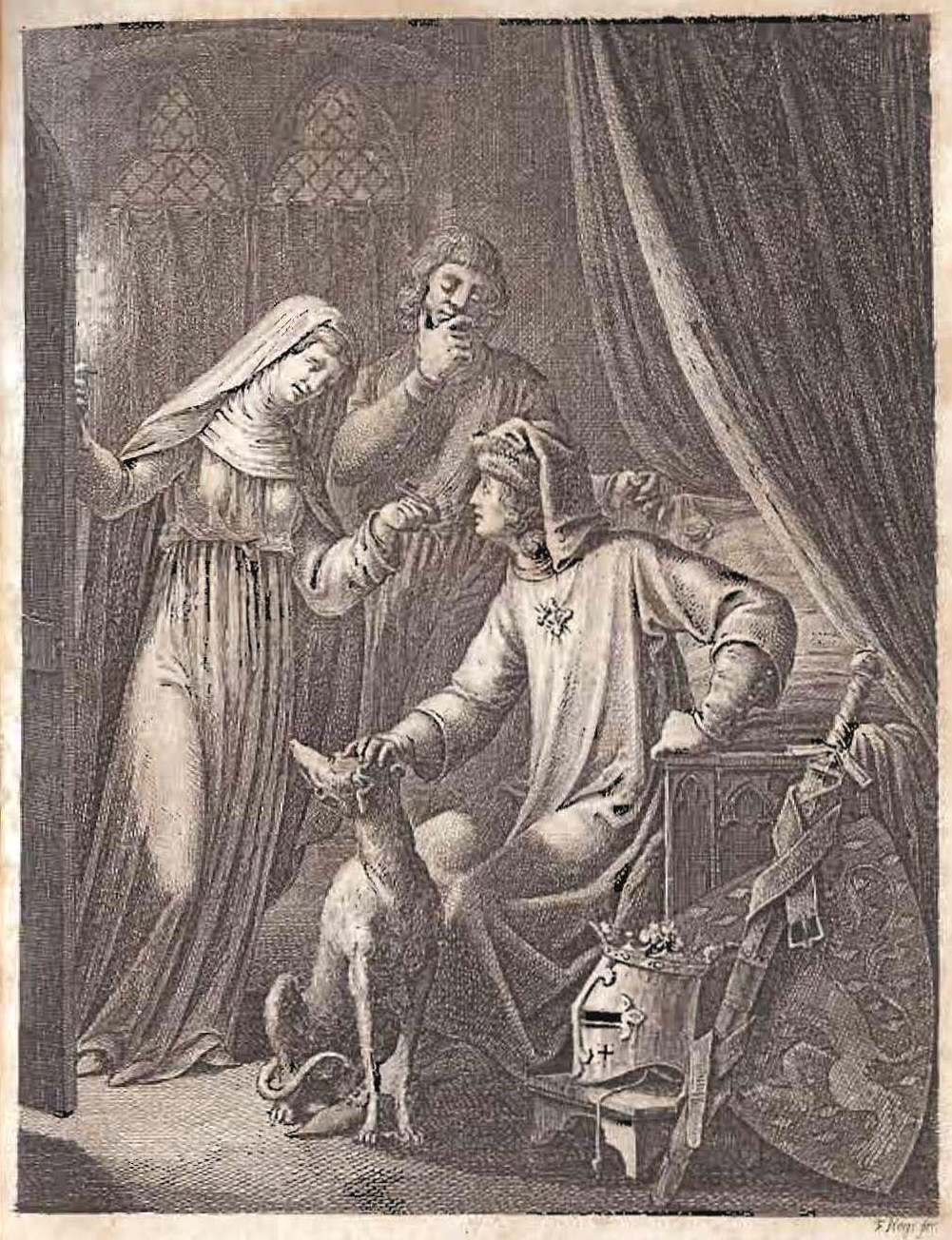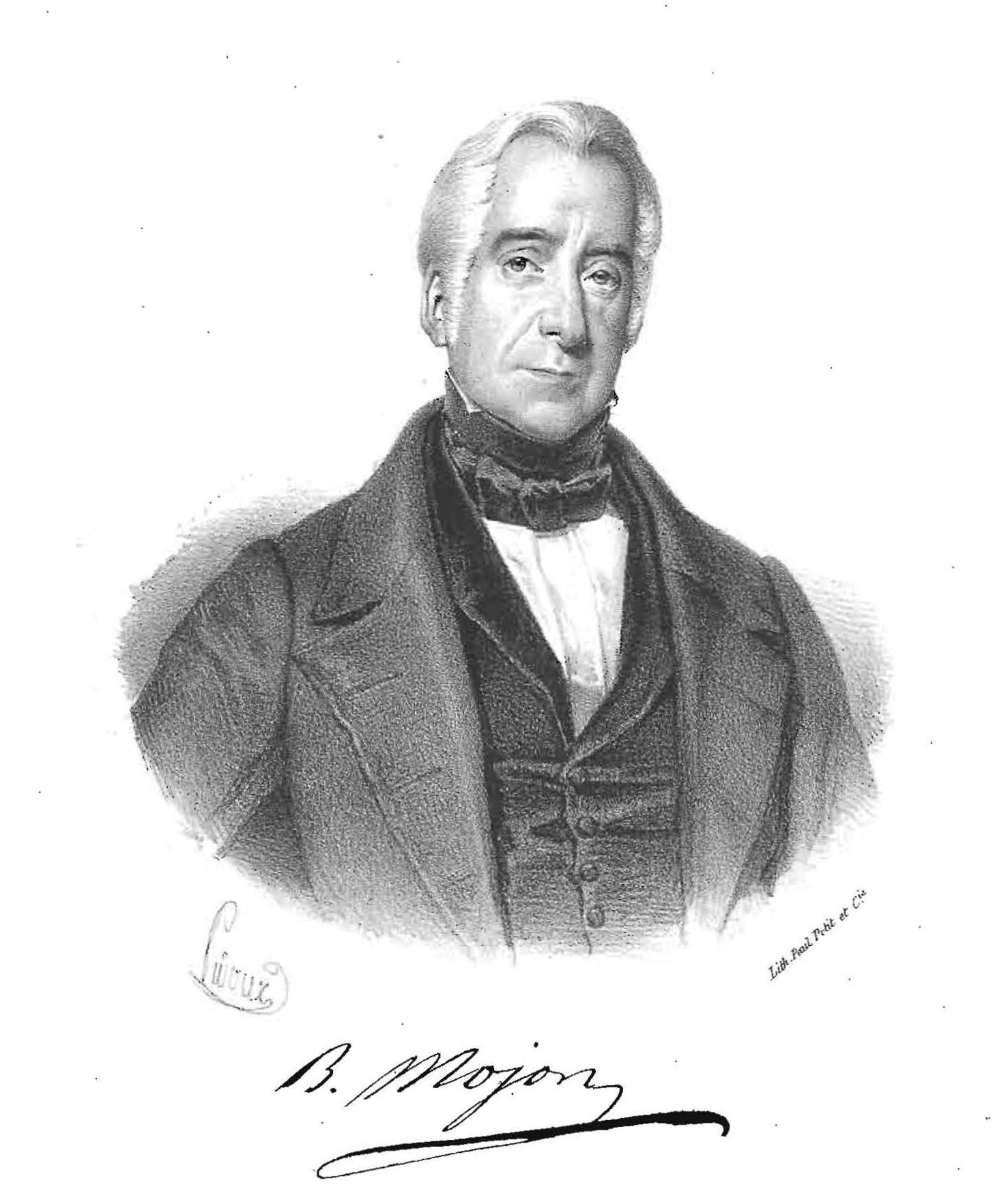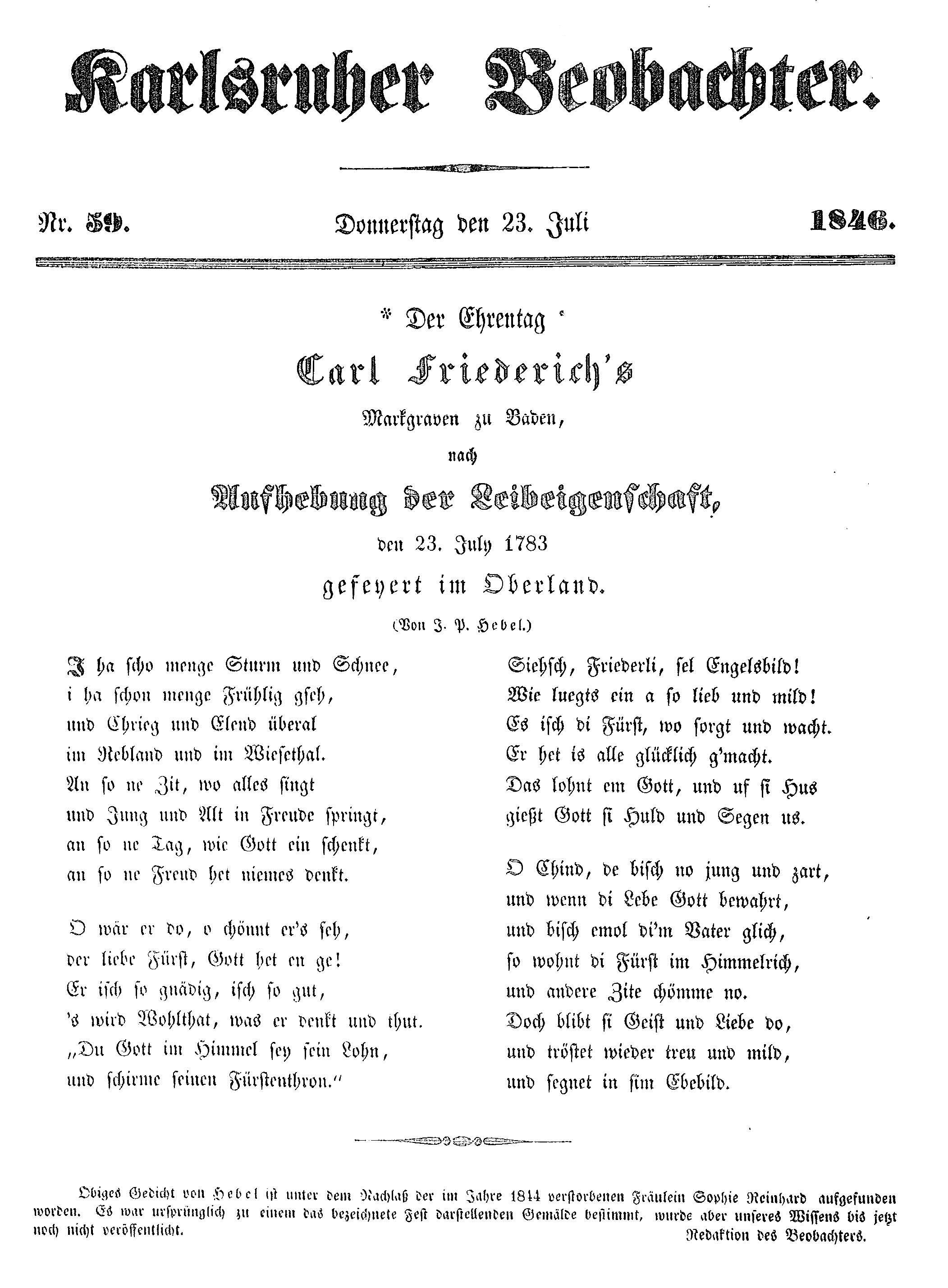Einleitung
Das Leben und Werk der Großherzoglich Badischen Hofmalerin Sophie Reinhard wurde
bisher niemals eingehend beschrieben und kein Versuch unternommen, ein
Verzeichnis ihrer Werke zusammenzutragen. Dieser Mangel geht auf die
Kunstgeschichtsschreibung der vergangenen Jahrhunderte zurück, in der man(n) die
Kunst von Frauen überwiegend als unbedeutend erachtete. Erst als Germaine Greer
1979 auf die gewichtige Rolle der Frauen in der bildenden Kunst hinwies, nachdem
in Los Angeles eine Ausstellung über Künstlerinnen von 1550 bis 1950 ein
weltweites Echo gefunden hatte, entwickelte sich in der Kunstgeschichte ein
Umdenken, das zum Aufarbeiten der Lücken in der Beschreibung des Lebens und
Werkes zahlreicher Künstlerinnen beitrug.
In den darauf folgenden Jahren wurde
verschiedentlich kurz über die Künstlerin Sophie Reinhard berichtet. Eine
Dokumentation des Stadtarchivs Karlsruhe aus dem Jahre 1992 über „Karlsruher
Frauen 1715-1945“ informierte zwar über Sophie Reinhard ohne aber das Leben und
Werk dieser bedeutenden Karlsruherin eingehender zu behandeln und manchen
verbreiteten Irrtum in den kunsthistorischen Nachschlagewerken über ihre
biographischen Daten auszuräumen, was mit Hilfe der Karlsruher Archive leicht
möglich gewesen wäre.
An diesem Zustand veränderte auch die Ausstellung des Jahres 1995 „Frauen im
Aufbruch? Künstlerinnen im deutschen Südwesten“ nicht viel.
Wirklich eingehend befasste sich mit der Künstlerin erst die Kunstausstellung in
Gotha und Konstanz im Jahre 1999 mit dem Titel „Zwischen Ideal und Wirklichkeit.
Künstlerinnen der Goethe-Zeit zwischen 1750 und 1850“.
Ins Gedächtnis der Karlsruher wurde die Künstlerin jüngst durch einen
historischen Kriminalroman von Petra Reategui zurückgerufen, der in der Zeit
Weinbrenners im frühen neunzehnten Jahrhundert in Karlsruhe spielt.
Insbesondere mit der Reise der
Künstlerin nach Italien hat sich 2009 Kathrin Seibert intensiv beschäftigt und
die Reisevorbereitungen sowie den Aufenthalt in Rom näher beschrieben. Ferner
hat sie das künstlerische Werk der Sophie Reinhard, soweit es die Quellen
erlauben, mit den Werken anderer Künstlerinnen jener Zeit verglichen und die
Wirkung des Studiums in Italien auf das spätere Schaffen der Künstlerin
aufgezeigt.
Die nachfolgende Schilderung des
Lebens der Künstlerin kann nur einen ersten Überblick geben und soll Anregung
zur weiteren Beschäftigung mit ihrem Werk sein. Um dies zu erleichtern, werden
die handschriftlichen Quellen, soweit sie mir zugänglich waren, beigefügt.
Ferner soll dadurch dem Leser die Möglichkeit gegeben werden, die
handschriftlichen Quellen selbst zu bewerten und zu interpretieren. Außerdem
enthalten diese Quellen viele neue Hinweise auf bildende Künstler, die anfangs
des 19. Jahrhunderts in Rom tätig waren. Sie verdienen es weiter ausgeschöpft zu
werden.
Der angefügte Werkkatalog kann
selbstverständlich ebenfalls nur als ein erster zaghafter Versuch einer
Auflistung der Werke von Sophie Reinhard gesehen werden, der sicherlich noch
vieler Ergänzungen bedarf. Er soll aber den Leser ermuntern zur
Vervollständigung der Werkübersicht selbst beizutragen und Lücken zu füllen.
Herkunft, Ausbildung und
Wanderjahre
Sophie Karoline Friederike Petronella
Reinhard wurde am 9. Juni 1775 in Kirchberg in der linksrheinischen, ehemals
badischen, Grafschaft Sponheim geboren.
Die Grafschaft wurde nach ihrer Besetzung durch französische Truppen 1794 im
Jahre 1801 für über ein Jahrzehnt Teil Frankreichs. Ihr Vater Maximilian Wilhelm
Reinhard, geboren 1748 in Karlsruhe, war zunächst von 1772 bis 1783 fürstlich
badischer Hofrat und Amtmann in Kirchberg und Birkenfeld in der Hinteren
Grafschaft Sponheim,
danach von 1783 bis 1792 Landschreiber und Hofrat in Lörrach im Oberamt Rötteln
im Markgräfler Land
und zuletzt Staatsrat und Direktor der badischen Brandversicherungsanstalt in
Karlsruhe.
Als junges Mädchen lebte Sophie
Reinhard von 1783 bis 1792 in Lörrach. Ihre beiden jüngeren Brüder, Wilhelm
Emanuel, geb. 1776 in Kirchberg und Carl Friedrich, geb. 1780 in Birkenfeld,
besuchten in Lörrach das dortige Pädagogium, wo Tobias Günttert seit 1779 als
Prorektor und Johann Peter Hebel seit 1783 als Hilfslehrer tätig waren.
Das wichtigste Unterrichtsfach war Latein, was Hebel unterrichtete, außerdem
wurden evangelische Religionslehre, Geschichte und Geographie, aber auch
französischer Sprachunterricht von einem Lehrer namens Colthien, Musik von dem
Stadtzinkenist Gebhard und Zeichenunterricht von dem Maler Eberhard Frick
erteilt.
Dagegen ist davon auszugehen, dass Sophie Reinhard selbst und ihre beiden
jüngeren Schwestern Elisabetha Henrietta, geb. 1778 in Birkenfeld, und Carolina
Sophia, geb. 1784 in Lörrach, von einem Hauslehrer unterrichtet wurden. Ob
Sophie Reinhard damals schon Zeichenunterricht bekam, lässt sich nicht
nachweisen. Johann Peter Hebel schreibt in seinem Vorwort zu ihren Radierungen
„Zehn Blätter nach Hebels Alemannischen Gedichten“, die 1820 bei Mohr und Winter
in Heidelberg verlegt wurden: „Schon oft haben Personen, welche die
alemannischen Gedichte mit ihrem Beifall ehren, den Wunsch geäußert, daß Kupfer
dazu in getreuer Nachbildung der nationalen Tracht und Eigenthümlichkeit des
Völkleins, das in ihnen lebt, gegeben werden möchten. Ein Versuch, der in der
dritten Auflage der Gedichte gemacht wurde, ist nur wenig gelungen. Sophie
Reinhard, die selbst einige Jahre in jener Gegend gelebt hat, und für sie eine
treue Erinnerung und Liebe bewahrt, hat diese Aufgabe vollkommen erreicht.“
Die Familie von Maximilian Reinhard, insbesondere seine Frau, kam während der
Amtszeit Reinhards in Lörrach mit Hebel und der Pfarrerfamilie Günttert in
freundschaftlichen Kontakt, der auch in der nachfolgenden Karlsruher Zeit
andauerte.
Sophie Reinhard dürfte ihre
künstlerische Ausbildung um 1793 im Alter von 18 Jahren an der Zeichenschule von
Philipp Jakob Becker begonnen haben, als ihr Vater von Lörrach nach Karlsruhe
versetzt wurde. Schließen lässt sich dies aus den Tagebuchaufzeichnungen des
Karlsruher Kaufmanns Wilhelm Christian Griesbach, der am Sonntag den 13. August
1797 von einer Begegnung mit ihr in Steinbach berichtet,
wohin er mit Gustel Lindemann, Sophie Brauer, seiner Tante und seinem Onkel
Hemeling einen Ausflug unternommen hatte: „es waren sehr viele Damen da, unter
andern auch, die Sophie Reinhardt, die ich wegen ihrem génie immer bewundere,
obgleich so manches an ihr tadelhaft seyn soll.“
Sie muss also 1797 in Karlsruhe schon eine beachtete Künstlerin gewesen sein.
Ihr Vater lässt den Großherzog Karl Ludwig von Baden in einem Brief wissen, dass seine
Tochter beim Galeriedirektor Philipp Jakob Becker mehrjährigen Unterricht
erhalten habe.
Dort gehörten die Zeichnung, das Aquarell und das Pastell, aber auch die
Miniaturmalerei zum Ausbildungsprogramm. Becker tat sich jedoch weniger als
Künstler, denn als Leiter der neugegründeten Kunstsammlung und als Lehrer an der
im Herbst 1786 eröffneten Zeichenschule hervor, konnte demnach Sophie Reinhard
zwar ein solides künstlerisches Rüstzeug bieten, zu höherer Ausbildung reichten
seine Fähigkeiten aber nicht.
Aus der Studienzeit bei Galeriedirektor Becker sind zwei Zeichnungen von Sophie
Reinhard erhalten, die sie nach seinen Vorlagen fertigte und die für die
Ausbildung bei ihm Programm sind.
Von ihm stammt ein Portrait in Pastell von Sophie Reinhard aus dem Jahre 1803,
welches auf ein damals freundschaftliches Verhältnis zwischen Lehrer und
Schülerin schließen lässt.
Die früheste bekannte Arbeit von Sophie Reinhard datiert auf das Jahr 1799. Es
handelt sich um eine Miniatur, das Portrait einer älteren Dame darstellend.
Aus dieser Zeit dürfte auch die Miniatur „Mädchen mit Buch“ stammen, die sich im
künstlerischen Nachlass Beckers befand.
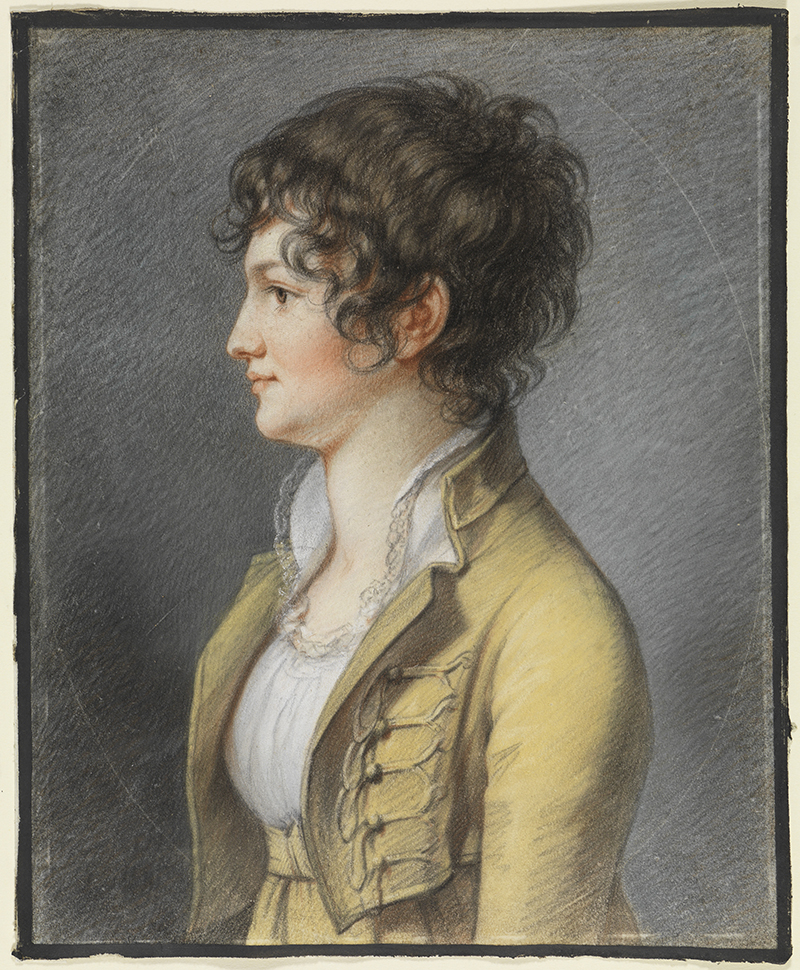
Frühestes bekanntes Portrait von Sophie Reinhard im
Alter von 28 Jahren.
Pastell auf Pergament von Philipp Jakob Becker aus
dem Jahre 1803.
© Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, Inv.-Nr. 1977-4
Um eine bessere Ausbildung zu
erhalten, schickte der Vater seine Tochter 1807 nach München. Da ihr dort als
Frau eine Immatrikulation an der neu konstituierten Kunstakademie verwehrt und
deren Eröffnung ohnehin erst 1808 zu erwarten war, nahm sie bei Galeriedirektor
Christian von Mannlich Privatunterricht. Während ihres Studienaufenthaltes in
München freundete sich Sophie Reinhard mit der Malerin Margarete Geiger an, die
ebenfalls bei Mannlich studierte. Aus dieser Zeit sind zwei Zeichnungen „Sophie
Reinhard beim Kopieren“ und „Margarete Geiger beim Malen in Schleißheim“
erhalten, welche die Künstlerinnen im Jahre 1807 voneinander gefertigt haben.
Margarete Geiger war schon 1806 in München angekommen, und wie ihren Briefen zu
entnehmen ist, war sie in kurzer Zeit mit den meisten Münchner Künstlern,
darunter auch mit dem designierten Direktor der Kunstakademie Johann Peter von
Langer und seinem Sohn Robert, bekannt geworden.
In einem Brief vom 31. Juli 1807
schreibt sie an ihre Schwester: „Vermutlich werde ich künftige Woche in
Schleißheim zubringen, worauf ich mich sehr freue! Wenn ich retourkomme, will
ich den Brief des lieben Vaters beantworten und die Merkwürdigkeiten jener
Galerie beschreiben. Es ist um so interessanter, da Herr v. Mannlich und ein
Fräulein Reinhard aus Carlsruhe die kleine Reise mitmachen. Ihr Vater ist
Geheimrat, sie hat so viel Liebe zur Kunst, daß sie sich ihr ganz widmet. Sie
hat viel Talent, zeichnet mit schwarzer und weißer Kreide charmante Gruppen,
just wie die Deinigen. … Wir harmonisieren sehr gut zusammen, copieren in der
Galerie, durchstreifen miteinander die Kirchen und zeichnen alles ab, was in
unseren Augen taugt. Sie ist sehr solid und vernünftig, ich bin sehr froh eine
solche Kunstfreundin gefunden zu haben.“
Ihrem Vater schreibt sie am 16. August: „Nun möchten Sie auch etwas von
Schleißheim hören, nicht wahr? Es gefiel mir und meiner Kollega, Frl. Reinhard
von Carlsruhe, so wohl, daß wir gerne diesen Sommer ganz da zugebracht hätten,
wenn wir nicht Logis in München gehabt hätten. Wir logierten mit Herrn Mannlich
ganz allein in dem großen Schloß von 400 Zimmern und 4000 Gemälden. Mannlich
hatte den ganzen Tag mit den altdeutschen Bildern zu tun und in der Legende zu
studieren, und wir zeichneten zuerst nach Martin Schön, nach Beham, Poless und
Holbein, dann gingen wir zu den Italienern, wo ich die Fortuna von Guido Reni
nachzeichnete.“

Margarete Geiger beim Malen in
Schleißheim.
Aquarell von Sophie Reinhard, 1807.
Privatbesitz Schweinfurt
Im Schleißheimer Schloss lernten die beiden Künstlerinnen den
späteren Schlachtenmaler Albrecht Adam kennen, der dort ebenfalls nach alten
Meistern kopierte. In seinen Lebenserinnerungen charakterisiert er Sophie
Reinhard folgendermaßen: „Bei einem hellen Verstande hatte sie sehr viel
Witz, welcher leicht in bittere Wahrheiten überging, die aber verständige
Menschen nicht verletzen konnten, weil es wirklich Wahrheiten waren; auch
wurden sie immer bald wieder durch ihr treffliches Gemüth und eine ihr
eigenthümliche Ruhe ausgeglichen. Ohne gerade schön zu sein, hatte sie ein
angenehmes Aeußere, ein gewisser ironischer Zug schwebte fast immer um ihren
Mund und kleidete sie gut.
Mit diesen Eigenschaften, verbunden mit der großen Achtung,
welche ich vor ihr hatte, verschaffte sie sich bald, und nicht zu meinem
Nachtheil, einen bedeutenden Einfluß auf mich. Nicht umsonst hatte sie mich, als
ich sie in der Gallerie zum erstenmale sprach, ersucht, ihr mein Vertrauen zu
schenken, dieses wurde auch nach und nach so groß, daß ich ihr über die kleinste
meiner Handlungen Rechenschaft ablegte.“
Charakteristisch für das selbstbewusste Auftreten der
Künstlerin ist eine Begebenheit, die sich in der Schleißheimer Galerie zutrug,
als Albrecht Adam eine dort angefertigte Kopie zu einem außerordentlich
niedrigen Preis an einen Kunsthändler verkauft hatte. „Eines Morgens war ich
wieder wie gewöhnlich sehr frühe in der Gallerie; es wurden erst nach und nach
die grünen Vorhänge aufgezogen. Da erschien bald nach mir … Sophie
Reinhardt aus Karlsruhe. Sie wünschte mir einen guten Morgen, sprach von
gleichgültigen Dingen und ging mit mir durch die ganze Gallerie, was ich
gewöhnlich that, ehe ich zu arbeiten begann. Wir kamen bis in den letzten Saal,
da lenkte sie das Gespräch auf meine Handelschaft. Sie nahm mich auf eine
Vertrauen erregende Weise in eine Art Verhör, aus welchem Grunde ich diese
schöne Copie um solchen Spottpreis verkauft hätte und wie ich zu der
Bekanntschaft mit diesem Menschen gekommen sei, warnte mich ernstlich und sagte:
»Sie sind so jung und talentvoll und scheinen mir noch wenig mit dem Treiben in
der großen Welt bekannt zu sein; hüten Sie sich vor diesem und ähnlichen
Menschen, sie sind gefährlich für junge Leute. Es ist ein Mäkler, der mit allem
Geschäfte treibt und er steht nicht in dem besten Rufe. Solche Menschen ziehen
gerne junge Leute an sich, besonders wenn sie bemerken, daß diese talentvoll und
unerfahren in ihren Manipulationen sind, strecken ihnen wohl auch etwas Geld
vor, um ihnen ihre Arbeiten abdrücken zu können, und ehe man sich dessen
versieht, ist man an sie gebunden. Schenken Sie mir Ihr Vertrauen und
unterrichten Sie mich über Ihre Verhältnisse, ich besitze die Gunst der Königin
Karoline und habe Zutritt bei ihr, vielleicht kann ich etwas für Sie thun.« Es
leuchtete aus allem hervor, daß sie vermuthete, ich hätte aus Geldverlegenheit
meine Arbeit so wohlfeil hergegeben. Ich versicherte sie, daß ich das aus keinem
andern Grunde that, als weil ich eben der ersten kleinen Copie, welche ich hier
gemacht, keinen höhern Werth beigelegt hatte. Der Mann habe bezahlt, was ich
begehrt, mehr könne man ihm nicht zumuthen. Was übrigens eine nähere
Bekanntschaft mit diesem Menschen betreffe, werde ich mir ihre Warnungen gewiß
zu Herzen nehmen; er habe mir vom ersten Augenblicke an, wo ich ihn gesehen,
ohnehin keinen Vertrauen erregenden Eindruck gemacht. Ich dankte ihr so
verbindlich, als ich konnte, für ihre Theilnahme und sagte, daß ich für das, was
ich vielleicht für meine Arbeit zu wenig erhalten habe, mich jetzt schon
reichlich dadurch entschädigt sehe, daß diese Veranlassung mir das Vergnügen,
eine so achtbare Dame kennen zu lernen, verschafft habe.“
Im September berichtet Margarete
Geiger ihrer Schwester: „Vor einigen Tagen machte ich mit meiner Reinhard und
einem kleinen, geschickten Bildhauer namens Kirchmaier einen Spaziergang. Wir
gingen eine Stunde von hier nach Harlaching, wo Claude Lorrain gewohnt hat. ...
Die schöne Gegend ist ganz seiner würdig! Der Weg führt durch eine Pappelallee
über mehr als 100 Wehre oder kleine Wasserfälle; der Ort selbst liegt auf einer
Anhöhe, von wo aus München in der Ferne in seiner ganzen Größe erscheint.
Schade, daß der Wind so ging und wir gar nicht zeichnen konnten! Doch waren wir
vergnügt, denn die Reinhard lacht so gerne wie Du. Sie läßt Dich wie ich bitten,
wieder einmal was von Deinen Geniestreichen zu schicken, dafür schickt sie Dir
was aus ihrem Taschenbuch. Wir zeichnen immer miteinander. Neulich malten wir
ein junges, sehr schönes griechisches Profil miteinander, in Pastell auf graues
Papier. Das Pendant dazu soll ein junger Russe werden, der einen ganzen
Ganymedeskopf hat.“
Am Ende Oktober 1807 schreibt
Margarete Geiger ihren Eltern: „Von dem grauen Papier, worauf Reinhard malt und
worauf das Schleißheimer Mädchen ist, werde ich nächstens etwas schicken. Sie
malt auch auf Ölgrund, der frißt aber sehr viel Farbe. … Vorige Woche zeichnete
ich bei Reinhard 12 Hände, nämlich Abgüsse von Wachs, die Herrn Direktor Langer
gehören. Damit wir uns das Studieren noch leichter und angenehmer machen können,
so ziehe ich künftigen Monat zu Frl. Reinhard, wo wir heller, reinlicher und
ruhiger logiert sind. … Meine Adresse schreiben Sie künftig so: An Mademoiselle
G. bei Madame LeSuire, nächst dem Maxtore No 208, über 3 Stiegen.“
Einige Wochen später schreibt sie an die Eltern: „Wir leben wie ein paar
Eheleute zusammen, nämlich noch in Flitterwochen. Einer Studentenhaushaltung
sieht es auch manchmal bei uns gleich, doch immer einer weiblichen, da hat meine
liebe Mutter recht. Wir machen Toilette, kochen, essen, lachen, necken, flicken,
stricken und plaudern ganz weiblich, aber doch verträglich miteinander.“
Mit Albrecht Adam veranstalteten
Sophie Reinhard und Margarete Geiger kleine Kompositionswettbewerbe, über die
Margarete Geiger ihrer Schwester im Winter 1808 brieflich berichtet: „Wir
componieren, was das Zeug hält, ein junger Künstler, namens Adam, ist in unserer
Zeichenkonkurrenz, wozu auch Du eingeladen bist, wir geben nämlich Themen aus
Gedichten auf, welche alle Samstage erst gezeigt werden, wir haben schon
inventiert aus Bürger Dein Favoritgedicht Leonardo und Blendina, den Bruder
Graurock etc. etc.“
Im Frühjahr 1808 traf in München
Jakob Wilhelm Huber aus Zürich ein, um sich künstlerisch fortzubilden. Sowohl in
der Galerie studierte er seinen Lebenserinnerungen zufolge
fleißig die Alten Meister, als auch zeichnete er eifrig nach der Natur. Doch
bereits nach sechs Monaten beschloss er, nach Wien weiterzureisen. „In
Gesellschaft von Frl. Geiger der Tochter des Malers Geiger, von Wilhelm Lohmeier
aus Meiningen und Sophie Reinhard aus Karlsruhe, der verdienstvollen Urheberin
von Radirungen zu Hebels allemannischen Gedichten, bestieg er ein Floss und kam
nach fünftägiger Reise in der Kaiserstadt an.“
Am 23. Juni schreibt Margarete Geiger
auf der Reise nach Wien aus Passau an ihre Eltern: „Ich und Reinhard hatten das
Glück, ganz charmante Reisegefährten zu bekommen, nämlich einen jungen
Landschaftsmaler namens Huber aus Zürich und einen jungen Kaufmann Lohmayer aus
Memmingen, der lange in der Schweiz war. Wir wurden von einer Escorte von 10
Malern, worunter auch der alte, ehrliche Kellerhoven war, ans Wasser geleitet,
wo es viel Grämen gab. Das Frühstück nahmen wir bei Langers ein. Von ihnen fiel
mir der Abschied sehr schwer wie auch von Frohbergs, in denen ich so gute
Freunde fand.“
Schon kurz nach der Ankunft in Wien
am 27. Juni berichtet Margarete Geiger im Juli 1808 an ihre Schwester über das
Kunststudium in Wien, wo Frauen an der Akademie wie in München ebenfalls nicht
zugelassen waren. „Reinhard malt im Hause des Herrn Direktor v. Füger, um die
Behandlung der Ölfarben zu erlernen. Wir speisten schon einige Male bei ihm. Er
ist uns in allem sehr gefällig, und wenn er ins Plaudern kommt, ist nicht wieder
von ihm loszukommen. Er ist ein Mann von außerordentlichem Kunstfeuer. Das
Erfinden ist ihm sehr leicht, nur wäre zu wünschen, daß er die Natur auch
manchmal zu Rate zöge. Er verläßt sich zuviel auf sein Gedächtnis und behandelt
die Farbe als Hauptsache. Die Academie haben wir auch gesehen. Sie ist sehr gut
eingerichtet und hat eine Menge Schüler, die sich alle mit Gott entschlossen
haben, Künstler zu werden“.
Sophie Reinhard lernte dort den Maler und Radierer Karl Ruß sowie den
Landschaftsmaler Josef Abel näher kennen. Mit Karl Ruß teilten Sophie Reinhard
und Margarete Geiger ihre Neigung, Trachten der verschiedenen Stände und deren
landsmannschaftliche Unterschiede genau zu beobachten und in Zeichnungen
festzuhalten. Zu beiden Künstlern entwickelte Sophie Reinhard ein besonders
freundschaftliches Verhältnis. Allerdings hat diese Freundschaft nicht über die
Wiener Jahre hinaus gedauert.
Bei Heinrich von Füger wurden die
beiden Künstlerinnen mit Sicherheit auch in der Miniaturmalerei unterrichtet,
denn Füger galt damals in Wien als einer der bedeutendsten dieses Genres.
Naheliegend ist die Ausbildung in dieser Kunstsparte schon deshalb, weil die
Miniaturmalerei in jener Zeit als eine Art des künstlerischen Broterwerbs galt,
den man für Künstlerinnen als besonders geeignet ansah. Sophie Reinhard muss
denn auch später eine geschätzte Miniaturmalerin gewesen sein.
Für beachtenswert weitblickend halte
ich ein Zitat aus einem Brief von Margarete Geiger, die damals aus Wien an ihren
Vater schreibt, als sie von der geplanten Hochzeit ihrer Schwester erfuhr, die
ebenfalls Künstlerin war: „Ihr Talent betrauere ich, das bald sein Grab in der
Wiege finden wird. Doch es steigen daraus wieder Freuden, die ihr und Ihnen das
Leben würzen werden und die keine Phantasie zaubern kann.“
Weiter schreibt sie in diesem Brief vom 2. September 1808 an ihren Vater: „Nun
will ich auch etwas von Kunst schwätzen. … Heute besuchte ich in der
Augustinerkirche das Grabmal der Herzogin Christina, wohin ich oft mit Reinhard
wallfahre. Sie kennen es wohl aus dem Kupferstich und der Beschreibung, die aber
kaum ein Gedanke davon sind. Der Schöpfer Canova schuf aus Steinen trauernde
Gestalten, woran aber auch nur der Stein irdisch ist.
Weiter schreibt sie: „Reinhard ging heute nach Pressburg mit ihren Landsleuten,
um die Krönung der Kaiserin dort zu sehen. Ich gab ihr den Auftrag, sich nach
Herrn Vetter Friedrich zu erkundigen. Sie läßt danken für das öftere Andenken in
Ihren Briefen.“
Im zweiten Feldzug gegen Österreich
standen im Mai 1809 Napoleons Truppen vor Wien und nahmen die Stadt am 11. und
12. unter schweren Beschuss. Huber konnte sich in den Keller des Palastes von
Baron Natorp flüchten, wo auch Sophie Reinhard, die Gräfin Isabella von
Beroldingen und die Fürstin Kinsky den Einschlag der Bomben und Granaten
miterlebten. Um drei Uhr Morgens endete die Beschießung und die siegreiche
französische Armee zog daraufhin in Wien ein.
An ihre Schwester schreibt Margarete Geiger: „Was mich für meine Todesangst
etwas entschädigt, ist, daß mich heute ein paar Bekannte von München besuchten:
mein guter Graf Frohberg und der Bataillenmaler Adam, welcher mit ihm reiste, um
sein Fach zu studieren.“ Zwei Monate später schreibt Margarete Geiger ihrer
Schwester: „Ich male jetzt meine Sofie Reinhard, wohin sich meine arme Muse
gleich einem schüchternen Täubchen flüchtete. Sie wird das Pendant zu Deinem
Portrait. Sie versucht dafür, meine Venusgestalt zu verewigen und zu
verherrlichen.“
Die Kriegswirren und der Tod ihres Vaters müssen für Margarete Geiger so
belastend gewesen sein, dass sie dadurch geschwächt, von einem nach der
Eroberung der Stadt ausgebrochenen Fieber befallen wurde, dem sie am 4.
September erlag.
Sicherere Zeiten entstanden erst wieder durch den Friedenschluss auf Schloss
Schönbrunn am 14. Oktober 1809.
Jetzt konnte Sophie Reinhard es
wagen, zusammen mit Jakob Wilhelm Huber nach Karlsruhe zu reisen, da in Wien an
eine weitere künstlerische Ausbildung in diesen unruhigen Zeiten nicht mehr zu
denken war. „Hier wurde er von ihren Verwandten so freundlich aufgenommen, dass
er sich entschloss, von October 1809 bis Ende August 1810 dort zu bleiben und
Unterricht im Zeichnen und Malen zu geben.“
Sophie Reinhard entfaltete in dieser Zeit in Karlsruhe eine bemerkenswerte
künstlerische Aktivität. Ihrem Bekannten Albrecht Adam berichtet sie am 7. März
1810: „Ich fange nächste Woche ein groses Bild an aus Göthes Wahlverwandschaften,
dieß und das Portrait meiner Mutter (meinen V. habe ich schon gemahlt).“
Portraits der Eheleute Maximilian und Jacobina
Reinhard.
Ölgemälde von Sophie Reinhard, 1810.
© Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, Inv.-Nr. 2648
und 2647
Aus Goethes Roman, der im Jahr zuvor
erschienen war, griff sie die zwei dramatischen Szenen vom Ende des zweiten
Teiles auf, in der einen sitzt Ottilie mit dem toten Kind im Kahn und in der
anderen liegt sie auf dem Totenbett. Hofrat Heinrich Meyer schrieb am 20. April
1810 aus Weimar in einem Brief an Goethe: „Vor ein paar Tagen brachten mir
Fremde aus Carlsruhe einen Brief von Weinbrenner und zugleich die beyliegenden
Contradrücke von Zeichnungen, die, wie Sie sehen, ein geschicktes Mädchen
daselbst (Tochter eines Geheimraths Reinhard) nach den Wahlverwandtschaften
verfertigt. Sie wolle, schreibt Weinbrenner, bald nach Rom reisen, um daselbst
weiter zu studieren“,
worauf Goethe am 27. April aus Jena antwortete: „Die beyden Contradrucke folgen
auch. Das gute Kind kann wohl was und könnte noch mehr lernen, aber das
Schlimmste ist: sie denkt falsch wie die sämmtliche Theecompanie ihrer
Zeitgenossinnen; denn in unsrer Sprache zu reden, so hole der Teufel das junge
künstlerische Mädchen, das mir die heilige Ottilie schwanger aufs Paradebett
legt. Sie wissen besser als ich, was ich sage. Jene können nicht vom Gemeinen
und Niederträchtigen, von der Amme, von der Madonna los kommen, und dahin zerren
sie alles, wenn man sie auch gelinde davon zu entfernen wünscht. Das todte,
wirklich todte Kind gen Himmel zu heben, das war der Augenblick der gefaßt
werden mußte, wenn man überhaupt solches Zeug zeichnen will − so wie im andern
Falle in der Capelle für mahlerische Darstellung nichts gelten kann, als das
Herantreten des Architekten. Aber wo sollte das Völklein, bey allem freundlichen
Antheil, hernehmen, worauf es ankommt!“
Trotz dieser kritischen Anmerkungen ließ Goethe beide Blätter auf der
Kunstausstellung 1811 in Weimar der Öffentlichkeit zeigen.
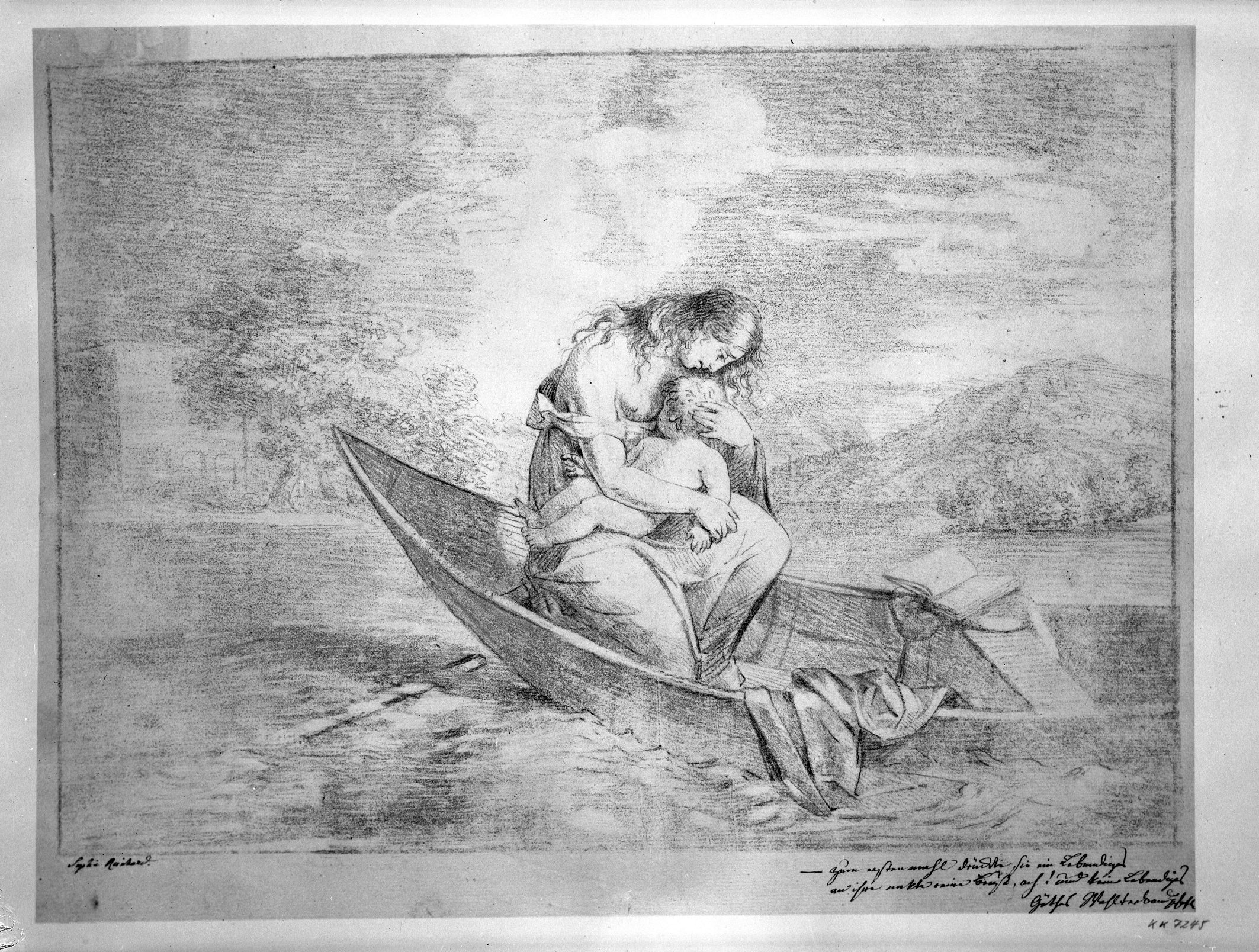
Ottilie mit totem Kind im Kahn. Szene
aus Goethes Wahlverwandtschaften.
Kreidezeichnung von Sophie Reinhard,
1810.
Klassik Stiftung Weimar,
Museen/Inv.-Nr. KK 7245
Im Journal des Luxus und der Moden
wird im Jahrgang 1810 berichtet, dass Dem. Reinhard, eine bekannte Malerin,
demnächst nach Italien abreisen wird. „Sie hat eine Madonna mit dem Kinde, ein
zartes gemüthliches Bild, welches ohne Affektion an die alten italienischen
Bilder erinnert, und einige sehr gute Portraits geendigt, auch aus Göthe’s
Wahlverwandtschaften Stoff zu einem lieblichen Bilde, Ottilie mit dem Kinde auf
dem See, genommen.“
Italienreise 1810 bis 1814
Ende August 1810 brach Sophie
Reinhard zusammen mit Jakob Wilhelm Huber zu einer Reise nach Italien auf, von
der sie sich neue künstlerische Anregungen versprach. Über den Verlauf dieser
Reise bis nach Mailand sind wir durch den Vater der Künstlerin Maximilian
Wilhelm Reinhard sehr gut informiert.
„Meine Tochter, die Frau meines Sohns,
Herr Huber ein geschickter Landschaftmaler aus Zürich, und ich fuhren in einem
guten Miethwagen am 23. August 1810 früh um fünf Uhr von Karlsruhe ab, aßen in
Achern zu Mittag und übernachteten in Offenburg. Bei dem angenehmen Sommerwetter
und der heiteren Stimmung, in der wir uns befanden, waren wir mit diesem ersten
Tag unserer Reise wohl zufrieden, ungeachtet das fruchtbare schöne Land, durch
das wir fuhren, uns schon lange bekannt war, mithin uns das Vergnügen nicht
gewähren konnte, das denen zu Theil wird, die in einem schlechteren Lande
wohnen, und es zum erstenmal sehen.“ „Den 24. Morgens früh fuhren wir bei gleich
schönem Wetter von Offenburg durch das schöne Kinzigthal an Gengenbach vorbei,
bis an das Wirtembergische Städtchen Hornberg, das in einem sehr engen Thale
liegt, in seinen engen Straßen kaum Platz für die sich bewegenden Wagen hat,
und, wie man sagt, nebst der Herrschaft Nellenburg und einigen anderen
Besitzungen, die zusammen 45.000 Einwohner enthalten, von Wirtemberg an Baden
abgetreten werden soll.“
„Einige Stunden nach unserer ferneren Reise kamen wir nach Krummenschiltach,
einer Wirtembergischen Poststation mitten im Schwarzwald. … Nachdem unsere
Pferde mit etwas Brot gestärkt waren, setzten wir unsern Weg über das
Wirtembergische Dorf St. Georgen fort, und kamen endlich Abends spät nach dem
badischen Städtchen Villingen, wo wir in der Post unsere Herberge fanden.“
„Von Villingen führte uns der Weg
über Donaueschingen, wo wir uns aber nicht länger aufhielten, als nöthig war, um
auf dem Markte, über den wir fuhren, Kirschen zu kaufen, deren in Karlsruhe
schon mehrere Wochen lang keine mehr zu haben waren. Den Ursprung der Donau, das
wohleingerichtete und einträgliche Brauhaus kannte ich schon, so wie die
verehrungswürdige Fürstin, welche über ihren einzigen Sohn die Vormundschaft
führt, und ihren vorzüglichen Geschäftsmann, den Geheimrath v. Kleiser. Mittags
kamen wir an das badische Zollhaus an der Gränze des Schweizerkantons
Schaffhausen, das zugleich ein Wirthaus ist.“
„Nachmittags erstiegen wir einen bedeutenden Berg zwischen Zollhaus und
Schaffhausen – den Randen – der besonders auf der Seite gegen Schaffhausen
ziemlich jähe ist. … Schaffhausen mit seinen nahe gelegenen Orten hat schon viel
Weinbau, den wir eine lange Strecke von 16 Stunden vermißt hatten, und nun mit
Freuden wieder vor uns sahen.“
Nach einer Fußwanderung zum Schloss
Laufen und über die Treppe hinunter bis an den tosenden Schaffhausener
Wasserfall, lies sich die Reisegesellschaft mit einem Kahn über den Rhein
setzen, und erreichte „das Dorf Neuhausen, wo wir unseren Wagen antrafen, mit
dem wir gegen Mittag nach Eglisau kamen, wo wir – wie in Schaffhausen, recht
gute Bewirthung, aber auch stärkere Zeche, als in unserem Schwaben, fanden.
Abends, gegen 8 Uhr, kamen wir unter Donner und Blitz in Zürich an. … Im Hause
des älteren Malers Huber, Vaters unseres Reisegefährten, fanden wir die
freundlichste Aufnahme.“
Von Huber wurden die Gäste mit den
Züricher Künstlern und Architekten jener Zeit bekannt gemacht, darunter Karl
Schulthess, Konrad Gessner, Konrad Usteri und Hans Kaspar Escher, ein Schüler
von Weinbrenner. Man besuchte gemeinsam die Füßlische Kunsthandlung und die
Sammlung von Originalgemälden Salomon Gessners, welche seine Witwe in ihrem
Wohnhaus in der Münstergasse zeigte. Für Sophie Reinhard, die noch kurz vor der
Abreise nach Italien ein Gemälde nach Salomon Gessners Idylle „Der erste
Schiffer“ fertig gestellt hatte,
muss dieser Besuch besonders wichtig gewesen sein.
Am Montag den 3. September verließen
sie Zürich Richtung Italien. Mit der Kutsche fuhr die Reisegesellschaft, der
sich der alte Johann Kaspar Huber angeschlossen hatte, nach Zug. Über den
Zugersee gelangten sie mit dem Schiff nach Arth, um anschließend wieder mit der
Kutsche nach Brunnen zu fahren, wo sie übernachteten.
„Am folgenden Morgen gingen wir bei
guter Zeit zu Schiff. … Von Flühelen, wo wir landeten, kamen wir nach Altdorf,
einem ansehnlichen Orte, und von da durch schöne fruchtbare Gefilde, zwischen
nah gelegenen hohen steilen Bergen, an die schnellfließende Reuß, die oben auf
dem Gotthardt entspringt, und nun unsere beständige Begleiterin bis dahin war,
und endlich nach Am Steeg, von wenigen Häusern, wo das Fahren ein Ende hat, und
die Reise zu Fuße oder zu Pferde fortgesetzt werden muß,“
um nach Wassen, der letzten Übernachtungsstation vor der Passhöhe zu gelangen.
Bei regnerischem Wetter erreichten sie am nächsten Tag, den 5. September, bei
Eintritt der Dämmerung die Passhöhe. Da das Hospiz auf der Passhöhe sich als
nicht mehr bewohnbar erwies, mussten sie notgedrungen den Abstieg beginnen, um
unter großer Gefahr um 9 Uhr in der Nacht in Airolo anzukommen.
In der nächsten Tagreise über „Vaido
und Poleggio kamen wir Abends nach Bellinzona, wo wir die Nacht zubrachten, und
am folgenden Tage auf einer seit wenigen Jahren über den Monte Genere gebauten
schönen Chaussee über Lugano, wo wir sogleich ein Schiff mietheten, und Capo di
Lago, wo wir einen Wagen nahmen, nach Como.“
„Am folgenden Tag, den 8. September, kamen wir über Barbesina, einem kleinen
Flecken halbwegs Mailand, wo wir etwas aßen, das für Frühstück und Mittagessen
gelten mußte – Nachmittags 3 Uhr nach Mailand.“
Nach dreieinhalb Tagen Aufenthalt reisten Johann Kaspar Huber, Amalia Reinhard
und Maximilian Wilhelm Reinhard am 12. September auf demselben Weg, wie sie
gekommen waren, nach Karlsruhe zurück. Jakob Wilhelm Huber und Sophie Reinhard
in Begleitung ihres Hundes trennten sich von der Reisegesellschaft, um sich auf
den Weg nach Rom zu machen.
Über Piacenza, Bologna, Florenz und
Siena erreichten die beiden Ende September 1810 Rom, wo sie eine geräumige
Wohnung in der Nähe von Trinità dei Monti anmieteten.
Sie machten von den mitgebrachten Empfehlungsschreiben an den Kupferstecher
Wilhelm Friedrich Gmelin aus Badenweiler sowie an die beiden bedeutenden
Landschaftsmaler Johann Christian Reinhart und Joseph Anton Koch Gebrauch, um
mit dem Kreis der deutschen Künstler in Rom in Kontakt zu kommen.
Wenige Wochen später, am 11. Oktober
1810 kam Karl Friedrich von Uexküll mit seiner Gattin in Rom an, mit dem Sophie
Reinhard gut bekannt war, und in dessen Begleitung sie ebenfalls nach Italien zu
reisen versucht hatte, was der Schriftverkehr zwischen der Künstlerin und dem
Freiherrn von Uexküll im Frühjahr und Sommer 1810 belegt. Gemäß einem Eintrag in
seinem Tagebuch traf sich Uexküll noch am Tag seiner Ankunft mit dem
Kunsttischler Karl Roos, mit Johann Martin von Rohden und Sophie Reinhard. Tags
darauf besuchte er mit seiner Frau und Sophie Reinhard das Kapitol, das
Kolosseum und die Basilika San Giovanni in Laterano.
Eine bedeutende Empfehlung für ihre
Weiterbildung in Rom hatte Sophie Reinhard durch ein Schreiben des Münchner
Galeriedirektors Christian von Mannlich an Friedrich Müller erhalten, der am 23.
November 1810 wie folgt antwortete: „Eure Hochwohlgebohren hätten mit keinem
angenehmern Auftrage mich beehren mögen, als derjenige welchen Hochdero lezteres
Schreiben enthält, worinnen Sie mir die Fräulein Sophia Reinhart aus Carlsruh
empfehlen. Besagtes Frauenzimmer ist schon seit einem Monathe hier angelangt,
und ich hatte seitdem ihre Bekanntschafft schon bey einem meinem Freunde dem
Herrn Baron von Ixenküll aus Stuttgard, der mit seiner Gemahlin seit einigen
Wochen gleichfalls sich hier befindet, gemacht, und wir waren überein gekommen
daß Sie nächstens mir die Ehre eines Besuches in meinem Studium gönnen würde;
allein nach dem Empfange von Hochdero Schreiben verfügte ich mich so gleich in
ihre Wohnung, um nach Eure Hochwohlgebohrnen Anweißung ihr meine Dienste an zu
biethen. Sie nahm diesen Beweiß von unverdienter Gnade, wie Sie sich ausdruckte,
von unsrer Huldreichsten Monarchinn, nicht ohne die augenscheinlichste Rührung
auf, und versicherte daß Sie einer so erhabnen und mächtigen Beschüzerin ihren
Danck selbsten schrifftlich zu Füßen legen werde. Ich habe bey dieser
Gelegenheit einige Arbeiten gesehen, die Sie aus Deutschland mit gebracht; es
fehlt ihr nicht an Talent und gutem Willen, allein Haupttheilen von nothwendigen
Kenntnißen, besonders die von einer richtigen Proporzion der menschlichen Figur,
so wohl nach pathognomisch-plastischer, als auch mahlerisch-perspectivischer
Ansicht und hinnlängliches Verständniß der Harmonie für das Colorit mangeln ihr
noch sehr, um mit sicherem Fuße in eignen Produckten vorschreiten oder aus den
Studien großer Muster, besonders den Wercken des Raphaels den gehörigen Nuzen
ziehen zu dürffen. Ich habe nicht unterlaßen diß, bey meinen Auffmunterungen auf
eine schickliche Weiße ihr mercken zu laßen, und Sie hat es mit Danck
aufgenommen. Alles was in meinem Vermögen stehet, werde ich anwenden um Eure
Hochwohlgebohrnen Auftrag und in diesem den Willen unsrer huldreichsten und
gnädigsten Königin zu erfüllen; daher darnach trachten, daß besagte Fräulein um
so früher zum Ziele ihrer Wünsche und ihres Glückes gelangen möge; denn der
reine Mensch kann doch nur wahre Genugthuung in der Ausübung deßjenigen finden,
was er als das würdigste in sich erkannt und wozu die Natur Beruff und Sehnsucht
in ihn gelegt hat. Ich werde nächste Woche Sie in die Studien der berühmtesten
Künstler, die meistens meine Freunde sind, begleiten und von meiner Seite
besonders empfehlen, damit ihr solche jederzeit offen stehen.
Im Betrachte aber wegen der
Erlaubtniß die französische Academie zu besuchen, die seit Eure Hochwohlgebohren
Abweßenheit von Rom eine ganz andre Ansicht angenommen, und wie vermutlich
Hochdenenselben bekannt ist, nun in die Villa Medicis verlegt worden, habe ich
für zuträglich erachtet, an S. Ellz. den Herrn Bischoff von Chersoneß nach
Neapel zu schreiben, damit solche in dieser Hinnsicht mich mit einem besondern
Empfehl ausrüsten. Dieses habe ich darum als nothwendig geglaubt, weil die
dortige zahlreiche Gipssammlung, welche durch den Fleiß des lezt verstorbnen
Direcktors um vieles vermehrt worden, von Individuen und Pensionären aus
verschiedenen Nazionen häuffig besucht wird, worunter nicht selten sich auch
ungezogne Leute finden, um auf diese Weise für das Fräulein hiebey desto
kräfftigere Rucksicht aus zu würcken und ihr eine höhere Achtung zu versicheren.“
Gern gesehener Gast bei den
Abendgesellschaften, die der pensionierte württembergische Staatsrat Karl
Friedrich Freiherr von Uexküll und seine Frau im Winter 1810/1811 in Rom
veranstalteten, waren Joseph Anton Koch, Johann Martin von Rohden, Friedrich
Müller und natürlich Sophie Reinhard. Eine Zeichnung von Joseph Anton Koch
schildert einige Gäste einer solchen Abendgesellschaft vom Winter 1810/1811,
darunter Sophie Reinhard und der Maler Rudolph Suhrlandt.
Die Familie Uexküll bewohnte auf dem
Monte Pincio zwei schöne Zimmer im Haus des englischen Bildhauers, Malers und
Kunsthändlers Alexander Day an der Piazza Trinità dei Monti Nr. 11, wo auch
schon Johann Anton Koch gewohnt hatte.
Sophie Reinhard wohnte nebenan. Uexkülls Reisebegleiter Carl Urban Keller, der
dort auch wohnte, hat den Ausblick von der „Casa Dai“ auf die Stadt dargestellt.
Zu sehen ist der Obelisco Sallustino, der 1789 auf der Piazza Trinità dei Monti
aufgestellt worden war, und der Palazzo Zuccari mit dem Porticus mit seinen vier
Säulen sowie in der Ferne die Kuppel des Petersdomes.
Das Haus von Alexander Day schloss sich an den säkularisierten Konvent von
Trinità dei Monti an, von dem es nur durch seinen Garten getrennt war.
An diesem Haus mündete die Via Felice, die später in Via Sistina umbenannt
wurde, auf die Piazza Trinità dei Monti.
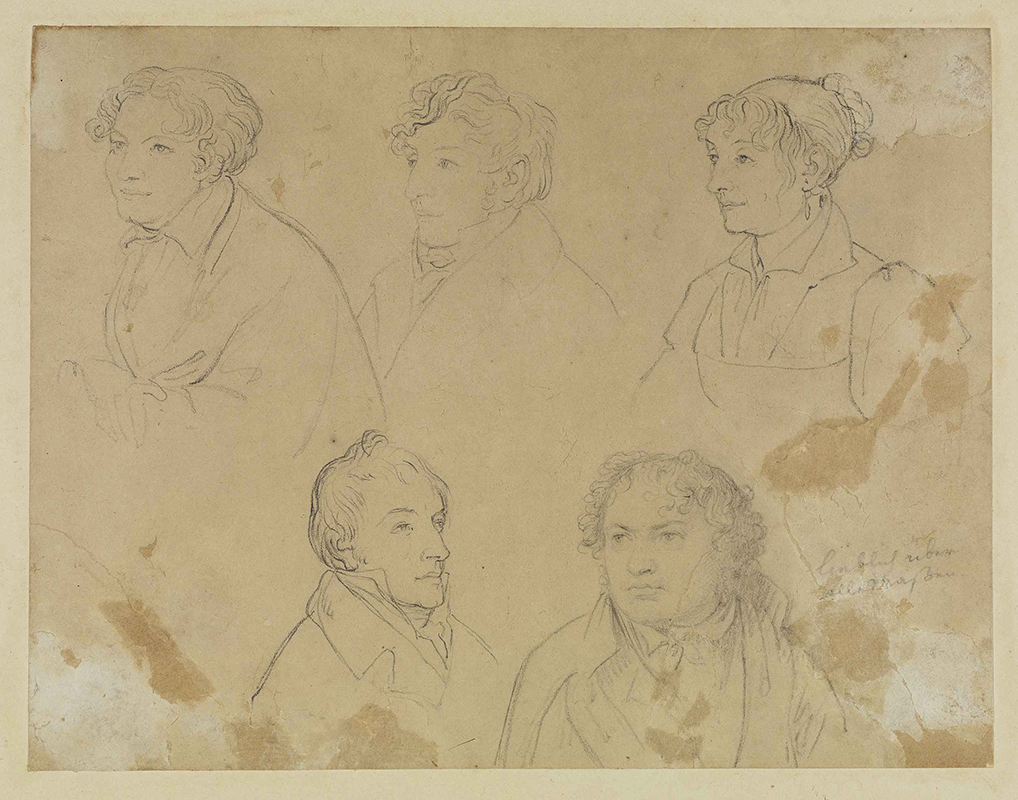
Gäste einer Abendgesellschaft
bei Karl Friedrich Freiherr von
Uexküll und dessen Gattin Elisabeth von Uexküll.
Zeichnung von Joseph Anton Koch.
Obere Reihe von links: Sophie Reinhard, Baron Kniphausen, Signora Day.
Untere Reihe von links: Rudolph
Suhrlandt und Joseph Anton Koch (dieser gezeichnet von Suhrlandt).
© Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, Inv.-Nr. 1986-38
Die Ehe des Hausvermieters Day
scheint ziemlich problematisch gewesen zu sein, denn in einem Brief an Uexküll
in Neapel schreibt Sophie Reinhard ein Jahr nach ihrem Einzug: „ich glaube
beinah, Sie oder Hr. von Rak, hat sich an ihm einen üblen Geschäftsträger
gewählt, seine Frau war mehrere Monathe auser dem Hauß, wohnt aber jetzo wieder
im Hauß ihres Mannes, doch oben wo Sie wohnten, da sie fürchtet der Sohn möchte
zum zweitenmal glücklich seyn in seinem Versuch sie umzubringen.“
Day selbst wohnte gegenüber im Palazzo Zuccari, wo er eine Wohnung im ersten
Obergeschoss gemietet hatte.
Der Palazzo Zuccari trug damals die Hausnummer Piazza Trinità dei Monti Nr. 14
und war eine bedeutende Adresse der Deutsch-Römer auf dem Monte Pincio. Einen
guten Eindruck, in welcher Umbebung das Ehepaar Uexküll und Sophie Reinhard auf
dem Monte Pincio gewohnt haben, schildern ein Stich von Domenico Amici aus dem
Jahre 1839 und eine Vedute von Carl Billmark aus dem Jahre 1852.
Im Palazzo Zuccari hatte Johann Christian Reinhart seit 1793 eine Wohnung
bezogen, hier hat Winckelmann nach seiner Ankunft in der Ewigen Stadt gewohnt,
später Goethes Freund Rat Reiffenstein, der Kunstkritiker Carl Ludwig Fernow und
Joseph Anton Koch. Dort residierte ab 1815 der Preußische Generalkonsul Salomon
Bartholdy und ließ von Peter Cornelius, Friedrich Overbeck, Wilhelm Schadow und
Philipp Veit einige Räume seiner Wohnung mit den Fresken der Josephs-Geschichte
ausmalen.
Vedute von Domenico Amici aus dem
Jahre 1839 mit Blick auf den Obelisco Sallustiano, den Palazzo Zuccari und das
Wohnhaus von Alexander Day neben der Kirche Trinità dei Monti auf dem Monte
Pincio (linke Abbildung); Vedute von Carl Billmark aus dem Jahre 1852 mit Blick
auf das ehemalige Wohnhaus von Alexander Day, daneben die Mauer mit dem
Zugangstor zu seinem Garten (Bildnachweise: E. Fecker)
Aus den Tagebucheintragungen des
Freiherrn von Uexküll geht hervor, dass Sophie Reinhard mit vielen damals in Rom
lebenden Künstlern recht schnell bekannt war. So besuchte sie zusammen mit
Uexküll am 3. November 1810 den Kupferstecher Conrad Martin Metz, am 6. November
Gottlieb Schick, um sein neues Bild zu sehen.
Zugegen waren dabei auch Uexkülls Stuttgarter Reisebegleiter Dr. Keller und Dr.
Straehlin. Am 25. November besuchten sie gemeinsam mit Friedrich Müller den
Klassizisten und späteren Präsidenten der Accademia di San Luca Vincenzo
Camuccini, um seine Alten Meister und seine eigenen Werke zu sehen. Vom 29. bis
31. Dezember unternahmen sie mit Joseph Anton Koch eine Fahrt nach Tivoli, wo
sie mit den Malern Christian Freye, Johann Martin von Rohden, Gottlieb Friedrich
Steinkopf und Ferdinand Ruscheweyh zusammentrafen. Am 31. Januar 1811 besuchten
sie den Bildhauer Giuseppe Boschi, bei dem Uexküll für 60 Piaster ein Modell der
„Reiterstatue des Mark Aurel“ anfertigen ließ und Sophie Reinhard die
Abschlagzahlungen im Laufe des Jahres besorgte.
Im weiteren Verlauf des Jahres ist ein Besuch zusammen mit Franz Eberhard bei
dem Bildhauer Vincenzo Pacetti und bei Bertel Thorvaldsen verzeichnet. Kurz vor
ihrer Reise nach Neapel unternahmen die Uexkülls vom 6. bis 8. Mai 1811
gemeinsam mit Sophie Reinhard, Martin von Rohden und Franz Eberhard eine
Rundreise nach Albano, Ariccia (mit dem Park des Palazzo Chigi), Rocca di Papa
am Monte Cavo, Genzano, an den Specchio di Diana genannten See und nach Nemi.
Freiherr von Uexküll berichtete über
die Beobachtungen in Italien in seinen „Fragmenten“, einer für seine Freunde
gedruckte Sammlung von Briefen. Er erwähnt, dass er sich über die bei ihm
verkehrenden Künstler, zu denen Voogd, Rohden, Wagner, Gmelin und andere
zählten, in diesen Briefen nicht besonders äußern möchte, weil sie seines Lobens
nicht bedürften. „Aber von einer noch nicht ganz, wie sie es verdiente,
bekannten Künstlerin will ich sie unterhalten. Mademoiselle Reinhard aus
Carlsruh hat ihre in München angefangenen, in Wien fortgesetzten Studien in Rom
so sehr erweitert und mit so großem Erfolge sich gebildet, daß im historischen
Fache sie wohl einer Angelica Kaufmann an die Seite gesetzt werden kann. Sie hat
der Schwierigkeiten, die unsere Sitten im Studieren einer Person ihres
Geschlechtes in den Weg legen, unerachtet in selbigem solche Fortschritte
gemacht, daß, wer ihre Compositionen sieht und mit denen der Angelica Kaufmann
vergleicht, mir nicht Unrecht geben wird. Man ziehe von den wirklichen
Verdiensten dieser Frau das ab, was eine frühe Bildung, ein vieljähriger Umgang
mit Künstlern, Aufmunterungen aller Art, die Tuba der Bewunderung, in die ihre
Freunde in England stießen, der Enthusiasmus, den dieses erzeugte, der Ton der
Mode, das Zuströmen aller Fremden zu ihr, die damals Italien überschwemmten,
ihre gekrönten Mäcenaten, die goldenen Zeiten, die damals für die Kunst
obwalteten, und vor allen Dingen die Stufe, auf der die Kunst stund, als Mengs
erst anfing, zu wirken, und sie zugleich, in der Periode zu arbeiten und bekannt
zu werden, und man sehe, was ihr sonst übrig bleibt, als das Verdienst des
Portraitirens, worin sie unstreitig mit den berühmtesten ihrer Zeitgenossen die
Palme theilt.“
Erhalten ist aus dieser Zeit die
Zeichnung eines „Italienischen Mädchens“, welches sich in der Sammlung Uexküll
befindet.
Die Zeichnung ist wohl während Uexkülls Aufenthalt in Rom von Sophie Reinhard
angefertigt worden, denn sie behandelt das Thema in der für die deutschen Maler
jener Zeit typischen Manier.
Im Morgenblatt für gebildete Stände
vom 12. Juli 1811 heißt es in den Korrespondenz-Nachrichten aus Rom: „Demois.
Reinhard, eine deutsche Künstlerinn, die mit vielem Erfolg ihre Neigung zur
Mahlerey in Wien und München zuerst ausgebildet hat, hat nach einem
fünfmonatlichen Aufenthalt in Rom auch hier die erste Probe ihres Talentes und
Fleisses gegeben in einem einfachgedachten historischem Bilde. Es stellt in
einem gothischen Dom die junge Euphrasia vor, welche von ihrer Mutter in ein
Kloster geführt war, und auf die Frage der Nonnen: Was ihr das Liebste sey? –
ein Kreuz umarmt. Der kindlichreine, innige, unschuldsvolle Blick des sich an
das Kreuz schmiegenden und hinaufsehenden kleinen Mädchens ist vortrefflich
dargestellt. Drey Nonnen in einer angenehmen Gruppe bezeugen ihre freudige
Verwunderung. Im nähern Grunde kniet die betende Mutter der Euphrasia. Das Bild,
das etwa 3 Fuß Breite und 4 Fuß Höhe hat, ist wohl durchdacht, hat eine kräftige
Farbe, und viele Harmonie. Es macht der Künstlerinn doppelte Ehre, da sie selber
die strengste Beurtheilerinn desselben ist.“
Ende September 1811 berichtet die
Künstlerin dem Ehepaar Uexküll in einem Brief nach Neapel,
dass sie drei Wochen in Tivoli verbracht habe und dass sie von da „zu Esel“ die
vierzig Kilometer nach Subiaco weitergereist sei, nicht ohne Stolz anzumerken,
dass sie den Esel meisterhaft reite, was für eine Frau in jener Zeit als
außergewöhnlich anzusehen ist. Auch ihre Freundin Bianca Milesi, hat sich später
dem als störrisch bekannten Fortbewegungsmittel anvertraut, was eine Zeichnung
von Sophie Reinhard in ihrem Italienischen Skizzenbuch belegt.
Im Dezember 1811 besuchte Sophie
Reinhard den Exponenten der sog. Nazarener-Bewegung in Rom, den Lübecker Maler
Friedrich Overbeck, um bei ihm namens der Königin Caroline Friederike Wilhelmine
von Bayern ein Gemälde in Auftrag zu geben. Mit der evangelischen Königin
Caroline, die mit dem katholischen Maximilian von Bayern seit 1797 verheiratet
war, hatte Sophie Reinhard während ihrer Studienzeit in München mehrfach
persönlichen Kontakt, der sich zu einer lebenslangen Freundschaft entwickelte.
Selbst im Testament der Königin aus dem Jahre 1839 wird Sophie Reinhard mit
einem Andenken bedacht.
Caroline war eine geborene Prinzessin von Baden und der ebenfalls evangelischen
Sophie Reinhard sicher schon von Karlsruhe her bekannt, zumal sie gleichfalls in
der Zeichenschule des Hofmalers Phillip Jakob Becker ausgebildet wurde
und damals in Karlsruhe nur eine geringe gesellschaftliche Distanz zwischen dem
Hof und der beamtenbürgerlichen Oberschicht bestand.
Overbeck vermerkt in seinem Tagebuch: Am Montag, den 16. Dezember „schrieb ich
an Sutter, als es klopfte und die Frl. Reinhard in großer Hast und Freude
hereintrat, und mir ankündigte, daß sie mir etwas angenehmes zu sagen habe! Dann
zog sie einen Brief hervor und nachdem sie mir erzählt hatte, daß sie vor kurzem
an die Königin von Bayern über mich und meine Arbeiten geschrieben habe, las sie
mir daraus die Worte vor: »Von dem Maler O. wünsche ich und bitte Sie mir ein
Bild zu bestellen; und mit dem Preise seien Sie nicht so gar gewissenhaft, denn
wenn man etwas Schönes erwartet, läßt man sich die Kosten nicht reuen« – Ich
war so sehr vor Freunde überrascht, daß ich keine Silbe herauszubringen
vermochte!“
Overbeck hatte bereits schon vor dem
Besuch von Sophie Reinhard eine Zeichnung von der Anbetung der heiligen drei
Könige ausgeführt,
und schreibt in seinem Tagebuch weiter: „Mittwoch den 18ten [Dec.] ging ich zur
Frl. Reinhard mit der kleinen Zeichnung, die sie billigte und zu malen rieth. –
Nun ist es also ausgemacht, ich male die Anbetung der heiligen drei Könige,
meinen Lieblingsgegenstand, und male ihn für eine fromme kunstliebende Königin!“
Bereits am 23. Dezember begann er den Karton zu zeichnen und schon im Februar
1812 das Gemälde auszuführen, welches er 1813 vollendete. Die Darstellung in
Overbecks Tagebuch gibt aber nicht die ganze Geschichte wieder. Vielmehr
schildert ein Brief von Sophie Reinhard vom 22. November 1812 an den Freiherrn
von Uexküll den wirklichen Ablauf dieser Gemäldebestellung. Sie ging nämlich
zunächst nicht von der Königin aus, sondern wurde von Sophie Reinhard bei dieser
angeregt und auch der Preis für das Gemälde, den Overbeck ursprünglich mit 20
Louisd’ors veranschlagt hatte, wurde von Sophie Reinhard auf 40 Louisd’ors
heraufgesetzt. Es offenbart sich hier ein Wesenszug von Sophie Reinhard, die
immer wieder ihre Künstlerfreunde zu unterstützen suchte, indem sie ihre
Beziehungen geltend machte, und ihnen dringend benötigte Aufträge beschaffte. So
hat sie sich darum bemüht, dass Freiherr von Uexküll bei Jakob Wilhelm Huber,
der öfters in Geldnöten war, insgesamt vier radierte Kupferplatten ankaufte, die
Huber zum Druck von besonders beliebten Landschaftsansichten von Rom und der
Campagna fertigte.
In den Abrechnungen über das Geld,
welches Sophie Reinhard in Rom für den Freiherrn verwaltete, sind als seine
Arbeiten die Veduten des Klosters San Onofrio, die Ruinen des Sonnentempels im
Giardino Colonna und das Kloster Trinità dei Monti auszumachen.
Jakob Wilhelm Huber hat seit der Ankunft der beiden in Rom zunächst an der
derselben Adresse wie Sophie Reinhard gewohnt, ab Ende 1812 muss Huber aber eine
andere Wohnung bezogen haben, dennoch haben sich die beiden weiterhin häufig
gegenseitig besucht und gemeinsam Reisen unternommen. Ob unter den Platten auch
die bekannte Radierung des Blicks durch das Schlüsselloch des Eingangstores in
den Garten der Kirche S. Maria del Priorato auf dem Aventin war, der im
Hintergrund die Kuppel der Peterskirche erkennen lässt, ist nicht nachzuweisen.
Dass diese Radierung bei dem Verleger Johann Friedrich von Cotta in Stuttgart
gedruckt und verlegt wurde, mit dem Uexküll in regem Kontakt stand, könnte aber
ein Hinweis sein.

Eine der ersten Radierungen, die
Jakob Wilhelm Huber in Rom angefertigt hat, wo er zusammen mit Sophie Reinhard
Ende September 1810 angekommen war. Die Radierung zeigt das Kloster St. Agnese
fuori le mura und ist bezeichnet: J. W. Huber f. Roma 1811
(Bildnachweis: E. Fecker)
Die eigenen künstlerischen
Fortschritte, welche sie in Italien machte, flogen Sophie Reinhard nicht zu,
sondern waren hart erarbeitet, an Uexküll schreibt sie nach Stuttgart: „Ich
hätte Ihnen früher auf Ihren Brief vom 4. Januar geandwortet, wenn ich nicht
durch allerley neue Studien worunter auch die Anatomie gehört wäre abgehalten
worden, ich muß jeden Morgen nach S. Vitale lauffen, und dort sitze ich in
Gesellschaft noch zweier Mahlerinnen (die eine von Bologna die andere von
Mailand) 6 bis 7 Stund vor einem Stück Fleisch das nicht immer ganz angenehm
anzusehn ist, und zeichne mir in kaltem Zimmer Finger und Füsse ganz starr, Sie
können denken daß ich dann Abends nicht fähig zum schreiben bin, waß Sie heute
meinem Brief anmerken werden“
und wenig später schreibt sie ihm: „Ich habe mein Bild fertig, und zeichne nun
fleißig nach Model Weiblich und Männlich, ich finde die Anatomie
bekommt mir wohl, und ich komme weiter, sogar Koch lobt mich, der nie mit mir
zufrieden war.“
Bei dem fertig gestellten Bild dürfte es sich mit großer Sicherheit um das
Gemälde „Die heilige Elisabeth mit dem Jesusknaben“ handeln, denn in einem Brief
der Künstlerin aus Rom an Karl Friedrich Freiherr von Uexküll vom 22. November
1812 schreibt sie, dass sie auf eine Pension aus Karlsruhe hoffe und weiter:
„meine Elisabetha schikte ich daher vor einem Monat nach“ Karlsruhe,
dort wurde das Gemälde laut einem Brief ihres Bruders vom 12. Januar 1813 dem
Hof übergeben.
Von den wenigen bekannten Gemälden,
welche die Künstlerin in Italien malte, ist in den vorhandenen Quellen kein
Hinweis zu finden, der belegen würde, dass die Künstlerin dort ein Gemälde
verkauft hätte. Vielmehr lebte sie nach eigener Auskunft von ihrem Vermögen, von
dem sie, wie sie dem Freiherrn Uexküll mitteilt, bereits 6000 Gulden „verzehrt“
habe.
Dieser Betrag von 6000 Gulden liegt deutlich über dem, was andere deutsche
Künstler in Italien zur Verfügung hatten. Von der Künstlerin Marie Ellenrieder,
die zehn Jahre nach Sophie Reinhard Rom besuchte und mit ihrer Freundin
Katharina von Predl in einer gemeinsamen Wohnung an der Piazza di Spagna lebten,
ist bekannt, dass sie für die Reise nach Italien und zurück etwa 500 Gulden
benötigte und dass sich der Lebensunterhalt in Rom auf etwa 800 Gulden pro Jahr
belief.
Mit Datum vom 20. September 1813
schreibt Sophie Reinhard an Albrecht Adam: „Ich wohne seit Jahr und Tag im Hause
einer jungen schönen Mailänderin nahmens Milesi dies Mädchen wiedmet sich mit
seltenem Eifer der Kunst, ist reich geachtet gut, und meine Freundin, ich gehe
zu ihr in die Kost, im Sommer machen wir kleine Reisen zusammen, kurz ich habe
würklich hierin viel Glück sie gefunden zu haben, und nie hätte ich gedacht daß
in Italien eine Freundin für mich zu finden wäre, ich fand sie.“
Bianca Milesi war zusammen mit ihrer Mutter im Oktober 1810 über Pistoria und
Florenz nach Rom gereist und hatte sich dort ein Atelier eingerichtet. Unter den
Künstlern, die sie in Rom kennen lernte, ist vor allen der Bildhauer Antonio
Canova zu nennen, der sie nach Kräften förderte und mit dem sie bald eine innige
und dauerhafte Freundschaft verband.

Portrait der Malerin und
Schriftstellerin Bianca Milesi.
Lithographie nach einer Zeichnung von Camilla Guiscardi
(Bildnachweis: E. Fecker)
Eine der oben erwähnten Reisen führte
Sophie Reinhard am 21. Juni 1812 zusammen mit Bianca Milesi,
mit Joseph Rebell
aus Wien und Jakob Wilhelm Huber nach Neapel. „Schon am zweiten Tage war die
Gesellschaft in Terracina, wo der Anblick des bewegten Meeres einen
unauslöschlichen Eindruck auf sie machte. Bis Gaëta nahmen die Wanderer zur
Bedeckung dreissig Mann Infanterie vom Regiment Isenburg mit, die damals in
Neapel in Dienst stand, eine Vorsichtsmassregel, die durchaus nöthig, da erst
kurz zuvor zwei Wagen mit Reisenden nicht weit von Terracina entfernt ausgeraubt
worden waren. In Mola di Gaëta wurde zu Mittag gegessen, in St. Agata am
Carigliano übernachtet. Am vierten Tage erreichte man, von der steten Furcht vor
den Räubern begleitet, über Capua fahrend, Neapel.“
„Am 6. Juli fuhren sie dann mit den
Damen zur Insel Ischia hinüber, wo Frl. Milesi die Bäder brauchen sollte, und
richteten sich für vier Wochen in Casamicciola häuslich ein, mit einem
General-Permiss versehen, nach der Natur zeichnen zu dürfen, so viel sie
wollten.“ „Anfangs August siedelten die Freunde von Casamicciola nach dem
Städtchen Ischia über, wo sie bis zur definitiven Rückkehr nach Neapel blieben.“
„In Neapel trennte sich die Gesellschaft; die Damen giengen sofort wieder nach
Rom, Rebell und Huber jedoch erst Mitte October“.
Sophie Reinhard schildert die Reise
nach Neapel in einem Brief vom 22. November 1812 an Freiherrn von Uexküll in
Stuttgart: „Sie wissen welchen Verlust ich erlitten habe, ach ich verlohr das
liebste das beste waß ich auf dieser Welt hatte, aus Verzweiflung entschloß ich
mich mit meiner Freundin Milesi nach Neapel und Ischia (wo sie die Bäder
braucht) zu reisen, in Neapel wurde ich in den ersten Tagen ernstlich krank,
litt viel, und ging noch krank nach Ischia, wo ich 2 Monate mit meinem Schmerz
ohne allen Genuß lebte, keine Briefe konnte ich erhalten bis ich endlich nach
Neapel ging mich dort an die Gesandschaft wandte, und mit Mühe von sechs Briefen
die dort für mich anlangt waren 3 erhielt, unter diesen 3 Briefen war einer
meines Bruders der mir erklärte ich solle bis künftiges Frühjahr in Rom bleiben,
da mein guter Vatter vor seinem Todte mich seegnend den Wunsch geäußert habe, er
wolle nicht daß sein Todt meine Abreise beschleunige, ich kehrte also nach 3
Monat Abwesenheit nach Rom, wo ich mein Quartier durch Zoll besezt fand, zog
daher zur Schwiege von Koch, die nach wenige Tagen die paravecosa bekam, sich
zum Erstaunen aller, wieder erholte, doch bald wieder am nehmlichen Übel zum
zweitenmal darnieder lag, sich zwar auch wieder zimlich erholte, inzwischen
hatte ich satt, an zweimonatlicher Hunde Zeit die ich so verlebte, ohne
Bedienung, in beständigem Ekel, ich zog daher ehegestern von quatro fontane nach
S. Vitale, neben cavallier de Rossi, in das nehmliche Haus meiner Freundin
Milesi, wo ich zwar zimlich entfernt von allen Deutschen, aber bey meiner lieben
edlen Freundin lebe, die sich mit 22 Jahren, mit seltenem Eifer der Kunst
wiedmet, bey der ich Kost und Bedienung habe, allein für zimlich wenig Geld – in
Neapel, gefiel mir’s nicht, – und hier haben Sie en gros meine qualvolle lezte 6
Monat!“
Sophie Reinhard hatte vor der Reise
nach Neapel ihre Wohnung auf dem Monte Pincio aufgegeben und da diese nach ihrer
Rückkehr weitervermietet war, fand sie für kurze Zeit eine Bleibe bei der
Schwiegermutter von Anton Koch in der Via delle Quattro Fontane, bis sie am 20.
November 1812 bei ihrer Freundin Bianca Milesi einzog, die nahe der Kirche San
Vitale in der Nachbarschaft des befreundeten Dichters Giovanni Gherando de Rossi
wohnte.
Auf Bianca Milesi scheint Sophie
Reinhard einen nachhaltigen Einfluss gehabt zu haben, denn aus der jungen Dame
mit den Gewohnheiten einer bedeutenden Mailänder Familie wurde eine ernsthafte
Künstlerin, was sie einzig Sophie Reinhard zu verdanken hatte. Laut dem ersten
Biographen von Bianca Milesi soll ihr Sophie Reinhard ihre eigenen
Lebensgrundsätze nahegelegt haben, indem sie ihr sagte: „Il faut choisir entre
le monde et la peinture, entre le rôle d’idole à éventail et celui d’artiste
laborieuse. Si vous
voulez arriver à un résultat, commencez par renoncer aux sucreries
sociales; acceptez qu’on vous traite comme honnête créature qui ne s’occupe que
de la forme et de la couleur; recherchez les critiques plutôt que les hommages,
et ne vous rappelez jamais que vous êtes une illustrissima et gentilissima
signora.“
Sophie Reinhard wird dort als eine jener Frauen mit männlichen Wesenszügen
geschildert, welche ihren Weg im Leben machen,
ohne sich um Hindernisse oder Einwände zu kümmern.
„Im Sommer 1813, am 26. Juni, machte
Huber mit Sophie Reinhard und der Milesi einen Abstecher nach Orvieto, wo nächst
der herrlichen Natur die grossartigen Fresken des Luca Signorelli im Dome
Maitani’s
und der goldene Wein die Künstler anzog. Der Umstand, dass unter den
Mitreisenden sich Peter Cornelius befand, sollte dem Aufenthalt in der alten
Etruskerstadt einen erhöhten Reiz verleihen.“
Durch Bianca Milesi wurde Cornelius bei der Familie Gualtieri eingeführt, die
ihn bei dieser Gelegenheit bat, ein Wandgemälde von Pietro Perugino in der
Kapelle der Familie Gualtieri im Dom zu restaurieren. In Dom ließen Bianca
Milesi und Sophie Reinhard auf eigene Kosten, ein Gerüst unter die Kuppel bauen,
um die Gemälde von Luca Signorelli und Cortona besser kopieren zu können.
Aus den Zeichnungen im Italienischen
Skizzenbuch von Sophie Reinhard lässt sich ferner schließen, dass die
Künstlerinnen auch die nördlich von Orvieto gelegene Ortschaft Città della Pieve
besuchten, in der sich das Elternhaus von Pietro Perugino befindet und wo sie
die dort erhaltenen Fresken Peruginos studiert haben.
„Bevor die Künstler nach Rom
zurückkehrten, gingen sie noch nach Bolsena, um dort dem Fest der Schutzpatronin
des Städtchens beizuwohnen. Es wird am 12. August gefeiert, durch lebende Bilder
auf öffentlichem Platze, von Musik und Böllerschüssen begleitet, durch
Stiergefechte, Ballspiele, Tanz und andere Ergötzlichkeiten.“
Besonders eindrucksvoll waren das
lebende Bild vom Martyrium der Schutzpatronin Bolsenas, der Heiligen Christina,
bei dem die Darstellerin, welche die Rolle der Christina spielte, vor ihren
Henkern kniete und aus ihrem Mund die Zunge herausgerissen wurde. Es wird
erzählt, dass es sich dabei um eine Schafszunge gehandelt habe, die, um den Ekel
zu vermeiden, vorher abgekocht worden war.
„Bis spät in die Nacht hinein dauerte
die Feier; erst nach zwei Uhr kamen die Gäste wieder in Orvieto an. Nun rüsteten
sie sich zum Abschied, der am 29. August stattfand und ihnen nicht gerade leicht
geworden zu sein scheint. Am Fusse des Montefiascone nahm man mit dem Marchese
Gualtieri in einer kleinen Osteria noch ein gemeinsames Mahl ein, bei dem der
herrliche Muscatwein, der sogenannte Est-Est-Est nicht fehlen durfte, und dann
giengs frohen Muthes der Siebenhügelstadt zu.“
Friedrich Müller schreibt 1813 in
einem Brief aus Rom an den Oberhofprediger und Vertrauten der Königin Caroline
von Bayern Dr. Ludwig Friedrich von Schmidt in München: „Gerne würde ich Eure
Hochwohlgebohren, mit Nachrichten von verschiedenen interreßanten Arbeiten
meiner verehrten Freundin der Fräulein Sophia unterhalten wenn mein Gemüth
gegenwärtig nicht für solches unternehmen zu befangen wäre, ich verspahre aber
dis mir auf heitere augenblicke, welche ich mir bald durch Hoch dero gütiges
vielvermögendes Beywürcken verspreche, nur füge ich dis einzige hier bey, daß
Fräulein Sophie starcke Fortschritte in der Kunst gethan und daß mann den
Aufenthalt von Italien, in ihren Arbeiten durch die Studien welche sie im
Vatican nach Raphael und in Orvieto nach Signorelli und Pietro Perugino gemacht,
deutlich gewahr werde.“
Dies verdeutlicht ein um 1812 entstandenes Portrait einer jungen Künstlerin,
welche in
das Gewand der Madonnen Peruginos und Raphaels gekleidet und, wie Dürer im
Selbstbildnis von 1500, die Haare in einzelne lange Locken aufgelöst,
dargestellt ist.
Dieses monogrammierte Gemälde, welches sich heute im Besitz der Staatlichen
Kunsthalle Karlsruhe befindet, wird in der Tradition der Vorbesitzer als Bildnis
einer jungen Römerin bezeichnet. Im Bericht über den Erwerb durch die Staatliche
Kunsthalle Karlsruhe wird das Gemälde als „Junge Römerin (Selbstbildnis?)“
betitelt.
Zeitlich wäre es dann durch einen Brief von Friedrich Müller einzuordnen, der am
24. Februar 1813 aus Rom an Karl Friedrich Freiherr von Uexküll schreibt: „Mad.
Reinhard … hat … jüngsthinn ein braves Portrait von sich selbst gemahlt.“
Im Katalog der Ausstellung „Zwischen
Ideal und Wirklichkeit“ spricht Bärbel Kovalevski dann von einem „als »Junge
Römerin« bezeichneten Selbstbildnis“, womit sich die Ansicht, es handle sich um
ein Selbstbildnis der Künstlerin, verfestigte.
Zehn Jahre später hat sich Katrin Seibert mit diesem bedeutenden Portrait
eingehend beschäftigt und kommt nach einem Vergleich mit Portraits von Sophie
Reinhard zu dem Schluss, dass es sich wohl kaum um ein Selbstportrait Sophie
Reinhards handeln könne. „Nachdem das vermeintliche Selbstbildnis keine
Übereinstimmungen mit den anderen Portraits der Künstlerin aufweist, … und die
hier Dargestellte mit ihrem wallenden Haar kaum eine Frau von 35 bis 40 Jahren
sein kann, gilt es zu fragen, wer sich dahinter verbirgt? Die Dargestellte
aufgrund der Tatsache, daß sie in der Linken einen Silberstift als Malerattribut
hält, für Sophie Reinhard zu halten, ist problematisch.“
Um den Mund der Dargestellten schwebt auch kein „gewisser ironischer Zug“, den
das geschulte Auge des Malers Albrecht Adam an Sophie Reinhard beobachtet hat.

Junge Römerin (Selbstbildnis?).
Ölgemälde von Sophie Reinhard, um
1812
© Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, Inv.-Nr. 2645
Katrin Seibert stellt sich die Frage,
welche andere Künstlerin die Dargestellte sein könnte und legt Beweise vor, dass
es sich um Sophie Reinhards italienische Freundin Bianca Milesi handeln müsse.
Von ihr hat Sophie Reinhard in ihrem Skizzenbuch eine um 1813 entstandene
Zeichnung angefertigt und „obwohl ihr Gesicht im Vollprofil gezeichnet ist, ist
die große Ähnlichkeit zum Bildnis der jungen Römerin deutlich zu erkennen.“
Bianca Milesi war damals 23 Jahre alt, was zum Alter der „Jungen Römerin“
ausgezeichnet passt. Ein Vergleich der „Jungen Römerin“ mit dem Portrait von
Bianca Milesi, welches Camilla Guiscardi als Halbfigur gezeichnet hat,
räumt die letzten Zweifel aus, dass die Dargestellte Bianca Milesi ist.
Durch Sophie Reinhards Bekanntschaft
mit zahlreichen Künstlern, die sich damals in Rom aufhielten, war ihr eine
ständige wohlwollende Kritik zuteil, die ihr Fortkommen natürlich ebenfalls
förderte. Dazu zählten neben Koch insbesondere die Künstler Catel, Cornelius,
Overbeck und Zoll, gelegentlich auch Eberhard, Leipold, Madrazo, Reinhart,
Rohden und Steinkopf. Mit Anton Koch verband sie mehr als eine Freundschaft auf
künstlerischer Ebene. Sie hat sich mehrfach für ihn bei Uexküll verwendet, er
möge doch dem damals ständig in Geldnot befindlichen Künstler ein Gemälde
abkaufen und seiner Tochter Elena war sie zusammen mit Uexküll Taufpatin.
Das Spätjahr 1813 war von den
Ereignissen der Weltgeschichte überschattet. Die Völkerschlacht bei Leipzig vom
16. bis 19. Oktober 1813 leitete mit dem Sieg der Alliierten über Frankreichs
Armee die Befreiung aus dem Joch Napoleons über Europa ein. Dieser Sieg wirkte
sich auch auf die Situation in Rom aus, wo seit 1809 die weltliche Herrschaft
des Papstes durch Napoleon aufgehoben worden war. Mit dem Sieg über Napoleon
fürchtete der Gouverneur von Rom General de Miollis um seine Stellung und suchte
durch die repressiven Mittel eines Polizeistaates jeglichen Widerstand im Keime
zu ersticken. Erst als der König von Neapel Joachim Murat sich von Napoleon
distanzierte, änderte sich auch für Rom die Situation und Papst Pius VII. – seit
1812 in Frankreich interniert – konnte am 3. Juni 1814 wieder in Rom Einzug
halten und der Kirchenstaat wurde wieder hergestellt.
Im Dezember 1813 war Sophie Reinhard
zusammen mit Bianca Milesi nochmals umgezogen. In einem Brief an Freiherr von
Uexküll vom 20. Juni 1814 schreibt sie: „Ich wohne nun seit 7 Monat, im Pallast
des Cardinal Albani, neben Müller, der Bruder meiner Freundin wohnt auch bey
uns, dadurch hat das stille Künstlerleben eine andere Wendung genommen, wir
haben Kutschen und Pferde, X X. ich freue mich aber über diese Veränderung gar
nicht, und gedenke des stillen kleinen Häußchens alle monti! wo mehr gearbeitet
wurde, mit Wehmuth!“
In dem mondänen Palazzo Albani in der Via delle Quattro Fontane, in dem auch
Winckelmann von 1760 bis 1768 gewohnt hatte,
scheint sich die Künstlerin nicht wohl gefühlt zu haben.
Aus einem Brief von Friedrich
Overbeck vom 16. Februar 1814 adressiert an Bianca Milesi in Florenz geht
hervor, dass Bianca Milesi zu diesem Zeitpunkt nicht in Rom gewesen zu sein
scheint.
Overbeck bittet sie, seinem Freund Giovanni Colombo
18 Scudi zu bezahlen, die sie von Sophie Reinhard wieder bekommen werde, was
diese ihm brieflich versichert habe. Dies ist ein weiterer Hinweis, dass Sophie
Reinhard sich immer wieder um das Wohl ihrer Malerkollegen gekümmert hat.
Sophie Reinhard reiste am 26. Juni
1814 von Rom ab, um nach Karlsruhe zurückzukehren.
Diese Abreise dürfte ziemlich überhastet stattgefunden zu haben, denn nur wenige
Tage zuvor am 20. Juni hatte sie noch an Uexküll geschrieben, dass sie bald nach
Castel Gandolfo reisen wolle, wo sich schon seit 14 Tagen Bianca Milesi
aufhalte.
An ihrer Stelle vermietete Bianca Milesi Jakob Wilhelm Huber zwei Zimmer in ihrem
in Castel Gandolfo gemietetem Landhaus und übertrug ihm die künstlerische
Ausbildung ihres Bruders Carlo. Aus der Autobiographie Hubers ist außerdem zu
entnehmen, dass die Künstlerin ihm auch finanziell unter die Arme griff.
Bianca Milesi scheint in diesen Jahren vornehmlich Portraits bedeutender
Zeitgenossen gemalt zu haben.
Ihre
schriftstellerische Tätigkeit begann Bianca Milesi 1813 mit einer Biographie der
italienischen Mathematikerin Maria Gaetana Agnesi
und zurückgekehrt nach Mailand im Jahre 1815 mit einer Beschreibung des Lebens
der bedeutenden griechischen Lyrikerin Sappho.

Portrait des Chirurgen
Giambatista Monteggia (1762-1815).
Kupferstich von Ernesta Bisi Legnani
nach einem Gemälde von Bianca Milesi (um 1816).
Bezeichnet: Bianca Milesi
dip = Ernesta Bisi Legnani dis. et inc.
darunter: G. B. MONTEGGIA DA LAVENO
Professore in Chirurgia
(Bildnachweis: E. Fecker)
Ihre
pädagogischen Schriften, für die sie über Italien hinaus bekannt geworden ist,
beginnt sie erst zu verfassen, nachdem sie 1825 Mutter eines Sohnes geworden war
und einen Mangel an Büchern über die schulische Bildung von Kindern und
Jugendlichen festgestellt hatte. Ihre Bekanntschaft mit der englischen
Schriftstellerin Mary Edgeworth ließ sie zu einer großen Verehrerin ihrer
pädagogischen Ideen werden und übersetzte deren Werke ins italienische. Sie hat
aber auch selbst Bücher für den Unterricht von Kleinkindern
und zum Unterricht in Naturkunde verfasst.

Portrait des Dichters Gian Carlo
Di Negro (1769-1857).
Kupferstich von Giuseppe Longhi nach
einem Gemälde von Bianca Milesi.
Bezeichnet: Bianca Milesi dip. Ge.
Longhi inc. 1822.
darunter: G. C. DI NEGRO. Patrizio
Genovese.
(Bildnachweis: E. Fecker)
Großherzoglich Badische Hofmalerin
Noch während des Aufenthaltes in Rom
hatten zunächst der Vater von Sophie Reinhard und nach dessen Tod am 16. Mai
1812 ihr Bruder Wilhelm Reinhard beim Großherzog Karl Ludwig die Bitte
vorgetragen, ihr aus Haushaltsmitteln des Staates ein Gehalt zu gewähren, wie es
dem kürzlich verstorbenen Hofmaler Schroeder zuteil geworden sei. Mit Schreiben
vom 15. Januar 1813 teilt das Geheime Kabinett dem Bruder mit, dass der
Großherzog ein Gehalt von 800 Gulden genehmigt habe, verbunden mit der
Verpflichtung, „daß sie von Zeit zu Zeit eine Arbeit einzuliefern oder auch, auf
deßfalls anderweit erhaltende Weisung, Unterricht im Zeichnen zu ertheilen
gehalten seyn solle.“
Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass bei der Ernennung zur
Hofmalerin, verbunden mit dem großzügigen Gehalt von 800 Gulden,
die bayerische Königin Caroline, als geborene Prinzessin von Baden, ihre
familiären Beziehungen zum Großherzoglichen Hof geltend gemacht hat. Denn im
Jahre 1812 war der Staatshaushalt durch die Ausrüstung und Verpflegung der
badischen Truppen, die am Russlandfeldzug Napoleons teilnehmen mussten,
besonders in Anspruch genommen, weshalb unter solchen Bedingungen üppige
Pensionen für Künstler normalerweise nicht zu erwarten waren. Sophie Reinhard
waren durch die Bestellung zur Hofmalerin die damit verbundenen Rechte und
Pflichten übertragen worden, den Titel Hofmalerin erhielt sie mithin aber nicht.
Im Handbuch für Baden und seine Diener ist sie demnach unter der Rubrik Hofmaler
aufgeführt. Hinter ihrem Namen steht im Gegensatz zu Marie Ellenrieder nicht der
Titel Hofmalerin.
Als eine unterstützende Maßnahme zur
Erlangung einer „Pension“ kann ferner die Überreichung eines Gemäldes an den
Badischen Hof gewertet werden. Sophie Reinhard ließ durch ihren Bruder eine
„Heilige Elisabeth“ überbringen, die sie im Verlaufe des Jahres 1812 in Rom
gemalt und von dort aus nach Karlsruhe geschickt hatte.
Sophie Reinhards Entschluss Mitte
1814 nach Karlsruhe zurückzureisen, hing wohl mit dem Umstand zusammen, dass
ihre Jugendliebe Wenzel Freiherr von Kapaun
in der Nähe von Karlsruhe stationiert wurde. Er gehörte den österreichischen
Truppen an, die zusammen mit den Alliierten nach der Völkerschlacht von Leipzig
die französischen Truppen auf die westliche Rheinseite drängten. Im Zuge dieser
Kriegshandlungen wurde Oberstleutnant Kapaun in die Nähe von Karlsruhe verlegt.
Sophie Reinhard berichtet Albrecht Adam: „vor 16 Jahren musste ich dem Wunsche
entsagen ihn zu besitzen, weil er Leutnant, und ohne Vermögen war, seit dem
hörte ich oft durch die 3te Hand er habe den Schwur, den er mir
schriftlich gab, mich oder keine zu heirathen nicht gebrochen, und hänge noch
immer liebend an mir, nun kommt er zu meiner Mutter alle paar Tage, da er nur 2
Stund von C. R. im Quartier liegt, spricht nur von mir, sucht das Zimmer auf wo
mein Portrait hängt ist nicht da wegzubringen, und hat sogar die gemahlten Hände
schon verküßet, meiner Mutter erklärt daß er nie heirathen werde, wenn er nicht
noch so glücklich sey, mich zu besitzen, nun als Oberstleutnant könne er mir ein
besseres Glück mit seiner Hand anbiethen, haben Sie eine solche Treue schon
erlebt? ach Adam ich habe niemand mit dem ich hierüber sprechen könnte, aber die
ganze Jugendliche Liebe lebt wieder in meinem alten Herzen auf! ich konnte nicht
wiederstehn ihm sogleich zu schreiben, daß es mich herzlich freut sichere
Nachricht seines Wohlergehens zu haben, und zu wissen daß ich noch in seinem
Andenken lebe, daß ich gewünscht hätte sein Schiksal hätte ihn in meine Nähe
geführt, damit der innige Wunsch ihn in diesem Leben noch einmahl zu sehn
erfüllt wäre.“
Da sie nach ihrer Rückkehr nach
Karlsruhe entschlossen war, Kapaun zu heiraten, ersuchte sie den Großherzog um
Heiratserlaubnis, welche ihr mit Schreiben des Großherzoglichen Geheimen
Kabinetts
vom 22. Juli 1815 erteilt wurde: „Seine königliche Hoheit haben der Mahlerin
Dlle. Sophie Reinhard von hier die Erlaubniß zur Verehelichung mit dem KK.
Oesterreichischen Oberst-Lieutenant von Kappaun, im Chevauxlegers-Regiment von
Vincent, unter unabgekürzter Belassung ihres jährlichen Gehalts von Achthundert
Gulden, auch im Ausland, jedoch mit der ihr p And No. 67 den 15 Jenner 1813.
auferlegten Verbindlichkeit, daß sie von Zeit zu Zeit eine Arbeit einzuliefern
habe, zu ertheilen geruhet.“ Die Ehe kam allerdings nicht zustande.
Wenzel von Kapaun scheint es mit dem
im Jahre 1798 schriftlich gegebenen Schwur Sophie Reinhard oder keine zu
heiraten, nicht so ganz genau genommen zu haben, denn er hatte 1803 Maria
Josepha Cleopha Gräfin von Engl zu Wagrain geheiratet. Diese Ehe blieb aber
kinderlos.
Ob dieses gebrochene Eheversprechen, der Grund dafür war, dass die Ehe mit der
Künstlerin nicht zustande kam, war nicht festzustellen. Kapaun starb im Juni
1816.
Sophie Reinhard wohnte nach ihrer
Rückkehr aus Italien zunächst in Karlsruhe.
Die überstürzte Heimreise und das Scheitern der geplanten Heirat mit Wenzel von
Kapaun, scheint ihr äußerst peinlich gewesen zu sein, denn am 4. Mai 1815
berichtete sie dem Freiherrn von Uexküll, dass sie jegliche Besuche meide, weil
sie den boshaften Spott nicht leiden könne. Nur mit Weinbrenner und Haldenwang
pflegte sie sich noch über künstlerische Dinge zu unterhalten. Vielleicht hat
diese Peinlichkeit dazu geführt, dass Sophie Reinhard nach Heidelberg umzog,
denn mit Schreiben vom 28. Oktober 1816 lässt sie dem Großherzog Karl Ludwig
durch ihren Bruder Wilhelm als Pflichtbild ein Gemälde überbringen, welches den
Traum des Markgrafen Karl Wilhelm von der Stadtgründung Karlsruhes bildlich
darstellt.
Im Spätjahr 1817 unternahm Bianca
Milesi eine Reise durch die Schweiz. Sie besuchte Basel, Zürich, Konstanz, St.
Gallen und Stuttgart, um sich in Heidelberg mit ihrer Freundin Sophie Reinhard
zu treffen.
Gemeinsam reisten die beiden nach Karlsruhe, wo Bianca Milesi von der Familie
Reinhard herzlich empfangen wurde. In Karlsruhe schenkte sie besonders dem Haus
von Sophies Bruder Wilhelm besondere Aufmerksamkeit und vermerkte in ihrem
Reisetagebuch: „La
maison de M. Guillaume Reinhard est le logis le mieux distribué que j’aie jamais
vu; je prends là de bonnes notes pour arranger le cabinet de ma mère lorsque
nous serons de retour à Milan.“
Die Prinzessin Amalie Christiane von
Baden, die Zwillingsschwester der Caroline von Baden, Königin von Bayern, bot
ihr Empfehlungsschreiben für eine Reise an, welche Bianca Milesi zusammen mit
Sophie Reinhard in das Österreichische Kaiserreich und nach Sachsen führen
sollte, zu der die beiden Ende des Jahres 1817 aufbrachen. Sie besuchten Wien
und in ihrem Tagebuch vermerkt Bianca Milesi, dass sie am 16. Januar 1818 die
zugefrorene Donau im Pferdeschlitten überquerten. Ihre Reise führte Donau
abwärts durch das damalige Ungarn nach Comorn, dem heutigen Komárno in der
Slowakei und nach Budapest. Dort statteten die beiden Künstlerinnen der Baronin
Johanna von Vay geb. Adelsheim, einer guten Freundin von Sophie Reinhard, einen
längeren Besuch ab. Die Baronin, welche ihren Vater, der Oberforstmeister in
Kandern war, und ihre Mutter im Kindesalter verloren hatte, verbrachte nach dem
Tode des Vaters das Frühjahr 1785 bei der Familie Reinhard in Lörrach, bis sie
von der Familie des Regierungsrats Karl Wilhelm Friedrich Freiherr von Drais
(1755-1830) in Pflege genommen wurde und dann in Karlsruhe aufwuchs.
Aus den gemeinsam verbrachten Kinderjahren entwickelte sich eine lebenslange
Freundschaft zwischen Johanna und Sophie. In einem Brief aus Pest vom 25. Januar
1818 an Amalie von Drais, einer Tochter des genannten Freiherrn, schreibt die
Baronin über den Besuch: „Doppelt wohl that mir unter diesen Verhältnissen der
Besuch meines Bruders und später der der guten Sophie Reinhardt und ihrer
wirklich liebenswürdigen Begleiterin; Louis verließ mich wieder im Dezember,
letztere sind aber noch hier und bleiben hoffentlich noch einige Monate; für
ihre Kunst finden sie freilich in Pest wenig Nahrung, Bianka treibt sich aber in
der großen Welt herum und erntet Beifall, wo sie bekannt wird, Sophie malt den
ganzen Tag über und die Abende verstreichen uns unter traulichen Gesprächen vom
Vaterland und von unserer Jugend. Die Wege, die die Vorsehung uns führte, waren
sehr verschieden, und darum sind auch unsere Ansichten nicht immer gleich, aber
nur meistens das Konventionelle trennt uns; über das, was den wahren Werth des
Daseins ausmacht und sich noch über seine Dauer hinaus erstreckt, sind wir
völlig einig.“
Wann genau die beiden Künstlerinnen
ihre Reise fortgesetzt haben, ist nicht überliefert. Es ist aber naheliegend,
dass sie zum Ende des Winters im April 1818 aufgebrochen sind. Den Reisenotizen
von Bianca Milesi ist zu entnehmen, dass sie sich auf den Weg nach Dresden
gemacht haben. Diese Reiseroute verlief normalerweise über Prag und weiter durch
das Erzgebirge nach Norden. In Dresden besuchten sie den Pädagogen und
Schriftsteller Carl August Böttiger und das Denkmal von Jean-Victor Moreau, der
dort als General auf Seiten der Alliierten schwer verwundet wurde und am 2.
September 1813 gestorben war. Bei Bianca Milesi scheint dieser Besuch einen
tiefen Eindruck hinterlassen zu haben.
Da eine Nachricht von Bianca Milesi
an Carl August Böttiger vom 3. Mai 1818, die sie in Dresden geschrieben hat,
über ihre bevorstehende Weiterreise erhalten ist, wissen wir sicher, dass sich
die beiden Freundinnen am 4. Mai 1818 auf den Weg machten, um in Jena Johann
Wolfgang von Goethe zu besuchen.
Da sie aber nur mit einer zweispännigen Kutsche unterwegs waren, konnten sie
nicht den direkten Weg über Leipzig nach Jena wählen, sondern sie fuhren
zunächst nach Weimar, um von dort aus weiter nach Jena zu gelangen. Für den
direkten Weg wäre wegen der steilen Anstiege eine vierspännige Kutsche
erforderlich gewesen.
In Weimar war ein Besuch bei der
Gräfin von Edling vorgesehen, der aber nicht zustande kam, weil die als
Philanthropin bekannte Gräfin verreist war und auch ein
weiterer dort geplanter Besuch bei dem Verleger und
Schriftsteller Friedrich Johann Justin Bertuch fand nicht statt, weil dieser
ebenfalls verreist war.
Ein undatiertes Billet von Karl
Ludwig von Knebel an Goethe weist darauf hin, dass Major Knebel, der in Jena
wohnte, den Besuch bei Goethe anbahnen sollte, denn er schreibt: „Du wirst es
mir wohl nicht für ungut nehmen, wenn ich Dir diesen Nachmittag eine schöne
liebenswürdige Italienerin zuschicken werde? Sie ist aus Mailand und kommt
hieher Dich zu sehen. Diesen Abend reist sie wieder ab. Ihr Name ist Biancha,
noch Fräulein und Malerin. Ihre Begleiterin ist Mslle. Reinhard aus Carlsruh,
seit ein paar Jahren in Heidelberg, gleichfalls Malerin. Roux wird sie Dir
bringen. Nun bitten sie nur, daß Du ihnen die Stunde bestimmen möchtest. –
Vielleicht magst Du sie mit Deinem Wagen an die Teufelsdächer bringen lassen,
die sie gerne sehen möchten. Es sind gute Geschöpfe, und sie haben die Welt
gesehen. Ich würde sie selbst begleiten, wenn ich nicht zu matt wäre.“
Bianca Milesi berichtet später ihrem
Dresdner Bekannten Carl August Böttiger über den Besuch in Jena: „Dort war der
Major Knebel sehr gefällig; aber Göthe, wegen die schlechten umstände seiner
Gesundheit, war … nicht sichtbar.“
Von Jena, über Weimar und Erfurt
gelangten die beiden Künstlerinnen nach Gotha, wo sie vom Hofrat Madelung
zum Herzog August von Sachsen-Gotha und Altenburg geführt wurden, der sie mit
großer Freundlichkeit empfing und sie zum Diner einlud. Bei dieser Gelegenheit
kam der Herzog auf einen von ihm verfassten Gedichtband zu sprechen und
überreichte den beiden Damen ein Exemplar.
Auf der Weiterreise nach Eisenach
besuchten sie die Wartburg
und machten sich Anfang Juli auf den Rückweg nach Karlsruhe. Auffällig ist, dass
Bianca Milesi in ihren Tagebucheintragungen über die gemeinsame Reise mit Sophie
Reinhard an keiner Stelle über Kunst spricht.
Offensichtlich waren inzwischen politische und soziale Fragen mehr in den
Blickpunkt ihres Interesses gerückt. Ungewöhnlich ist ferner, dass sie die Reise
mitten im Winter antraten, wo Eis und Schnee das Fortkommen mit der Kutsche
rasch unmöglich machen konnte. Die Wetterereignisse des Jahres 1816 hätten sie
warnen können. Das Jahr hatte außergewöhnlich kalt begonnen und das Frühjahr und
der Sommer waren so niederschlagsreich, dass sich durch Ernteausfall eine
Hungersnot im südlichen Teil Mitteleuropas entwickelte.
Denkbar ist, dass der Zeitpunkt der
Reise mit dem Scheitern der Ehe von Bianca Milesi mit dem Maler Hendrik Voogd
zusammenhing und dass sie den Trost ihrer Freundin suchte und brauchte, ohne
über die ungünstige Jahreszeit ihrer Reise von Mailand nach Heidelberg
nachzudenken.
Bianca Milesi verabschiedete sich in
Karlsruhe von ihrer Freundin und reiste nach einem Aufenthalt in Baden-Baden
im Juli 1818 nach Mailand zurück, wo sie Anfang August eintreffen wollte.
Bianca Milesi blieb noch über Jahre hinweg mit Sophie Reinhard freundschaftlich
verbunden. Am 28. März 1827 schreibt diese an Albrecht Adam: „Die Bianca Milesi
ist in Genua glücklich geheirathet seit 2 Jahr, und Mutter eines Sohns. Vor 2 ½
Jahr war sie auch bey mir hier, und zwar 4 Wochen, nebst ihrer Mutter.“
Mit ihrem Ehemann, dem Arzt Benedetto Mojon, zog Bianca Milesi im Mai 1833 nach
Paris, wo sie am 8. Juni 1849 an Cholera verstarb.
Im Frühjahr 1818 wurde in Karlsruhe
von 48 Gründungsmitgliedern – darunter Johann Peter Hebel und andere
hochgestellte, kunstbegeisterte Personen sowie Karlsruher Künstler – ein
Kunstverein ins Leben gerufen, der bereits vom 12. bis zum 19. April 1818 eine
Kunstausstellung im „Museum“ veranstaltete.
Sophie Reinhard gehörte nicht zum Kreis der Gründungsmitglieder. Von ihr wurden
bei dieser Ausstellung zwei Gemälde aus der Großherzoglichen Galerie gezeigt,
die sie dem Großherzog geschenkt
bzw. als Pflichtbild dort eingeliefert hatte. Den im handschriftlichen Katalog
der Ausstellung aufgeführten Gemälden „Der Tod der heiligen Catharina“ und
„Elisabeth und Johannes als Kind“ ist jeweils der Vermerk beigefügt „gehört in
die Großh.
Gallerie“.
Das Gemälde „Tod der
Katharina von Siena“ ging im
2. Weltkrieg verloren, das
Gemälde „Die heilige Elisabeth mit dem Johannesknaben” ist noch heute im Besitz
der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe.
Das Gemälde entstand 1812
während des Romaufenthaltes der Künstlerin. In einem Brief von Sophie Reinhard
aus Rom an Karl Friedrich Freiherr von Uexküll vom 22. November 1812 schreibt
sie, dass sie auf eine Pension aus Karlsruhe hoffe und weiter schreibt sie
„meine Elisabetha schikte ich daher vor einem Monat nach“ Karlsruhe,
dort wurde das Gemälde laut einem Brief ihres Bruders vom 12. Januar 1813 dem
Großherzoglich Badischen Hof übergeben.

Die heilige Elisabeth mit dem
Johannesknaben.
Ölgemälde von Sophie Reinhard, 1812
© Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, Inv.-Nr. 508
Das Gemälde zeigt die heilige
Elisabeth, wie sie ihren Sohn Johannes unterrichtet. Sie sitzen in einer
südlichen Landschaft im Vordergrund des Bildes auf einer Wiese. Elisabeth ist im
Profil dargestellt und Johannes der Täufer halb zum Beschauer gewandt, bekleidet
mit einem Fellüberwurf, hält in den Armen einen Kreuzstab samt Kreuzfahne, auf
der „Agnus Dei“ zu lesen ist. Katrin Seibert, die sich ausführlich mit der
Symbolik der Bekleidung, der aufgeschlagenen Bibel auf dem Schoß der heiligen
Elisabeth, den Attributen des Johannes und dem Früchtestillleben zu seinen Füßen
beschäftigt, zählt dieses Gemälde zu den bedeutendsten, welche Sophie Reinhard
gemalt hat.
Auf der Karlsruher Ausstellung von
1818 waren neben Sophie Reinhard auch Carl Kuntz (Vater)
und Rudolf Kuntz (Sohn)
mit mehreren Gemälden vertreten. Von Franz Joseph Zoll,
dem Sophie Reinhard 1814 bei seiner Heimreise aus Rom behilflich war, wurde das
Gemälde „Hercules und Hebe“ aus dem Besitz des Großherzogs gezeigt.
Auf Franz Joseph Zoll war Sophie
Reinhard nicht gut zu sprechen, was aus ihrem Brief aus Rom vom 5. Januar 1814
an Albrecht Adam in Mailand hervorgeht, in dem sie schreibt: „verzeihn Sie daß
ich Ihnen schon wieder durch eine Empfehlung plagte, aber ich konnte nicht
anderst handeln, wenn ich dem festen Vorhaben nachleben will die Tugenden meines
Vatters womöglich nachzuahmen, so mußte ich Z. mehr behülflich seyn als ich dem
liebsten Freunde hätte seyn können, denn – er ist mehr mein Feind als
Freund, denn die man liebt gefällig zu seyn ist kein Verdienst, aber denen die
uns hassen böses mit gutem zu vergelten, darin liegt ein hohes Gefühl, ich that
das lieber Adam mit Z. der immer mich hier drükte wo er konnte, und vornehmlich
wegen meiner Pension Neid und Haß gegen mich trägt, er ist ein roher
verstellerischer Mensch der überhaupt viel wiederliches für mich hat, inzwischen
trug ich 2 Jahre alles gedultig, und mit Hülfe Ihrer Gefälligkeit konnte ich
meinen immer dienstfertigen Betragen gegen ihn, noch die Krone aufsetzen; Genug
sagen Sie wie Ihnen der Hr. gefiel? und wie er von mir sprach? mit Ihnen gewiß
als wäre ich ihm sehr lieb? übrigens lassen Sie sich dadurch nicht mißtrauisch
machen, und erweißen Sie allen die ich Ihnen empfehle Gefälligkeit doch merken
Sie sich wohl, daß es dann hauptsächlich gilt wenn ich schreibe, ich werde
alles waß Sie meinem Freunde thun ansehn als hätten Sie es mir selbst gethan.“
Diese außergewöhnlich selbstlose Verhaltensweise der Künstlerin spiegelt
vollkommen die Erziehung durch ihren evangelisch-reformierten Vater wider, den
sie offensichtlich, auch über seinen Tod hinaus, sehr verehrte.
Sophie Reinhard zog spätestens 1818
wieder von Heidelberg nach Karlsruhe zurück. Wo sie zunächst gewohnt hat, ist
nicht zu belegen.
In dieser Zeit beschäftigte sich die Künstlerin mit der Anfertigung einer Serie
von Radierungen nach Hebels Alemannischen Gedichten. Die zehn Blätter erschienen
1820 als Mappenwerk bei Mohr und Winter in Heidelberg. In einem Geleitwort lobt
der Dichter die Künstlerin für ihre getreue Nachbildung der Markgräfler Trachten
und die erkennbare Eigentümlichkeit des dortigen Völkleins. Die Radierungen der
einzelnen dargestellten Gedichte sind mit Untertiteln aus der ersten Ausgabe der
Gedichte von 1803 versehen. In Schorns Kunstblatt von 1820 erscheint eine
ausführliche und lobende Rezension über das Werk mit dem Hinweis, dass es
demnächst bei Brönner in Frankfurt herausgegeben werde, was wohl der
ursprünglichen Absicht entsprach.
Im Archiv für Geographie, Historie, Staats- und Kriegskunst von 1822 wird über
Sophie Reinhard berichtet,
dass sie im Sommer von Karlsruhe nach Mailand reist und sich gegenwärtig mehr
mit dem Radieren als mit der Ölmalerei beschäftigt.
Ihrem väterlichen Freund aus
römischen Tagen Freiherr von Uexküll überreichte sie mit Schreiben vom 2. August
1820 ein Exemplar ihres Hebelschen Werkes und bittet ihn gleichzeitig, sechs
weitere Exemplare, die sie ihm zukommen lassen möchte, in seinem Bekanntenkreis
zu verkaufen. Ferner teilte sie Uexküll mit, dass ihre Mithilfe beim Verkauf des
Mappenwerkes ihren Plan, in diesem Jahre nach Italien zu reisen, zunichte
gemacht habe.
Johann Wolfgang von Goethe, dem die
Künstlerin mit Brief vom 14. August 1820 ein Exemplar der Radierungen nach
Hebels Alemannischen Gedichten überreicht hatte,
bemerkt zu den Illustrationen in einem Brief vom 1. September 1820 an Heinrich
Meyer: „Ich habe schon wieder drey Bogen parat zum nächsten Hefte. Freylich,
wenn man in der Einsamkeit immer fortwirkt, so häuft sich genug zusammen. Zu
Hebels Gedichten hat eine Sophie Reinhardt zu Carlsruhe geistreiche Radirungen
gefertigt, die gleichfalls eine gemäßigte ehrenvolle Erwähnung verdienen.“
Aus dem Brief der Künstlerin an Goethe wird ersichtlich, dass Sophie Reinhard
bei den Illustrationen zu den Alemannischen Gedichten das erste Mal mit der
Radiernadel arbeitete. Es ist zu vermuten, dass sie sich Rat bei den zum
Freundeskreis um Friedrich Weinbrenner zählenden Kupferstechern Christian
Haldenwang oder Carl Ludwig Frommel holen konnte, der damals gerade seinen Stich
„Ariccia bei Rom“ nach einer eigenen Zeichnung fertig stellte.
Die Qualität der Stiche, die Sophie Reinhard zu Hebels Gedichten anfertigte,
zeugen davon, dass sie sich intensiv mit dieser Drucktechnik auseinandergesetzt
hatte. Sie erwecken keinesfalls den Eindruck eines Erstlingswerkes.
In der Abend-Zeitung vom 11. August
1821 sieht Karl August Böttiger in seinem Artikel über Kunst und Alterthum die
Notwendigkeit, einer Sammlung von Radierungen „in rühmlicher Anerkennung zu
gedenken, welche wir der trefflichen Künstlerin Sophie Reinhard in Mannheim
verdanken. Sehr oft hatten Freunde von Hebel’s allemannischen Gedichten – und
wer ist dieß nicht? – gewünscht, daß Kupfer dazu in getreuer Nachbildung der
Trachten und Eigenthümlichkeiten des Völkleins, das in diesen Liedern noch lange
fortleben wird, gegeben werden möchten. Eine feinsinnige diesseits und jenseits
der Alpen gebildete Künstlerin hat durch die von ihr selbst komponirten und
radirten 10 Blätter diesen Wunsch so schön erfüllt, daß wir nicht zu loben
brauchen, was sich beim ersten Anblick selbst lobt. Die Künstlerin lebte einige
Jahre in der Gegend, wo jene Lieder einheimisch sind, und es ist ihr wunderbar
gelungen, nicht nur das Gemüthvolle des Dichters selbst aufzufassen und in
Ausdruck und Composition wiederzugeben, sondern selbst das Landesübliche in
Kostüm und kraftvollen Körperbau der Bewohner jener Gegend wiederzugeben. Das
schöne Bild des Statthalters von Schopfheim ist auch in dieser Hinsicht
charakteristisch. Wie an ihr die vollständige weibliche Tracht der
Verheiratheten, so stellt sich in Kätchen neben dem Kapuziner die leichte,
jungfräuliche Tracht der ächten alten marggräfler Kleidersitte dar, so wie
überhaupt die drei Blätter zum Carfunkel einen wahren, jedes Gefühl schauerlich
ergreifenden Cyclus bilden. Die Hebelschen Gedichte haben auch im nördlichen
Deutschland mit Recht viel Bewunderer gefunden und würden derer noch viel mehr
zählen, wenn es nur jener Mundart kundige Vorleser unter uns gäbe. Diese mit
zartem Sinn und doch kräftig aufgefaßten Bilder sprechen in keiner uns
unverständlichen Mundart zu uns. Man weiß beim ersten Blick, was jedes sagen
will und bekommt dann doch wohl auch Lust, das Lied in der Ursprache kennen zu
lernen.“

Portrait des Mundartdichters Johann
Peter Hebel.
Kupferstich von Christian Friedrich
Müller nach eigener Zeichnung aus dem Jahre 1810.
Abzug
vor aller Schrift
um 1814
(Bildnachweis: E. Fecker)
Es ist naheliegend, dass die Idee zur
Ausführung der Radierungen zu Hebels Alemannischen Gedichten auf eine Anregung
des Dichters zurückgeht, was auch die Beigabe von Hebels Vorwort offenbart.
Johann Peter Hebel wurde 1783 als Vikar am Pädagogium in Lörrach angestellt, mit
dessen Leiter Tobias Günttert sich Hebel anfreundete und zu dessen Schwägerin
Gustave Fecht er eine lebenslange enge Beziehung pflegte, ohne sie zu heiraten.
Die Familie Reinhard war ebenfalls 1783 von Birkenfeld nach Lörrach gezogen, wo
Hofrat Maximilian Reinhard, der Vater der damals achtjährigen Sophie, das Amt
des Landschreibers im Oberamt Rötteln übernahm.
Johann Peter Hebel wurde 1791 an das Gymnasium in Karlsruhe berufen, das er ab
1808 als Direktor leitete und Maximilian Reinhard kehrte mit seiner Familie 1792
in seine Geburtsstadt zurück, wo er zum wirklichen Geheimrat und später zum
Staatsrat aufstieg.
Hebel hatte 1803 erstmals seine
Alemannischen Gedichte veröffentlicht und es steht außer Zweifel, dass die
Familie Reinhard, die in Karlsruhe ganz in der Nähe von Hebel wohnte, dort
weiterhin die in Lörrach entstandene freundschaftliche Beziehung pflegte und an
seinem dichterischen Erfolg Anteil nahm. In den Folgejahren war Johann Peter
Hebel seinerseits immer über die künstlerische Laufbahn von Sophie Reinhard
unterrichtet, denn er zählte wie sie zu einem Freundeskreis von Architekten,
Künstlern und Gelehrten, der öfters bei Friedrich Weinbrenner zu Gast war.
Weinbrenners Haus bildete besonders für einen Kreis Karlsruher Künstler und
Gelehrter den Mittelpunkt, zu denen neben Sophie Reinhard unter anderen die
Künstler Philipp Jakob Becker, Carl Ludwig Frommel, Carl und Rudolf Kuntz, Franz
Joseph Zoll, Feodor Iwanowitsch Kalmück, Joseph und Carl Sandhaas sowie
Christian Haldenwang, der Botaniker Carl Christian Gmelin, der Ingenieur Johann
Gottfried Tulla und wie erwähnt, der Dichter Johann Peter Hebel sowie der Lehrer
für Kunstgeschichte an Weinbrenners Bauschule Aloys Schreiber zählten.
Mit den Künstlern Feodor Iwanowitsch
Kalmück, Franz Joseph Zoll und Carl Ludwig Frommel teilte Sophie Reinhard, außer
der Auszeichnung zum Hofmaler, die gemeinsame Erinnerungen an römische Tage.
Feodor Iwanowitsch Kalmück hatte sie in Rom im Jahre 1810 getroffen,
Franz Joseph Zoll war kurz nach ihr in Rom angekommen und blieb dort bis Anfang
1814,
Carl Ludwig Frommel kam 1813 nach Rom und blieb dort bis 1817.
Feodor Iwanowitsch Kalmück, der bis etwa 1816 bei Friedrich Weinbrenner in
dessen Haus am Ettlinger Tor wohnte, war 1806 zum Hofmaler, mit einer jährlichen
Besoldung von 1500 Gulden, bestellt worden,
Carl Ludwig Frommel wurde 1818 mit einem Gehalt von 800 Gulden zum Hofmaler und
Professor ernannt
und Franz Joseph Zoll erhielt diese Auszeichnung 1821.
Im Jahre 1821 richtete der Karlsruher
Kunstverein seine zweite Ausstellung für Kunst und Industrie aus. Sophie
Reinhard beteiligte sich mit dem Gemälde „Die heilige Cecilie“ und dem Aquarell
„Ein ländliches Fest im Oberland wegen Aufhebung der Leibeigenschaft im Jahre
1783, der Ehrentag Carl Friedrichs“. An dieser Ausstellung in Karlsruhe nahm
auch zum ersten Mal die Konstanzer Künstlerin Marie Ellenrieder mit dem Gemälde
„Eine kleine Madonna im Profil“ teil.
Spätestens bei dieser Ausstellung im Jahre 1821 muss die 1829 ebenfalls zur
Großherzoglich Badischen Hofmalerin ernannte Künstlerin die Bekanntschaft von
Sophie Reinhard gemacht haben, denn ein Jahr später, am 12. Oktober 1822,
besuchte Marie Ellenrieder auf ihrer Reise nach Italien Bianca Milesi in
Mailand.
Die Empfehlung, sie zu besuchen, konnte nur von Sophie Reinhard stammen.
Das Aquarell „Ein ländliches Fest im
Oberland wegen Aufhebung der Leibeigenschaft im Jahre 1783, der Ehrentag Carl
Friedrichs“, welches die Künstlerin 1821 ausstellte, deutet ebenfalls auf die
Nähe von Sophie Reinhard zu Johann Peter Hebel hin. Dem Aquarell ist am
Unterrand ein gedrucktes Gedicht in alemannischer Mundart anmontiert, das später
auch im Karlsruher Beobachter vom 23. Juli 1846 erschienen ist und dort Johann
Peter Hebel als Autor bezeichnet.
Die Hebelforschung konnte aber bis heute die Handschrift dieses Gedichtes nicht
auffinden, weshalb seine Urheberschaft nicht als ganz sicher gilt.
Ferner berichtet das Kunstblatt aus Karlsruhe am 28. Januar 1822: „Fräulein
Reinhard hat einige geistvolle Zeichnungen aus der biblischen Geschichte
vollendet“, was auf eine Absprache mit Hebel zurückgehen könnte, der damals
ebenfalls an seinen „Biblischen Geschichten“ arbeitete, die 1824 – allerdings
ohne Illustrationen zum Text – bei Cotta erschienen.

Ländliches Fest aus Anlass der
Aufhebung der Leibeigenschaft in Baden am 23. Juli 1783 durch Markgraf Carl
Friedrich.
Aquarell von Sophie Reinhard, 1821.
© Staatliche Kunsthalle Karlsruhe,
Inv.-Nr. P. K. I 489-169
Das Aquarell „Ländliches Fest aus
Anlass der Aufhebung der Leibeigenschaft in Baden“ erinnert an das Reskript von
Markgraf Karl Friedrich aus dem Jahre 1783. Den Entschluss die Leibeigenschaft
aufzuheben hatte der Markgraf aus völlig freien Stücken auf seinem Jagdschloss
Stutensee gefasst, wo er den Tod seiner geliebten Frau Caroline Louise von
Hessen-Darmstadt betrauerte. Mit diesem Reskript gewährte er seinen Untertanen
uneingeschränkte Freizügigkeit und entband sie von vielen Abgaben, Gefällen und
Taxen. Zum Dank für die Aufhebung der Leibeigenschaft wurde in zahlreichen
Gemeinden Badens Denkmäler errichtet und der Tag der Aufhebung am 23. Juli wurde
Anlass für immer wiederkehrende Gedenkfeiern.
Ab dem Jahre 1821 wurden in Karlsruhe
vom Badischen Kunstverein in einem Abstand von zwei Jahren Ausstellungen für
Kunst und Industrie veranstaltet, an denen sich Sophie Reinhard regelmäßig mit
Gemälden und Zeichnungen beteiligte, so an den Ausstellungen in den Jahren 1821,
1823, 1825, 1827 und 1829. Die 1820er Jahre können wir, aufgrund dieser Vielzahl
von Ausstellungsbeteiligungen und ausgestellten Werken, als die erfolgreichsten
und produktivsten Jahre ihres künstlerischen Schaffens bezeichnen.
Aus diesen Jahren dürfte ein
Scherenschnitt der Stuttgarter Künstlerin Luise Duttenhofer stammen, den sie von
Sophie Reinhard angefertigt hat, wie sie vor einer aus gotischem Maßwerk
bestehenden Balustrade sitzt und darauf ihren Ellenbogen aufstützt. Der
Scherenschnitt stammt aus dem Nachlass der Künstlerin Luise Duttenhofer und ist
heute im Besitz des Deutschen Literaturarchivs Marbach.
Es gibt Hinweise darauf, dass Sophie Reinhard vorhatte im Frühjahr 1821 nach
Stuttgart zu reisen
und bei dieser Gelegenheit hätte sie mit Luise Duttenhofer zusammentreffen
können, denn die beiden hatten viele gemeinsame Bekannte, wie die Gebrüder
Boisserée, Joseph Anton Koch, Johann Christian Reinhart, Gottlieb Schick,
Freiherr von Uexküll, Eberhard von Wächter und Friedrich Weinbrenner.

Scherenschnitt von Luise Duttenhofer
„Sophie Reinhardt.“
(Bildnachweis: DLA-Marbach)
In einem ähnlichen Alter wie im
Scherenschnitt von Luise Duttenhofer dürfte Sophie Reinhard gewesen sein, als
ein unbekannter Künstler von ihr ein Portrait lithographierte.
Die Künstlerin in Halbfigur nach links, vor neutralem Hintergrund, trägt eine
Rüschenhaube und ein Cape, das mit einem Spitzenkragen abschließt.

Portrait „Sophia
Reinhard Malerin“. Lithographie eines unbekannten Künstlers.
Staatsgalerie
Stuttgart, Graphische Sammlung © Foto: Staatsgalerie Stuttgart
Im Jahre 1821 wurde Sophie Reinhard
von ihrem jahrelangen Reisebegleiter Jakob Wilhelm Huber besucht, der als
angesehener Künstler aus Italien nach Zürich zurückgekehrt war. Er hatte zuvor
die Königin Pauline von Württemberg und deren Mutter in Stuttgart besucht und
war von dort nach Karlsruhe weitergereist, um sich mit dem Galeriedirektor
Ludwig Frommel und mit Sophie Reinhard zu treffen. Danach reiste er nach
Bruchsal und Darmstadt weiter, um dort seinen alten Freund, den Architekten und
Weinbrennerschüler Georg Moller zu besuchen, den er wohl 1810 nach dessen
Rückkehr aus Rom und Paris in Karlsruhe kennen gelernt hatte. Jakob Wilhelm Huber
reiste weiter über Frankfurt zurück nach Mannheim, wo der befreundete Architekt
Dyckerhoff
wohnte und die verwitwete Großherzogin Stephanie ihm eine Wohnung im Schloss
antragen ließ, mit der Bedingung, ihren Töchtern Luise und Josephine im Zeichnen
und Malen Unterricht zu erteilen. Seine innere Unruhe trieb ihn aber schon nach
einem Monat zurück nach Zürich.
Mit Verfügung vom 12. Juni 1823
wurden alle Hofmaler vom Großherzoglichen Oberhofmarschallamt aufgefordert über
die Erfüllung der auferlegten Verbindlichkeiten bei der Bewilligung der
Besoldung Rechenschaft abzulegen.
Die Liste der aufgeforderten Künstler wiederholt neben der Höhe der Besoldung
den Wortlaut der auferlegten Pflichten. Bei Sophie Reinhard werden als Besoldung
800 Gulden genannt und zu den Pflichten ist vermerkt: „Hat von Zeit zu Zeit eine
Arbeit einzuliefern, oder auch auf desfalls anderweit erhaltende Weisung
Unterricht im Zeichnen zu ertheilen.“
Sophie Reinhard antwortet am 24. Juni
1823, dass sie ihren Pflichten bestens nachgekommen sei und schreibt: „In dessen
Gemäßheit habe ich unterthänigst überreicht, des Großherzogs Karl Königliche
Hoheit
Elisabeth und Johannes [1812],
die sterbende Catharina von
Siena [1817],
der Traum von Margraf Karl
Wilhelm, oder die Erbauung von Karlsruhe [1816].
des regierenden Großherzogs
Königliche Hoheit
die heilige Cecilie [1821],
zehn radirte, von mir
componierte Blätter zu Hebels Allemannischen Gedichten [1820],
das Fest bey Aufhebung der
Leibeigenschaft [1821],
und die Margräfin Anna, wie sie
Gaaben unter Arme und Kranke spendet [1823], wartet zu gleicher Bestimmung
lediglich auf gehörige Empfänglichkeit für den Oelfirniß.“
Überraschenderweise zählt die
Künstlerin die „Zehn Radierungen nach Hebels Alemannischen Gedichten“ vom Jahre
1820 ersatzweise ebenfalls zu ihren „Pflichtbildern“. Offensichtlich hat sie ein
Exemplar dem Großherzoglichen Hof zukommen lassen und damit ihre Pflicht als
Hofmalerin für das Jahr 1820 erfüllt.
Die Künstlerin hatte auf den
Kunstausstellungen 1825 und 1827 mehrere ihrer Gemälde gezeigt, darunter 1825
das Historienbild „Markgraf Christoph I. von Baden (1453-1527) empfängt Gesandte
Kaiser Maximilians“, das sich heute in der Kunsthalle Karlsruhe befindet und
vermutlich Pflichtbild für das Jahr 1825 gewesen ist.
Nach der Kunstausstellung im Jahre 1829, wo Sophie Reinhard vier Gemälde
ausstellte, darunter das Historienbild „Tod des Torquato Tasso“, hat sie sich
erstaunlicherweise bis zu ihrem Tod im Jahre 1844 an den Ausstellungen in
Karlsruhe nicht mehr beteiligt, ganz im Gegensatz zu den anderen Hofmalerinnen
und Hofmalern, wie z. B. Marie Ellenrieder, Rudolf Kuntz und Franz Joseph Zoll,
welche in diesen Jahren immer zahlreich mit Gemälden und Zeichnungen vertreten
waren.

Tod des Torquato Tasso.
Ölgemälde von Sophie Reinhard, um
1829.
© Staatliche Kunsthalle Karlsruhe,
Inv.-Nr. 1744
Wie schon im Jahre 1810 lässt sich
Sophie Reinhard Anfang der 1820er Jahre wieder von einem Schauspiel Goethes
inspirieren, um eine Szene aus dem Leben des bedeutenden italienischen Dichters
Torquato Tasso in ihre bildliche Sprache zu übersetzen.
Erstmals zeigte sie auf der
Karlsruher Kunstausstellung des Jahres 1823 ein Aquarell mit dem Titel „Tod des
Tasso im Kloster San Onofrio“ und wenige Jahre später auf der Karlsruher
Kunstausstellung des Jahres 1829 das erwähnte Ölgemälde, welches das Thema „Tod
des Torquato Tasso“ nochmals aufgreift. Dargestellt ist Tasso, von einem Mönch
gestützt, betend auf seinem Sterbebett im Kloster San Onofrio. Der Priester, der
ihm das Sakrament der Krankensalbung, die sogenannte Letzte Ölung, gespendet
hat, verlässt gerade den Raum und die neben dem Sterbebett knienden Personen
scheinen untröstlich über den herannahenden Tod zu sein und beten für seine
Aufnahme in das ewige Leben, das durch die von links in das Zimmer
hereinfallenden Sonnenstrahlen symbolisiert wird. Bei diesem Historienbild, das
sich heute im Besitz der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe befindet, dürfte es
sich um ein Pflichtbild für den Großherzoglichen Hof handeln. Das Gemälde wurde
mit der Überführung der Staatlichen Galerie im Schloss Mannheim 1937 von der
Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe übernommen.
Neben der regen Beteiligung der
Künstlerin an den Karlsruher Kunstausstellungen der 1820er Jahre, war für Sophie
Reinhard der Bau eines eigenen Hauses in Karlsruhe ein bedeutendes Ereignis.
Dass sich eine Frau in der damaligen Zeit selbst an den Bau eines Hauses
heranwagte, ist als außergewöhnlich zu bezeichnen, und kann nur mit ihrer
unbeirrbaren Durchsetzungsfähigkeit und Willenskraft erklärt werden. Im Juni
1827 wurde namens der Erben Friedrich Weinbrenners von der Großherzoglich
Badischen Polizeidirektion der Residenz, als zuständige Behörde für die
Stadtplanung, bei der Großherzoglichen Baudirektion der Antrag gestellt, am
Südrand des Weinbrennerschen Anwesens, vom Ettlinger Tor bis zum
Erbprinzengarten (heute Nymphengarten), eine neue Straße anzulegen.
Die projektierte Straße erhielt später den Namen Linden-Straße. Sie hatte
ursprünglich neun Parzellen und sollte von der parallel verlaufenden
Kriegsstraße durch eine Ahamauer und einen 2,7 Meter tiefen und 3 Meter breiten
Ahagraben getrennt werden.
Endgültig wurden in der Straße zehn Bauplätze ausgewiesen, von denen der Platz
mit der Nummer 5 von Sophie Reinhard erworben wurde, auf dem sie sich
anschließend ihr eigenes Haus baute.
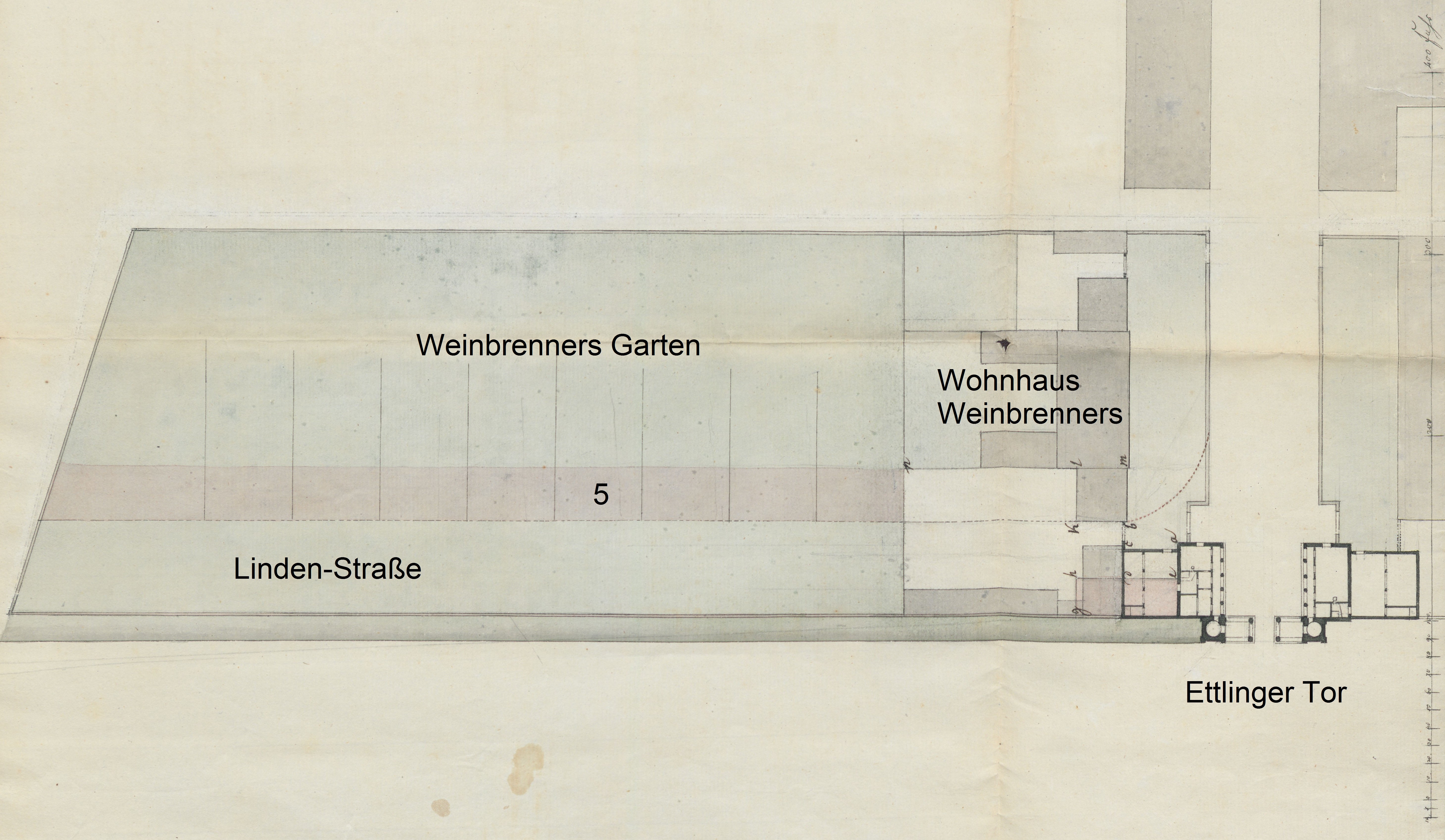
Entwurf der Bebauung am Südrand des
Weinbrennerschen Anwesens vom Ettlinger Tor bis zum Erbprinzengarten im Jahre
1827. Aufteilung in neun Baugrundstücke längs der geplanten Linden-Straße.
Sophie Reinhard bebaute den Platz mit der Nummer 5
(Vorlage und Aufnahme:
Generallandesarchiv Karlsruhe, Bestand 422 Nr. 316)
Um den Zugang zu der neuen Straße zu
schaffen, musste die südlich an das Wohnhaus Weinbrenners anschließende Mauer
und ein Schuppen abgerissen und das Wacht- und Zollhaus am Ettlinger Tor
umgebaut werden, was gemeinsam von den Weinbrennerschen Erben und der Stadt
Karlsruhe hälftig bezahlt wurde.
Mit den Erben wurde ferner vereinbart, dass sie am westlichen Rand des
Grundstückes so viel Gelände abzutreten hatten, damit dort später eine
Verlängerung der Lammstraße bis hin zur Kriegsstraße möglich würde. Der Umbau
des Wacht- und Zollhauses begann noch im Herbst dieses Jahres, dürfte sich aber
bis 1828 hingezogen haben, sodass wir annehmen können, dass Sophie Reinhard 1829
mit dem Bau ihres Hauses beginnen konnte. Sie wird dort ab 1831 im Adressbuch
der Stadt Karlsruhe als Hausbesitzerin und Bewohnerin des Hauses mit der Nr. 5
genannt.
Jedenfalls war die Bebauung der Straße 1833 nahezu abgeschlossen.
|
 |
 |
Drais-Denkmal vor dem Reinhardschen
Haus, ehemals Lindenstraße 5, heute Kriegsstraße 126
(Bildnachweis:
Stadtarchiv
Karlsruhe 8/PBS oXIVb 55 und 8/BA Schlesinger A39/83/3/5, Foto erschienen in den
Badischen Neuesten Nachrichten vom 21. August 1961)
|
1878 wurde der Ahagraben eingeebnet,
sodass zwischen der Lindenstraße und der Kriegsstraße nur noch ein Grünstreifen
vorhanden war. Die Lindenstraße wurde dadurch ein Teil der Kriegsstraße. Die
Häuser der Lindenstraße wurden folglich in die Nummerierung der Kriegsstraße
einbezogen und das Reinhardsche Haus erhielt die Hausnummer Kriegsstraße 52.
Auf dem Grünstreifen wurde 1893 direkt vor dem Reinhard’schen Haus ein Denkmal
für den Erfinder des Zweirads (sog. Draisine) Karl Friedrich Christian Freiherr
von Drais (1785-1851) errichtet.
Im Zuge des Umbaues der Kriegsstraße
in den 1960er Jahren musste das Drais-Denkmal dem Straßenbau weichen und wurde
1963 in der Beiertheimer Allee erneut aufgestellt. Heute trägt das ehemalige
Wohnhaus von Sophie Reinhard die Hausnummer Kriegsstraße 126. Das Haus war
ursprünglich ein Stockwerk niedriger. Das Dachgeschoss wurde erst in den 1970er
Jahren aufgesetzt, indem der Dachstuhl − leider zu Ungunsten der Ansicht der
Hausfront − durch einen Kniestock angehoben wurde.

Reinhardsches Haus (zweites von
links) mit aufgesetztem Stockwerk in der zur Schnellstraße ausgebauten
Kriegsstraße (Bildnachweis: Stadtarchiv Karlsruhe 8/BA Schlesiger A8b/32/1/re,
Foto erschienen in den Badischen Neuesten Nachrichten vom 25. März 1980)
Die
Häuser östlich des Reinhardschen Hauses wurden 2003 bis zum Ettlinger Tor
abgerissen und an deren Stelle das gleichnamige Einkaufszentrum errichtet.

Die Wohnhäuser Lindenstr. 6
(Hauptmann Klose) und 5 (Sophie Reinhard), heute Kriegsstr. 128
und 126 sowie rechts anschließend das Einkaufszentrum
(Foto: E. Fecker)
Größere Reisen scheint Sophie
Reinhard nach der Reise mit Bianca Milesi nicht mehr unternommen zu haben.
Außerhalb von Karlsruhe sind die Künstlerin und ihre Verwandtschaft mehrfach in
Baden-Baden als Kurgäste feststellbar. So z. B. Anfang August 1819, wo
gleichzeitig Königin Caroline und König Maximilian I. von Bayern, aber auch
Ober-Baudirektor Weinbrenner zugegen waren und sie am Dienstag den 3. August den
Kunstsammler Sulpiz Boisserée traf, der in seinem Tagebuch vermerkt:
„Nachmittags Lichtenthal. Mamsel Reinhard gröblich einbildnische Künstlerin und
doch eine gute derbe Person.“
Anfang August 1826 ist sie nochmals in dem dortigen Badewochenblatt aufgeführt,
wo gleichzeitig Marie Ellenrieder zusammen mit ihren Freundinnen Vincenti und
Biedenfeld kurten.
Lebensabend in Karlsruhe
Wie bereits erwähnt, nahm die
Künstlerin 1831 nicht mehr an der Ausstellung des Badischen Kunstvereins in
Karlsruhe teil und gleichzeitig werden die Nachrichten über die Künstlerin ab
diesem Zeitpunkt äußerst spärlich, weshalb es schwer ist, ihren künstlerischen
Lebenslauf bis zu ihrem Tod im Jahre 1844 genauer nachzuzeichnen. Es scheint
naheliegend, dass die Abneigung, welche die Königin Caroline für den ab 1830 aus
der sog. Hochberger Linie zur Herrschaft gelangten Großherzog Leopold von Baden,
hegte, auch für ihre Parteigängerin Sophie Reinhard Folgen hatte, über die wir
nur Mutmaßungen anstellen können, denn der Nachlass der Königin Caroline, der
über diese Zeit hätte Aufschluss geben können, ist im 2. Weltkrieg verbrannt.
Sicher jedoch ist, dass die Abneigung
der Königin Caroline gegen die Hochberger, darauf beruhte, dass sie eine
unbedingte Anhängerin der damals weit verbreiteten Theorie war, dass die 1820
verstorbene Gräfin Hochberg, die mit dem Großvater Carolines in morganatischer
Ehe verheiratet war, den am 29. September 1812 geborenen Sohn ihres Bruders
Großherzog Karl Ludwig auf dem Krankenbett durch ein sterbenskrankes Kind vertauscht
habe, sodass durch den Tod dieses Säuglings am 29. Oktober den Kindern der
Hochberger Linie die Thronfolge eröffnet war.
Neue Nahrung erhielt das Gerücht der
Kindsentziehung, als am 26. Mai 1828 in Nürnberg ein 15 bis 16 Jahre alter Junge
auftauchte, der kaum des Redens mächtig war und bei seiner Befragung mit
kindlich großen Buchstaben den Namen Kaspar Hauser auf einen Zettel schrieb.
Diesen Findling hielten danach viele, so auch Königin Caroline, für den tot
geglaubten badischen Erbprinzen, ohnedass dies je wirklich bewiesen werden
konnte.
Mit dem Regierungsantritt Großherzogs
Leopold im Jahre 1830 wurde das Gerücht über Kaspar Hauser als bayerische
Intrige überall in Baden kolportiert, und wie der Bruder des Großherzogs in
seinem Tagebuch vermerkt, mit der Absicht nach dem Aussterben der Zähringer
Linie die Ansprüche Bayerns auf die rechtsrheinische Pfalz
öffentlichkeitswirksam zu beeinflussen.
Um diesen Gerüchten entgegenzutreten, ließ Großherzog Leopold fast alle
Vertrauten seines Vorgängers Großherzog Ludwig vom Hof entfernen,
darunter der Bruder der Künstlerin Staatsrat Wilhelm Reinhard, der 1831 in den
Ruhestand versetzt wurde.
Ob auch Sophie Reinhard betroffen war, konnte bisher nicht nachgewiesen werden.
Jedenfalls sind von ihr nach 1830 keine Pflichtbilder für den Hof bekannt
geworden und im Hof- und Staatshandbuch des Großherzogtums Baden auf das Jahr
1834 werden als Hofmaler nur noch Friedrich Helmsdorf und Rudolph Kuntz sowie
als Hofmalerin Marie Ellenrieder aufgeführt. Schon der Wegweiser für die
Residenzstadt Karlsruhe für das Jahr 1831 verzeichnet die Künstlerin als
wohnhaft in der Lindenstraße 5. Ihrem Namen ist aber keine Berufsbezeichnung
beigefügt, wie dies z. B. bei Christian Haldenwang der Fall ist, wo als
Berufsbezeichnung Hofkupferstecher angegeben ist.
Oder das Adressbuch der Haupt- und Residenzstadt Carlsruhe für das Jahr 1832,
das laut Angaben des Herausgebers nach Unterlagen der Großherzoglichen Behörden
verfasst wurde, verzeichnet Sophie Reinhard ebenfalls ohne Berufsbezeichnung,
während Demoiselle Ellenrieder als Hofmalerin aufgeführt ist.
Sophie Reinhard starb am 17. Dezember
1844 im Alter von über 69 Jahren in Karlsruhe.
Das Haus in der Lindenstraße ging in den Besitz ihres Schwagers Christoph Jakob
Eisenlohr
und dessen Ehefrau Caroline Sophia geb. Reinhard
über und wurde ab 1846 von dessen Söhnen Otto und Max Eisenlohr
bewohnt.
Dorthin sind auch Teile des künstlerischen Nachlasses gelangt, die 1977 von der
Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe übernommen wurden.
Ein anderer Teil
des künstlerischen Nachlasses, der an ihre Schwester Caroline Sophia Eisenlohr
übergegangen war, wurde kurz nach deren Tod am 20. Dezember 1853 in Karlsruhe
versteigert. Die Versteigerung des Nachlasses fand am 9. und 10. Januar 1854
statt und enthielt nicht näher bezeichnete Handzeichnungen von Sophie Reinhard
und deren Zeichen- und Malerapparate.
Dank
Bei meinen Nachforschungen fand ich
vielerlei Hilfe von Archiven, Bibliotheken und Museen. Namentlich habe ich mich
für wichtige Hinweise und Veröffentlichungsgenehmigungen aufs Herzlichste zu
bedanken bei Herrn Archivamtmann Michael Bock, Generallandesarchiv Karlsruhe,
Frau Andrea Brandl, Stadt Schweinfurt, Museen und Galerien, Herrn Adrian
Braunbehrens, Herrn Archivar Peter Casper, Kirchberg im Hunsrück, Frau Dr. Jutta
Dresch und Herrn Oliver Sänger vom Badischen Landesmuseum Karlsruhe, Frau
Jacqueline Kolesch, Markgräflich Badische Verwaltung Salem, Herrn Archivamtsrat
Löffelmeier, Stadtarchiv München, Frau Dr. Michaela Engelstätter, Frau Dr. Dorit
Schäfer und Konservator Dieter Peter von der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe,
Katja Schmalholz, Stadt Karlsruhe, Kulturamt, Stadtarchiv Karlsruhe, Herrn René
Simmermacher, Staufen i. Br., Frau Conny Vogt, Klassik Stiftung Weimar und Frau
Renate Würsch von der Universitätsbibliothek Basel, Abteilung Handschriften und
Alte Drucke.
Einen weiteren Einblick in das glücklose Geschäftsgebaren
von Wilhelm Reinhard bietet ein Rechtstreit, der sich um das Erbe des
Hofmalers Feodor Iwanowitsch entwickelte. Nach den Akten, die vom
Nachlass des am 27. Januar 1832 verstorbenen Hofmalers handeln,
forderten die vier Erben (darunter der Bildhauer Johann Christian Lotsch
in Rom und der Maler August Bootz aus Rastatt) vom Staatsrat Wilhelm
Reinhard 1914 Gulden und 10 Kreuzer, welche sich laut Abrechnung vom 31.
August 1831 noch in dessen Besitz befinden müssten. Staatsrat Reinhard
beklagte, dass er noch keine abschließende Abrechnung von Feodors
Besoldung als Hofmaler vorgenommen habe und wies außerdem darauf hin,
„er seye nicht als Vermögensverwalter für Hr. Feodor anzusehen, er habe
dessen Einnahmen und Ausgaben nur aus Freundschaft und Gefälligkeit
besorgt“, was er seit April 1817 erledigte. Da Staatsrat Wilhelm
Reinhard die Herausgabe des Guthabens zu verzögern suchte, verklagten
ihn die Erben mit Datum vom 13. April 1832 die 1914 Gulden und 10
Kreuzer auszuzahlen und bekamen letztlich Recht (GLA Karlsruhe Bestand
206 Nr. 1300).
Werkkatalog
Im folgenden Katalog der Werke
von Sophie Reinhard werden sämtliche Gemälde, Zeichnungen und Druckgraphiken
zeitlich geordnet aufgeführt, soweit über sie in den Quellen Hinweise zu
finden waren. Von Vollständigkeit des Kataloges kann nicht gesprochen
werden. Er bedarf in der Zukunft noch vieler Ergänzungen.
Der Werkkatalog ist in vier
Gruppen eingeteilt:
- Gemälde
- Gemäldekopien
- Zeichnungen
- Druckgraphiken
Jeder Eintrag im Werkkatalog
besteht aus dem Titel des Werkes, dem Entstehungsjahr, sofern nicht genau
bekannt dem ungefähren Entstehungsjahr, der Technik, den Maßangaben, wenn
vorhanden der Bezeichnung, dem Verbleib und Quellen sowie Kommentaren.
Bei den Maßangaben steht die Höhe
vor der Breite. Alle Maße sind in Zentimetern angegeben.
Bei Beschreibungen des
Bildinhaltes sind »Rechts« und »Links« vom Betrachter aus gesehen, mit
Ausnahme der Bezeichnung von Körperteilen.
Bei dem im Werkkatalog
angegebenen Verbleib sind im wesentlichen Werke aus öffentlichen Sammlungen
aufgeführt. Werke im Privatbesitz werden nicht namentlich aufgeführt.
Gemälde (Oel
oder Pastell)
G 1 Brustbild einer alten
Dame in schwarzem Kleid und weißer Haube. 1799
Miniatur auf Elfenbein
4,5 x 2,6 cm, oval, Bronzering
Signiert rechts „Reinhardt 1799“
Verbleib unbekannt
Leo R. Schidlof,
The miniature in Europe
in the
16th, 17th, 18th and 19th centuries,
Graz 1964, Bd. 2, S. 669
Paul Graupe,
Portraitminiaturen des 16. bis 19.
Jahrhunderts, Auktion
54, 7. November 1925, Los 108, S. 25
G 2 Mädchen mit Buch. Um
1800
Miniatur
Verbleib unbekannt
Karl Obser, Galeriedirektor Philipp Jakob Becker und sein künstlerischer
Nachlaß, in: Oberrheinische Kunst, Bd. 8, 1939, S. 172
G 3 Caroline Eisenlohr geb.
Reinhard (geb. 1784), Schwester der Künstlerin, Brustbild nach links. Um
1806
Pastell auf Pergament
20,3 x 14,0 cm
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe,
Inv.-Nr. 1977-8
Jahrbuch der Staatlichen Kunstsammlungen in Baden-Württemberg, Bd. 15, 1978, S.
119
Caroline
Sophia Friederica Reinhard, wurde am 17. Februar 1784 als jüngste Tochter des
Maximilian und der Jacobina Margaretha Petronella Reinhard in Lörrach geboren und starb am 20.
Dezember 1853 in Karlsruhe. Sie war seit dem 18. Juni 1804 mit Christoph
Jakob Eisenlohr verheiratet
G 4 Wilhelm Reinhard (geb.
1776), Bruder der Künstlerin, Brustbild nach links. Um 1806
Pastell auf Pergament
20,9 x 16,0 cm
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe,
Inv.-Nr. 1977-9
Jahrbuch der Staatlichen Kunstsammlungen in Baden-Württemberg, Bd. 15, 1978, S.
119
Wilhelm
Emanuel Reinhard, wurde am 2. September 1776 als ältester Sohn des
Maximilian und der Jacobina Margaretha Petronella Reinhard in Kirchberg geboren und starb am 26.
November 1858 in Paris
G 5
Melida
beobachtet die Vögel mit ihren Jungen. Szene aus Gessners Idylle „Der erste
Schiffer“. 1810
Oelgemälde
Verbleib unbekannt
Brief von Sophie Reinhard an
Albrecht Adam vom 13. Januar 1810
G 6 Portrait des Maximilian
Wilhelm Reinhard, Vater der Künstlerin. 1810
Oel auf Leinwand
65 x 53 cm
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe,
Inv.-Nr. 2648
Brief von Sophie Reinhard an
Albrecht Adam vom 13. Januar 1810
Jahrbuch der Staatlichen Kunstsammlungen in Baden-Württemberg, Bd. 15, 1978, S.
101
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe
(Hrsg.), Neuerwerbungen für die Gemäldegalerie 1972-1984, Karlsruhe
1984, S. 74, Abb. Nr. 43
Katrin Seibert, Rom besuchen –
Italienreisen deutscher Künstlerinnen zwischen 1750 und 1850, München
2009, Bd. 1, S. 75, Bd. 2, S. 77 und 188, Abb. 202
Maximilian
Wilhelm Reinhard, wurde am 25. Dezember 1748 als Sohn des Johann Jakob und
der Sophia Friederica Reinhard, geb. Archenholtz, in Karlsruhe geboren und starb am 16. Mai
1812 in Karlsruhe. Er war seit dem 19. August 1774 mit Jacobina Margaretha
Pastert verheiratet
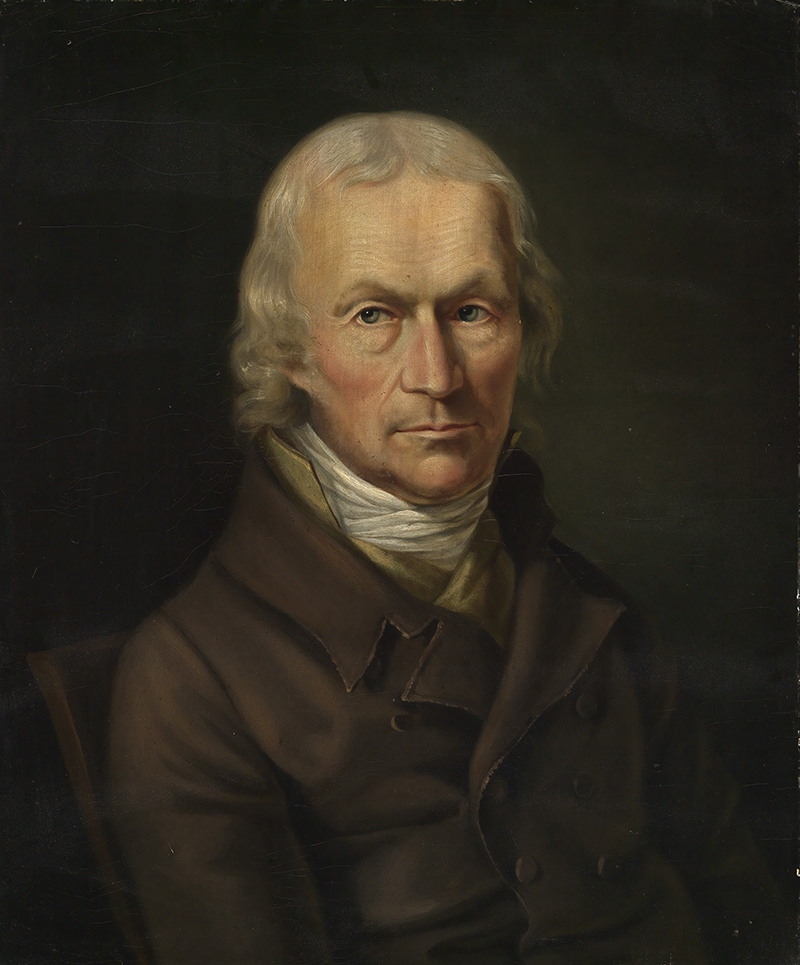
Portrait des Maximilian Wilhelm
Reinhard.
© Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, Inv.-Nr. 2648
G 7 Bildnis des Maximilian
Wilhelm Reinhard, im Profil nach links. Um 1810
Oel auf Holz
11,4 x 9,5 cm
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe,
Inv.-Nr. 2649
Jahrbuch der Staatlichen Kunstsammlungen in Baden-Württemberg, Bd. 15, 1978, S.
101
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe
(Hrsg.), Neuerwerbungen für die Gemäldegalerie 1972-1984, Karlsruhe
1984, S. 74, Abb. Nr. 44
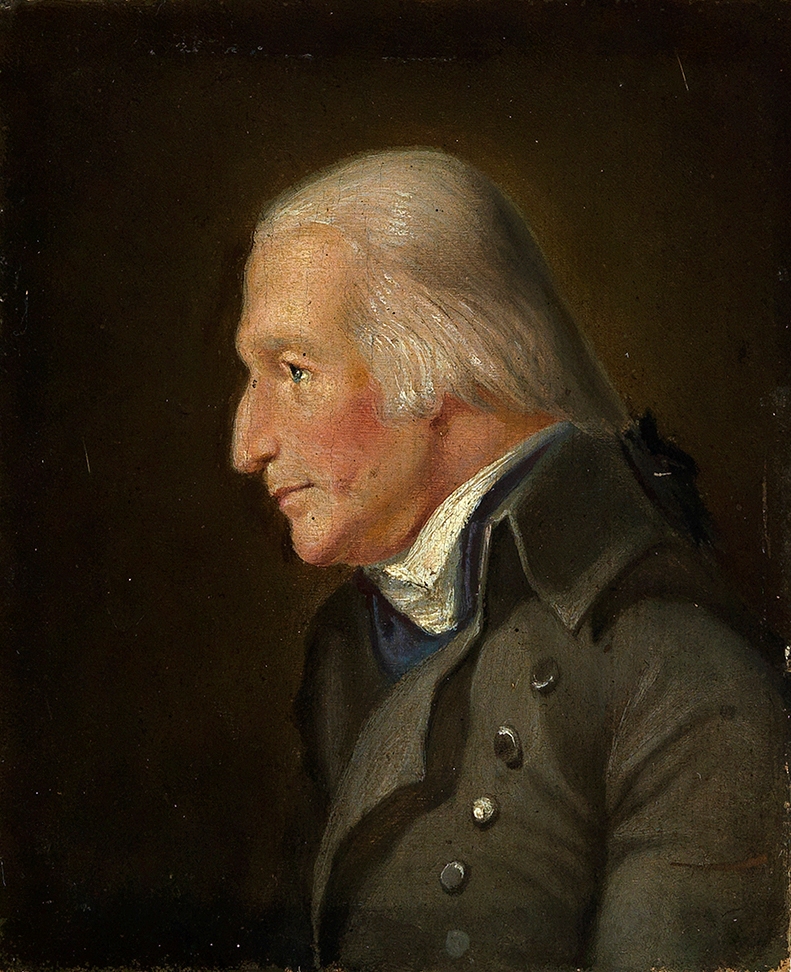
Bildnis des Maximilian Wilhelm
Reinhard, im Profil nach links.
© Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, Inv.-Nr. 2649
G 8 Portrait der Jacobina
Reinhard, Mutter der Künstlerin. 1810
Oel auf Leinwand
62 x 51 cm
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe,
Inv.-Nr. 2647
Brief von Sophie Reinhard an
Albrecht Adam vom 7. März 1810
Jahrbuch der Staatlichen Kunstsammlungen in Baden-Württemberg, Bd. 15, 1978, S.
101
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe
(Hrsg.), Neuerwerbungen für die Gemäldegalerie 1972-1984, Karlsruhe
1984, S. 74, Abb. Nr. 42
Katrin Seibert, Rom besuchen –
Italienreisen deutscher Künstlerinnen zwischen 1750 und 1850, München
2009, Bd. 1, S. 76, Bd. 2, S. 77 und 188, Abb. 201
Jacobina
Margaretha Petronella Pastert, wurde am 13. Juli 1755 als Tochter des Peter
Georg und
der Philippine Louise Pastert, geb. Fuchs, in Weitersbach geboren und starb am 27. Oktober
1826 in Karlsruhe. Sie war seit dem 19. August 1774 mit Maximilian Wilhelm
Reinhard verheiratet

Portrait der Jacobina Reinhard geb. Pastert.
© Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, Inv.-Nr. 2647
G 9 Madonna mit dem Kinde.
Um 1810
Oelgemälde
Verbleib unbekannt
Kunst- und andere Nachrichten
aus Carlsruhe, in:
Journal des Luxus und der Moden, hrsg. von Carl Bertuch,
Weimar 1810, 25. Bd., S. 443 „Dem.
Reinhardt … hat eine Madonna mit dem Kinde, ein zartes gemüthliches Bild,
welches ohne Affektion an die alten italienischen Bilder erinnert, und
einige sehr gute Portraits geendigt“.
G 10 Die heilige Euphrasia
ein Kreuz umarmend. 1811
Oelgemälde
85,5 x 114 cm (3 Fuß x 4 Fuß,
württembergisch)
Verbleib unbekannt
Johann Friedrich Cotta,
Morgenblatt für gebildete Leser, 5. Jg., Tübingen 1811, S. 664
„Demois. Reinhard, eine
deutsche Künstlerinn, die mit vielem Erfolg ihre Neigung zur Mahlerey in
Wien und München zuerst ausgebildet hat, hat nach einem fünfmonatlichen
Aufenthalt in Rom auch hier die erste Probe ihres Talentes und Fleisses
gegeben in einem einfachgedachten historischem Bilde. Es stellt in einem
gothischen Dom die junge Euphrasia vor, welche von ihrer Mutter in ein
Kloster geführt war, und auf die Frage der Nonnen: Was ihr das Liebste sey?
– ein Kreuz umarmt. Der kindlichreine, innige, unschuldsvolle Blick des sich
an das Kreuz schmiegenden und hinaufsehenden kleinen Mädchens ist
vortrefflich dargestellt. Drey Nonnen in einer angenehmen Gruppe bezeugen
ihre freudige Verwunderung. Im nähern Grunde kniet die betende Mutter der
Euphrasia. Das Bild, das etwa 3 Fuß Breite und 4 Fuß Höhe hat, ist wohl
durchdacht, hat eine kräftige Farbe, und viele Harmonie. Es macht der
Künstlerinn doppelte Ehre, da sie selber die strengste Beurtheilerinn
desselben ist.“
Nach der Legende entstammte die heilige Euphrasia (380-410) einer vornehmen
Familie aus Konstantinopel. Nach dem Tod des Vaters zog sie mit ihrer Mutter
nach Ägypten, wo sie als siebenjähriges Kind in ein Kloster eintrat und dort
bereits im Alter von 30 Jahren starb.
G 11 Die heilige Elisabeth mit
dem Johannesknaben. 1812
Oel auf Leinwand
87,5 x 111,5 cm
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe,
Inv.-Nr. 508
In einem Brief der Künstlerin aus
Rom an Karl Friedrich Freiherr von Uexküll vom 22. November 1812 schreibt
sie, dass sie auf eine Pension aus Karlsruhe hoffe und weiter: „meine
Elisabetha schikte ich daher vor einem Monat nach“ Karlsruhe, dort wurde das
Gemälde laut einem Brief ihres Bruders vom 12. Januar 1813 dem Hof
übergeben.
Handschriftliches „Verzeichnis
derjenigen Kunstwerke, welche bei der vom hiesigen Kunst Verein
veranstalteten Kunst Ausstellung vom 12. bis 19. April 1818 im dem Museum
dahier ausgestellt wurden“ Nr. 2 (GLA Karlsruhe 69 Badischer Kunstverein/1)
Brief der
Künstlerin über abgelieferte Pflichtbilder für den Großherzoglichen Hof vom
24. Juni 1823
Friedrich von Bötticher,
Malerwerke des neunzehnten Jahrhunderts, Leipzig 1901, Bd. 2/1, S. 376,
Nr. 8
Karl Koelitz, Katalog der
Gemälde-Galerie. Staatliche Kunsthalle zu Karlsruhe, Karlsruhe 1920,
Inv.-Nr. 508, S. 94
Arthur
von Schneider, Die Förderung des Klassizismus durch den Badischen
Kunstverein, in: 1818-1968, Festschrift zum 150jährigen Jubiläum des
Badischen Kunstvereins Karlsruhe, Karlsruhe 1968, S. 43, Abb. 14
Jan Lauts und Werner Zimmermann,
Katalog neuere Meister 19. und 20. Jahrhundert, Staatliche Kunsthalle
Karlsruhe, Karlsruhe 1971, Bd. I, S. 193 und Bd. II, S. 333
Baden und Württemberg im Zeitalter
Napoleons, Ausst.-Kat. Württembergisches Landesmuseum Stuttgart,
Stuttgart-Bad Cannstatt 1987, Bd. 1.2, S. 680, Nr. 1175
Frauen im Aufbruch? Künstlerinnen
im deutschen Südwesten 1800-1945,
Ausst.-Kat. Städtische Galerie Karlsruhe und Städtische Galerie
Villingen-Schwenningen 1995, S. 38
Horst Vey, Die frühen Jahre
der Karlsruher Kunsthalle, ihr erster Direktor, Hofmaler Becker und das
Inventar von 1823, in: Jahrbuch der Staatlichen Kunstsammlungen in
Baden-Württemberg, Bd. 41, 2004, Inv.-Nr. 370, S. 138

Die heilige Elisabeth mit dem
Johannesknaben.
© Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, Inv.-Nr. 508
G 12 Junge Römerin
(Selbstbildnis?). Um 1812
(laut Familientradition der
Vorbesitzer, bei denen es sich um Verwandtschaft von Sophie Reinhard
handelt, wurde das Gemälde als „Bildnis einer jungen Römerin“ betitelt)
Oel auf Leinwand auf Holz
69 x 55,4 cm
Signiert u. r. „SR
(verschlungen)“
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe,
Inv.-Nr. 2645
Jahrbuch der Staatlichen
Kunstsammlungen in Baden-Württemberg, Bd. 15, 1978, Abb. 3, S. 99 und dem
Text S. 100 „Junge Römerin (oder Selbstbildnis?)“ „Der Titel des Bildes geht
auf die Familienüberlieferung zurück. Es könnte auch ein Selbstbildnis
Sophie Reinhards sein; die Hand mit dem Zeichenstift ist im
spiegelbildlichen Sinne als rechte Hand, als Malhand, zu verstehen.“
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe
(Hrsg.), Neuerwerbungen für die Gemäldegalerie 1972-1984, Karlsruhe
1984, S. 74, Abb. Nr. 39
Frauen im Aufbruch?
Künstlerinnen im deutschen Südwesten 1800-1945,
Ausst.-Kat. Städtische Galerie Karlsruhe und Städtische Galerie
Villingen-Schwenningen 1995, S. 237
Zwischen Ideal und
Wirklichkeit – Künstlerinnen der Goethe-Zeit zwischen 1750 und 1850,
herausgegeben von Bärbel Kovalevski, Ausst.-Kat. Schlossmuseum Gotha und
Rosgartenmuseum Konstanz, Ostfildern-Ruit 1999, A 13, S. 291
Katrin Seibert, Rom besuchen –
Italienreisen deutscher Künstlerinnen zwischen 1750 und 1850, München
2009, Bd. 1, S. 238, Bd. 2, S. 187, Abb. 199 (Katrin Seibert vermutet, dass
es sich bei der Dargestellten um die italienische Malerfreundin Bianca
Milesi handelt, was nicht unbegründet zu sein scheint.)
Frederico Piscopo hat in seiner
Monographie Bianca Milesi arte e patria nella Milano risorgimentale
S, 44 ff und S. 57 aufgezeigt, dass die "Junge Römerin" ein Portrait der
Bianca Milesi wiedergibt. Seine Argumentation beruht auf einem ebenfalls um
1812 entstandenen Portrait, welches Caspare Landi von ihr gemalt hat
und Bianca Milesi ebenfalls
als Malerin darstellt. Die Gesichtszüge in dem Portrait, welches Sophie
Reinhard von Bianca Milesi gemalt hat, sind der Dargestellten verblüffend
ähnlich (siehe auch: Francesca Romana Morelli
(Hersausgeberin), Faces3,
Galleria Carlo Virgilio, Catalogue
TEFAF Maastricht, March 7–15,
2020, auf Seite 28 enthält der Katalog als Nr. 11 das Gemälde von Caspare Landi).

Junge Römerin (Selbstbildnis?).
© Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, Inv.-Nr. 2645
G 13 Die heilige Margarethe.
Um 1813
Verbleib unbekannt
In einem Brief Friedrich Müllers
vom 24. Februar 1813 an Karl Friedrich Freiherr von Uexküll schreibt er aus
Rom: „Mad. Reinhard arbeitet gegenwärtig an einer Zusammensetzung oder
vielmehr Carton, zu einem Gemälde, welches die Heil. Margarethe im Gefängnis
vorstellt welche von Engeln besucht und gespeißt wird. Die Disposition ist
gefällig.“ Rolf Paulus und Gerhard Sauder (Hrsg.), Friedrich Müller
genannt Maler Müller, Werke und Briefe, Briefwechsel, Kritische Ausgabe,
Teil 2: Briefwechsel 1812-1825, Heidelberg 1998, S. 666.
G 14
Porträt einer jungen Dame. 1813
Miniatur auf Elfenbein
7,5 x 6,5 cm, oval, Goldreif
Signiert rechts unten „Reinhard/1813“
Privatbesitz
Auktionshaus Mehlis, 83. Auktion, 2016, Los 18

Portrait einer jungen Dame (Besitz E. Fecker)
G 15 Porträt von Johann Daniel
Haas. Um 1815
Mischtechnik
8,5 x 6,0 cm, oval
Signiert rechts mittig am Rand
„Reinhard“. Verso von fremder Hand bezeichnet „Johann Daniel
Haas/Urgroßvater von Fred Grimmel“
Privatbesitz
Johann Daniel Haas (1780-1849),
Tabakfabrikant aus Dillenburg, verheiratet mit Elisabeth Penner (1791-1860)
aus Heidelberg (vergl. Hessische Biografie
http://www.lagis-hessen.de/de/subjects/idrec/sn/bio/id/3451 , Zugriff vom
19.12.2013)

Johann Daniel Haas,
Tabakfabrikant aus Dillenburg (Foto: E. Fecker)
G 16 Traum des Markgrafen Karl Wilhelm. 1816
Oel auf Holz
32 x 45 cm
Zähringer Bildnissammlung,
Inv.-Nr. K 232 (K für Karlsruher Schloss), vergl. Gerda Kircher,
Zähringer Bildnissammlung im neuen Schloss zu Baden-Baden, S. 189. Dort
als Pflichtbild bezeichnet.
Brief von Wilhelm Reinhard vom
28. Oktober 1816 an Karl Ludwig Großherzog von Baden und Antwortschreiben
des Großherzogs vom 28. Oktober 1816
Brief der
Künstlerin über abgelieferte Pflichtbilder für den Großherzoglichen Hof vom
24. Juni 1823
Horst Vey, Die frühen Jahre
der Karlsruher Kunsthalle, ihr erster Direktor, Hofmaler Becker und das
Inventar von 1823, in: Jahrbuch der Staatlichen Kunstsammlungen in
Baden-Württemberg, Bd. 41, 2004, Inv.-Nr. 282, S. 134
Wichtige Hinweise zu dem Gemälde
verdanke ich Herrn René Simmermacher, Staufen i. Br.
Von dem
Gemälde, dessen Verbleib unbekannt ist,
besitzt das Stadtarchiv Karlsruhe ein
Repro mit der
Signatur 8/PBS I / 0605 (ohne
Angabe des Künstlers).
Der
Malstil und der mehrfach von der Künstlerin in Gemälden dargestellte
Windhund, erlauben das Bildnis vom Traum des Markgrafen der Künstlerin
Sophie Reinhard mit großer Sicherheit zuzuschreiben. Ganz eindeutig ist aber
folgender Beweis: Wilhelm Reinhard schreibt im Auftrag seiner Schwester
Sophie Reinhard in dem oben erwähnten Brief vom 28. Oktober 1816 an Karl
Ludwig Großherzog von Baden: „Füglich soll ich wegen einer allenfallsigen
Erinnerung, daß Markgrav Karl Wilhelm sich nicht ähnlich sehe, die
unterthänigste Bemerkung beyfügen, daß sie zum Behuf dieser Ähnlichkeit
einen alten Ducaten als einzigen Leitstern gehabt habe." Zwei Exemplare
eines solchen Golddukaten aus dem Jahre 1721 besitzt das Badische
Landesmuseum (Inventarnummern MK 5171 und MK 5172), der auf der Schauseite
Karl Wilhelm mit einem kleinen gezwirbelten Schnauzbart wiedergibt, wie ihn
auch der im Gemälde dargestellte Markgraf trägt (vergl. die Abbildung bei
Oliver Sänger, Münz- und Geldwesen, Rheingold und Silberbergbau unter
Karl Wilhelm, in: Karl Wilhelm 1679-1738, Ausst.-Kat. Badisches
Landesmuseum Karlsruhe, München 2015, S. 197 sowie Kat. Nr. 172 und die
Beschreibung bei Johann Christian Sachs, Einleitung in die Geschichte der
Marggravschaft Baden, Fünfter Theil, Carlsruhe 1773, S. 158: „Die
fünfte, eine Ducate aus Rhein=Gold zeigt auf der Hauptseite des Marggraven
Bild mit kurzen Haaren und einem Schnautzbärtlein, welches man auf keiner
anderen Münze antrift“). Da es einzig den Golddukaten von 1721 gibt, auf dem
der Markgraf mit einem Schnauzbart dargestellt ist, kann sich der Hinweis in
dem Brief von Wilhelm Reinhard an den Großherzog Karl Ludwig nur auf diesen
Golddukaten von 1721 beziehen, den die Künstlerin als Vorlage für ihr
Gemälde gewählt hat. Nur sie hat diese Vorlage zweifellos verwandt, denn
andere Darstellungen von Markgraf Karl Wilhelm, die uns heute wohlbekannt
sind, standen Sophie Reinhard laut ihrer eigenen Aussage als Vorlage nicht
zur Verfügung.

Traum des Markgrafen Karl Wilhelm
(Foto: Archiv René Simmermacher)
G 17 Tod der Katharina von
Siena. Um 1817
Oel auf Leinwand
Kriegsverlust 1944
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe,
Inv.-Nr. 1562
Brief der
Künstlerin über abgelieferte Pflichtbilder für den Großherzoglichen Hof vom
24. Juni 1823
Jan Lauts und Werner Zimmermann,
Katalog neuere Meister 19. und 20. Jahrhundert, Staatliche Kunsthalle
Karlsruhe, Karlsruhe 1971, Bd. I, S. 346
Horst Vey, Die frühen Jahre
der Karlsruher Kunsthalle, ihr erster Direktor, Hofmaler Becker und das
Inventar von 1823, in: Jahrbuch der Staatlichen Kunstsammlungen in
Baden-Württemberg, Bd. 41, 2004, Inv.-Nr. 374, S. 138
Handschriftliches „Verzeichnis
derjenigen Kunstwerke, welche bei der vom hiesigen Kunst Verein
veranstalteten Kunst Ausstellung vom 12. bis 19. April 1818 im dem Museum
dahier ausgestellt wurden“, Nr. 1 (GLA Karlsruhe Bestand 69 Badischer Kunstverein/1)
G 18 Heilige Cäcilia. Um 1819
Oelgemälde
Verbleib unbekannt
Ludwig Schorn, Morgenblatt für
gebildete Stände/Kunstblatt,
Tübingen 1819, S. 20: „Demoiselle Reinhardt hat, vor einiger Zeit, eine
heilige Cäcilie in Oel vollendet, ein Bild von kleiner Dimension aber
unsäglicher Anmuth. Es ist lebendig aus einem zarten Gemüth hervorgegangen.
Die schöne blühende Jungfrau hat einen Kranz von Astern um das Haupt, und
blickt fromm und demüthig zum Himmel.“
Friedrich von Bötticher,
Malerwerke des neunzehnten Jahrhunderts, Leipzig 1901, Bd. 2/1, S. 376,
Nr. 1
G 19 Die heilige Cäcilie.
Kniestück. 1821
Oel auf Leinwand
73 x 61 cm
Signiert und datiert u. r. „SR
(verschlungen)/1821“
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe,
Inv.-Nr. 2644
Kunst- und Industrie-Ausstellung
Karlsruhe 1821, Katalog Teil I, No. 4
Joseph von Hormayr, Miscellen,
in: Archiv für Geographie, Historie, Staats- und Kriegskunst, Bd. 13, 1822,
S. 232
Brief der
Künstlerin über abgelieferte Pflichtbilder für den Großherzoglichen Hof vom
24. Juni 1823
Friedrich von Bötticher,
Malerwerke des neunzehnten Jahrhunderts, Leipzig 1901, Bd. 2/1, S. 376,
Nr. 2
Jahrbuch der Staatlichen
Kunstsammlungen in Baden-Württemberg, Bd. 15, 1978, S. 100
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe
(Hrsg.), Neuerwerbungen für die Gemäldegalerie 1972-1984, Karlsruhe
1984, S. 74, Abb. Nr. 40
Frauen im Aufbruch? Künstlerinnen
im deutschen Südwesten 1800-1945,
Ausst.-Kat. Städtische Galerie Karlsruhe und Städtische Galerie
Villingen-Schwenningen 1995, S. 236
Zwischen Ideal und Wirklichkeit –
Künstlerinnen der Goethe-Zeit zwischen 1750 und 1850,
hrsg. Bärbel Kovalevski, Ausst.-Kat. Schlossmuseum Gotha und Rosgartenmuseum
Konstanz, Ostfildern-Ruit 1999, F 25, S. 181
G 20
Porträt von Karl Hengstenberg.
1822
Miniatur
7,0 x 7,0 cm
Signiert rechts unten
„Reinhard/..22“. Verso von fremder Hand bezeichnet „Karl
Hengstenberg,/ Apotheker in Ronsdorf/ geb. 19.
September 1797 in Ratingen,/ gest. 3. März 1875 in Düsseldorf/
verh. 18. Dezember 1821/ (dieses Bild wahrscheinlich um 1821)"
Privatbesitz
Karl Hengstenberg (1797-1875) war verheiratet mit
Klara Wilhelmine Melbeck (1792-1867)
aus Elberfeld, von der eine unsignierte Miniatur (wohl von gleicher Hand)
vorhanden ist.
Ob diese Miniatur tatsächlich von
Sophie Reinhard gemalt wurde, lässt sich nicht mit vollkommener Sicherheit sagen.

Karl Hengstenberg, Apotheker in
Ronsdorf (Foto
© des Privatbesitzers)
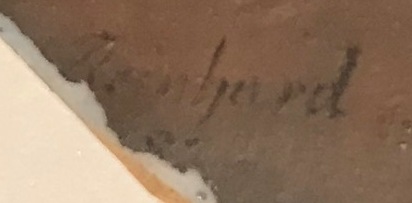
G 21 Markgräfin Anna von
Baden-Durlach (1540-1586) verteilt Almosen an Arme und Kranke. Um 1823
Oel auf Leinwand
60,3 x 53 cm
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe,
Inv.-Nr. 2428
Kunst- und Industrie-Ausstellung
Karlsruhe 1823, Katalog Nr. 9
Die Kunst- und
Industrie-Ausstellung in Karlsruhe im Mai 1823,
in Ludwig
Schorn, Kunstblatt, 4. Jg., Tübingen 1823, S. 193
In einem
Brief der Künstlerin über abgelieferte Pflichtbilder für den
Großherzoglichen Hof vom 24. Juni 1823 heißt es zu diesem Gemälde: „wartet
zu gleicher Bestimmung lediglich auf gehörige Empfänglichkeit für den
Oelfirniß.“
Friedrich von Bötticher,
Malerwerke des neunzehnten Jahrhunderts, Leipzig 1901, Bd. 2/1, S. 376,
Nr. 3
Jan Lauts und Werner Zimmermann,
Katalog neuere Meister 19. und 20. Jahrhundert, Staatliche Kunsthalle
Karlsruhe, Karlsruhe 1971, Bd. I, S. 193 und Bd. II, S. 333
Kunst in der Residenz – Karlsruhe
zwischen Rokoko und Moderne,
hrsg. Siegmar Holsten, Ausst.-Kat. Staatliche Kunsthalle Karlsruhe,
Heidelberg 1990, S. 114, Nr. 26
Zwischen Ideal und Wirklichkeit –
Künstlerinnen der Goethe-Zeit zwischen 1750 und 1850,
hrsg. Bärbel Kovalevski, Ausst.-Kat. Schlossmuseum Gotha und Rosgartenmuseum
Konstanz, Ostfildern-Ruit 1999, F 26, S. 201

Markgräfin Anna von Baden verteilt
Almosen an Arme und Kranke (Foto:
Archiv
René Simmermacher)
G 22 Beruhigung. An Frida. Um
1823
Oel auf Leinwand
Verbleib unbekannt
Kunst- und Industrie-Ausstellung
Karlsruhe 1823, Katalog Nr. 11
Ludwig Schorn, Kunstblatt, 4. Jg.
Tübingen 1823, S.
193f. (Komposition nach dem Gedicht „Beruhigung. An Frida“ von Aloys
Schreiber in: Cornelia. Taschenbuch für Deutsche Frauen auf das Jahr 1823,
Heidelberg, S. 30f.). Zu dem Gemälde, dessen Idee auf den letzten beiden
Versen des Gedichtes beruht:
„Mag im Strom versinken alles
Leben,
Gottes Geist wird auf den Wassern
schweben.“
führt Schorn weiter aus: „Die
Ruhe und Ergebung in der weiblichen Gestalt macht mit der furchtbaren,
schauerlichen Umgebung einen bedeutungsvollen Kontrast, und auch das Kolorit
ist in diesem Sinne gewählt.“
Karl Nehrlich, Ueber die
Kunst- und Industrie-Ausstellung für das Großherzogthum Baden von 1823 in
Karlsruhe, Karlsruhe, 1823, S. 7 schreibt dazu: „Leicht hingeworfen,
doch in seiner Einfachheit bedeutend. Der Hauptton ist zu violet.“
G 23 Die Heilige Familie mit
Anna und dem Jesusknaben. 1825
Oel auf Leinwand
92,5 x 74 cm
Signiert und datiert unten auf
dem Stein „SR (verschlungen) 1825“
Kunst- und
Industrie-Ausstellung Karlsruhe 1825, Katalog Nr. 35
Friedrich von Bötticher,
Malerwerke des neunzehnten Jahrhunderts, Leipzig 1901, Bd. 2/1, S. 376,
Nr. 4
Van Ham, 258. Auktion "Alte
Kunst", 15. November 2007, Los 1115

Die Heilige Familie mit Anna und
dem Jesusknaben.
© Foto: VAN HAM Kunstauktionen / Saša Fuis
G 24 Markgraf Christoph I. von
Baden (1453-1527) empfängt Gesandte Kaiser Maximilians. 1825
Oel auf Leinwand
140 x 109,5 cm
Signiert und datiert unten Mitte
„SR (verschlungen) 1825“
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe,
Inv.-Nr. 2429
Kunst- und Industrieausstellung
Karlsruhe 1825, Katalog Nr. 50
Jan Lauts und Werner Zimmermann,
Katalog neuere Meister 19. und 20. Jahrhundert, Staatliche Kunsthalle
Karlsruhe, Karlsruhe 1971, Bd. I, S. 193 und Bd. II, S. 334

Markgraf Christoph von Baden
empfängt Gesandte Kaiser Maximilians (Foto:
Archiv
René Simmermacher)
G 25 Bettelmönche von der
Insel Ischia. Um 1827
Oel auf Leinwand
Verbleib unbekannt
Kunst- und Industrieausstellung
Karlsruhe 1827, Katalog Nr. 9
G 26 Ein Kind in einer
Landschaft. 1827
Oel auf Leinwand
100 x 77 cm
Signiert und datiert u. li.: „SR
(verschlungen) 1827“
Privatbesitz
Kunst- und Industrieausstellung
Karlsruhe 1827, Katalog Nr. 29
G 27
Ruth in einer
Landschaft. Um 1827
Oel auf Leinwand
Verbleib unbekannt
Kunst- und Industrieausstellung
Karlsruhe 1827, Katalog Nr. 76
Albrecht Adam, Aus dem Leben
eines Schlachtenmalers, Selbstbiographie nebst einem Anhange,
herausgegeben von Hyazinth Holland, Stuttgart 1886, S. 38
Friedrich von Bötticher,
Malerwerke des neunzehnten Jahrhunderts, Leipzig 1901, Bd. 2/1, S. 376,
Nr. 5
G 28 Conradin von Schwaben und
Friedrich von Österreich. Um 1827
Oel auf Leinwand
Verbleib unbekannt
Kunst- und Industrieausstellung
Karlsruhe 1827, Katalog Nr. 160
Friedrich von Bötticher,
Malerwerke des neunzehnten Jahrhunderts, Leipzig 1901, Bd. 2/1, S. 376,
Nr. 6
G 29 Tod des
Torquato Tasso. 1828
Oel auf Leinwand
121 x 160,5 cm
Signiert und datiert unten auf
dem Stein „SR (verschlungen) 1828“
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe,
Inv.-Nr. 1744
Übernommen 1937 aus der
Gemälde-Galerie Mannheim
Kunst- und Industrieausstellung
Karlsruhe 1829, Katalog Nr. 26
Ludwig Schorn, Kunstblatt,
11. Jg., Tübingen 1830, S. 45
Friedrich von Bötticher,
Malerwerke des neunzehnten Jahrhunderts, Leipzig 1901, Bd. 2/1, S. 376,
Nr. 9
Jan Lauts und Werner Zimmermann,
Katalog neuere Meister 19. und 20. Jahrhundert, Staatliche Kunsthalle
Karlsruhe, Karlsruhe 1971, Bd. I, S. 194 und Bd. II, S. 334
Achim Aurnhammer, Christina
Florack-Kröll, Dieter Martin, Torquato Tasso in Deutschland,
Gedenkausstellung zum 400. Todestag (25. April 1995) im Goethe-Museum
Düsseldorf, Heidelberg 1995, S. 12 und Tafel 3
Hubertus Kohle, Das Tassobild
der deutschen Malerei des 19. Jahrhunderts, in: Achim Aurnhammer
(Hrsg.), Torquato Tasso in Deutschland, Berlin 1995, nach S. 316,
Abb. 9

Tod des Torquato
Tasso.
© Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, Inv.-Nr. 1744
G 30 Pifferari vor einem
Madonnenbild. Um 1829
Oel auf Leinwand
Verbleib unbekannt
Kunst- und Industrieausstellung
Karlsruhe 1829, Katalog Nr. 30
Ludwig Schorn, Kunstblatt,
11. Jg., Tübingen 1830, S. 46
G 31 Johannes Evangelista. Um
1829
Oel auf Leinwand
Verbleib unbekannt
Kunst- und Industrieausstellung
Karlsruhe 1829, Katalog Nr. 53
Ludwig Schorn,
Kunstblatt, 11. Jg., Tübingen 1830, S. 45
G 32 Die heilige Maria. Um
1829
Oel auf Leinwand
Verbleib unbekannt
Kunst- und Industrieausstellung
Karlsruhe 1829, Katalog Nr. 54
Ludwig Schorn,
Kunstblatt, 11. Jg., Tübingen 1830, S. 45
Zeitlich nicht einzuordnende
Gemälde
G 33 König Artus’ Tafelrunde.
Oel auf Blech
25 x 22,5 cm
unbezeichnet
Münchner Privatbesitz (1975)
Eugen von Philippovich,
Antje Middeldorf-Kosegarten, Johanna Felmayer-Brunswik, Feder, in:
Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte, Bd.
VII (1979), Sp. 916–967; RDK Labor, URL:
http://www.rdklabor.de/w/?oldid=95622
Aus Karlsruher
Privatbesitz, Gemälde Aquarelle Zeichnungen 1790-1940,
Ausst.-Kat. Badischer Kunstverein Karlsruhe, Karlsruhe 1961, Nr. 139 „Das
Rittermahl“. Leihgeber Herr Konservator Philipp Herrmann (siehe GLA
Karlsruhe Bestand 69 Badischer Kunstverein, Zugang 1999-19 Nr. 38. Das
Gemälde wird dort als „Das Verlobungsmahl“ tituliert).
G 34
Reiches Früchtestillleben mit Prunkkanne
Oel auf Leinwand
65,0 x 85,0 cm
Bezeichnet unten links
„Reinhard“
Schuler, Auktion 107, 10. Dezember 2007, Los
4356 A
Dobiaschofsky, Auktion 21. Mai 2008, Los 906,
Sophie Reinhard zugeschrieben, was jedoch zweifelhaft ist.
G 35 Bildnis einer jungen
Frau.
Oel, auf Holz aufgezogen
57,5 x 47,5 cm
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe,
Inv.-Nr. 2646
Jahrbuch der Staatlichen
Kunstsammlungen in Baden-Württemberg, Bd. 15, 1978, S. 100
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe
(Hrsg.), Neuerwerbungen für die Gemäldegalerie 1972-1984, Karlsruhe
1984, S. 74, Abb. Nr. 41
G 36 Bildnis einer alten Dame.
Pastell auf Papier
52,2 x 39,8 cm
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe,
Inv.-Nr. 2650
Jahrbuch der Staatlichen
Kunstsammlungen in Baden-Württemberg, Bd. 15, 1978, S. 101
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe
(Hrsg.), Neuerwerbungen für die Gemäldegalerie 1972-1984, Karlsruhe
1984, S. 74, Abb. Nr. 45
Gemälde und Zeichnungen nach
anderen Meistern
GK 1 Büste des Heiligen Joseph
nach Jan van Eyck. Um 1808
Zeichnung nach dem Oelgemälde in
München
11,8 x 11,2 cm (5 Zoll x 4 Zoll 9
Linien, sächsisch)
Verbleib unbekannt
Gottlieb Abraham Frenzel,
Die Kunstsammlung des Freiherrn C. F. L. F
von Rumohr, Öffentliche Versteigerung Dresden den 19. October 1846 durch
Robert Julius Köhler,
Lübeck 1846, Los 3764
Zeichnungen
Z 1 Profilbildnis eines
Knaben. Um 1800
Schwarze, braune und weiße Kreide
auf Pergament
22,6 x 18,1 cm
Bez. Rs.: Wohnlich v. der Sophie
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe,
Inv.-Nr. 1969-8
Rudolf Theilmann und Edith
Ammann, Die deutschen Zeichnungen des 19. Jahrhunderts, Staatliche
Kunsthalle Karlsruhe, Karlsruhe 1978, S. 450, Nr. 2897
Rudolf Theilmann und Edith
Ammann, Die deutschen Zeichnungen des 19. Jahrhunderts, Abbildungen,
Karlsruhe 1978, S. 417
Bei dem
Dargestellten dürfte es sich um einen der Söhne des Hofrates Benjamin
Christoph Wohnlich (1766-1814) handeln, vielleicht um Carl August Wohnlich,
geboren am 11. Juli 1789 (vergl. Fritz Hirsch, 100 Jahre Bauen und
Schauen, Karlsruhe 1928, Bd. II, S. 418).
Z 2 Brustbildnis einer
Elsässerin im Oval, im Dreiviertelprofil nach links gewendet (Kopie nach Ph.
J. Becker). Um 1800
Pinsel in Sepia und Grau über
Bleistift auf gräulich-weißlichem Papier mit Wz.: HONIG/&/ZOONEN
18,5 x 14,7 cm
Bez. Rs.: Elßaßerin/Kopie nach
Becker von Soph. Reinhard/Becker war Sofiens - maler - Lehrer
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe,
Inv.-Nr. 1969-9
Rudolf Theilmann und Edith
Ammann, Die deutschen Zeichnungen des 19. Jahrhunderts, Staatliche
Kunsthalle Karlsruhe, Karlsruhe 1978, S. 450, Nr. 2898
Rudolf Theilmann und Edith
Ammann, Die deutschen Zeichnungen des 19. Jahrhunderts, Abbildungen,
Karlsruhe 1978, S. 417
Z 3 Brustbildnis eines
englischen Stubenmädchens im Oval. Im Profil nach linke gewendet. Um 1800
Pinsel in Sepia über Bleistift
auf elfenbeinfarbenem Papier
17,5 x 13,4 cm
Bez. Rs.: Englisches
Stubenmädchen
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe,
Inv.-Nr. 1969-10
Rudolf Theilmann und Edith
Ammann, Die deutschen Zeichnungen des 19. Jahrhunderts, Staatliche
Kunsthalle Karlsruhe, Karlsruhe 1978, S. 450, Nr. 2899
Rudolf Theilmann und Edith
Ammann, Die deutschen Zeichnungen des 19. Jahrhunderts, Abbildungen,
Karlsruhe 1978, S. 417
Z 4 Carl Reinhard (geb.
1780), Bruder der Künstlerin, Brustbild nach links. Um 1800
darunter:
Sinkendes Schiff, am Ufer ein Anker. Um 1808
Portrait und Schiff sind auf ein
größeres Papierblatt untereinander geklebt und beiderseits mit einer
Bambuspflanze in Grisaillemalerei gerahmt.
Pinsel in Aquarell- und
Deckfarben auf weißlichem Papier
26,3 x 21,3 cm
Portrait 20,1 x 21,3 cm
Sinkendes Schiff 4,6 x 14,4 cm
„Der Dargestellte ging als
Kaufmann nach St. Thomas (Westindien) und ist 1807 oder 1808 auf See
verschollen. Auf seinen Tod bezieht sich die untere Darstellung mit dem
Schiffbruch. Sie wurde, zusammen mit dem sicher früher nach dem lebenden
Modell entstandenen Portrait, auf ein größeres Blatt geklebt“ (siehe
Jahrbuch der Staatlichen Kunstsammlungen in
Baden-Württemberg, Bd. 15, 1978, S. 119f. und Abb. 20)
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe,
Inv.-Nr. 1977-10
Carl Friedrich Reinhard, wurde am
16. April 1780 als zweitältester Sohn des Maximilian und der Jacobina
Reinhard in Birkenfeld geboren und ertrank um 1807 bei einem
Schiffbruch in der Karibik. Er war im März 1800 mit einem
Empfehlungsschreiben des Markgrafen Carl Friedrich an den königl. dänischen
Vice-General-Gouverneur Obrist von Mühlenfels nach der damals dänischen
Karibikinsel St. Thomas abgereist, um als Handlungsbedienter im Hause des
Bremer Kaufmanns Heinrich Rötgers tätig zu werden (GLA Karlsruhe Bestand 233
Nr. 959). Heinrich Rötgers wurde im Februar 1804 zum Konsul seiner Majestät
des Königs von Preußen für St. Thomas in Westindien ernannt (zu
Heinrich Rötgers siehe die Biographie in: Karl H. Schwebel, Bremer
Kaufleute in den Freihäfen der Karibik. Von den Anfängen des Bremer
Überseehandels bis 1815, Veröffentlichungen aus dem Staatsarchiv der
Freien Hansestadt Bremen, hrsg. v. Adolf E. Hofmeister, Bd. 59, 1995, S.
251)
Z 5 Maximilian Wilhelm
Reinhard (geb. 1748), Vater der Künstlerin, Brustbild, leicht nach rechts
gewandt. Um 1806
Pinsel in Aquarell- und
Deckfarben auf weißlichem Papier
20,5 x 17,1 cm
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe,
Inv.-Nr. 1977-7
Jahrbuch der Staatlichen Kunstsammlungen in Baden-Württemberg, Bd. 15, 1978, S.
119
Z 6 Margarete Geiger beim
Malen in Schleißheim. 1807
Aquarell
10,5 x 8 cm
Privatbesitz Schweinfurt
Rückseitig bezeichnet: [Hi]er
überschickt Ihnen die Freundin S. R. das Portrait (welches aber nicht
gleicht) von Margarethe Geiger; ‒ wäre es nicht möglich daß ich als Gegen
Geschenk das Bild von Catharine G erhielte? Sey es in dem sie den Bloksberg
auf dem Besen besucht, oder als Schöpferin der kindlichen Scizzen.
Sophie R.
Margarete Geiger, Briefe der
Malerin aus Würzburg, Bamberg, München und Wien an ihre Familie in
Schweinfurt 1804-1809, Einführung Erich Schneider. Hrsg. Friederike
Kotouč, Schweinfurter Museumsschriften, 12/1987, Nürnberg 1987, S. 114
Bettina Baumgärtel, „…ihr
werten Frauenzimmer, auf!“, Malerinnen der Aufklärung, Ausst.-Kat.
Roseliushaus Bremen, Bremen 1993, Abb. 10, S. 39
Zwischen Ideal und Wirklichkeit –
Künstlerinnen der Goethe-Zeit zwischen 1750 und 1850,
hrsg. Bärbel Kovalevski, Ausst.-Kat. Schlossmuseum Gotha und Rosgartenmuseum
Konstanz, Ostfildern-Ruit 1999, D 13, S. 134

Margarete Geiger beim Malen in
Schleißheim.
Aquarell von Sophie Reinhard,
1807.
Privatbesitz Schweinfurt
Z 7 Selbstbildnis. Um 1809
Schwarze und rote Kreide auf
Pergament
12,1 x 9,0 cm
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe,
Inv.-Nr. 1977-5
Katrin Seibert, Rom besuchen –
Italienreisen deutscher Künstlerinnen zwischen 1750 und 1850, München
2009, Bd. 2, S. 78, Abb. 208
Jutta Assel und Georg Jäger,
Johann Peter Hebel, Alemannische
Gedichte. Illustriert von Julius Nisle und Sophie Reinhard,
Oktober 2013
http://www.goethezeitportal.de/fileadmin/Images/db/wiss/bildende_kunst/illustrationen/hebel/alemannische_gedichte_nisle/Reinhard_Selbstbildnis__300x396_.jpg
Zugriff vom 11. Oktober 2013
Z 8 Maximilian Wilhelm
Reinhard (geb. 1748), Vater der Künstlerin, ganze Figur nach links an einem
Tisch sitzend. Um 1810
Deckfarben auf dünnem Karton
34,2 x 26,2 cm
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe,
Inv.-Nr. 1977-6
Jahrbuch der Staatlichen Kunstsammlungen in Baden-Württemberg, Bd. 15, 1978, S.
119
Z 9 Ottilie mit totem Kind
im Kahn. 1810
Schwarze Kreide auf Tonpapier
30,8 x 40,2 cm
Signiert unten links „Sophie
Reinhard.“ Rechts unten von Sophie Reinhard bezeichnet „– zum ersten
mahl drückte sie ein Lebendiges/an ihre nakte reine Brust, ach! und kein
Lebendiges/Göthes Wahlverwandschaften“
Klassik Stiftung Weimar,
Museen/Inv.-Nr. KK 7245
Zwischen Ideal und Wirklichkeit –
Künstlerinnen der Goethe-Zeit zwischen 1750 und 1850,
hrsg. Bärbel Kovalevski, Ausst.-Kat. Schlossmuseum Gotha und Rosgartenmuseum
Konstanz, Ostfildern-Ruit 1999, E 40, S. 135
Katrin Seibert, Rom besuchen –
Italienreisen deutscher Künstlerinnen zwischen 1750 und 1850, München
2009, Bd. 1, S. 243, Bd. 2, S. 192, Abb. 210
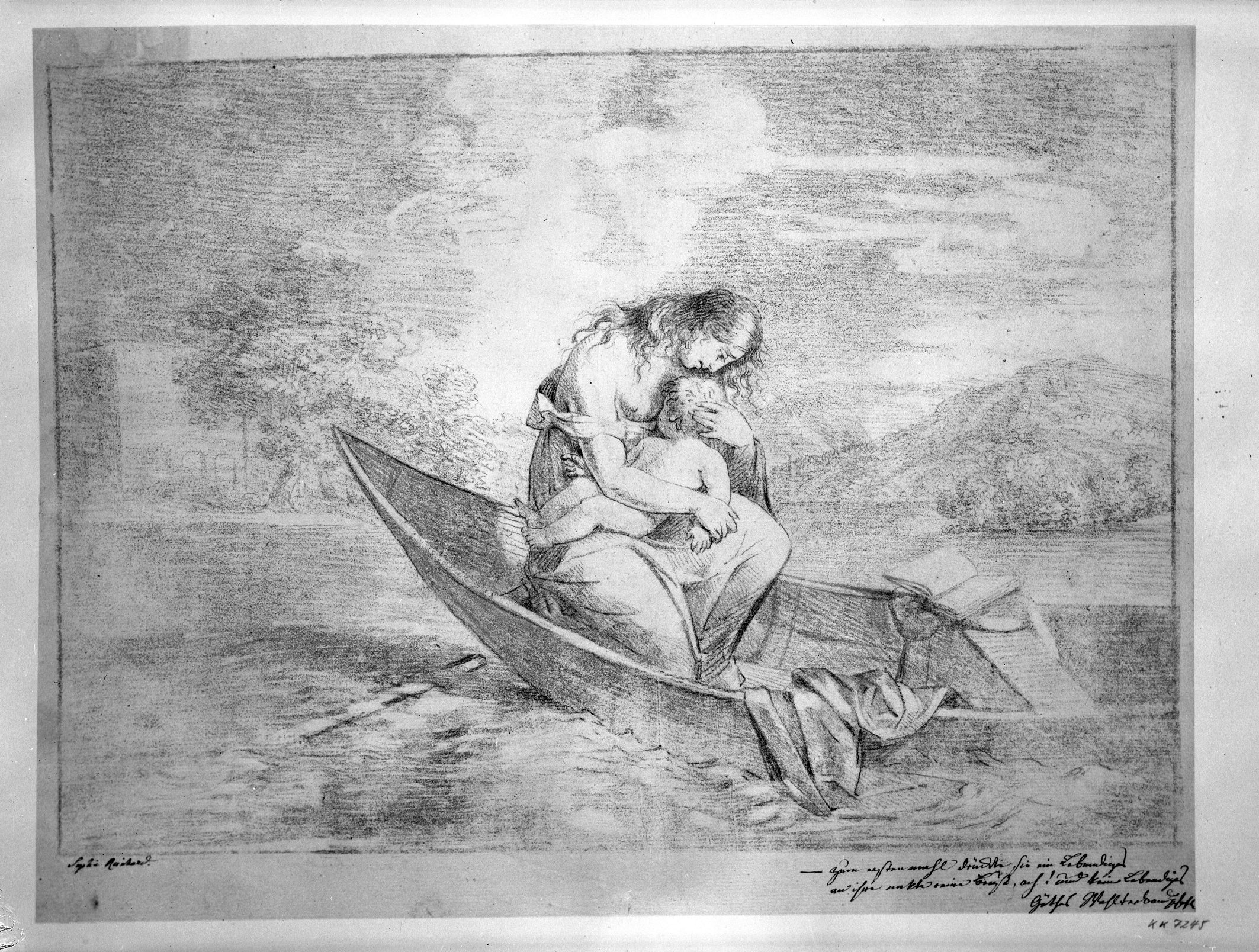
Ottilie mit totem Kind im Kahn.
Szene aus J. W. v. Goethes Wahlverwandtschaften.
Klassik Stiftung Weimar,
Museen/Inv.-Nr. KK 7245
Z 10 Ottilie auf dem
Totenbett. 1810
Schwarze Kreide auf Tonpapier
30,4 x 40,2 cm
Signiert unten links „Sophie
Reinhard.“ Rechts unten von Sophie Reinhard bezeichnet „Zärtliche Mütter
brachten zuerst heimlich/ihre Kinder, die von irgend einem Übel
behaftet/waren, Göthes Wahlverwandschaften“
Klassik Stiftung Weimar,
Museen/Inv.-Nr. KK 7244
Zwischen Ideal und Wirklichkeit –
Künstlerinnen der Goethe-Zeit zwischen 1750 und 1850,
hrsg. Bärbel Kovalevski, Ausst.-Kat. Schlossmuseum Gotha und Rosgartenmuseum
Konstanz, Ostfildern-Ruit 1999, E 39, S. 170
Katrin Seibert, Rom besuchen –
Italienreisen deutscher Künstlerinnen zwischen 1750 und 1850, München
2009, Bd. 1, S. 243, Bd. 2, S. 192, Abb. 209
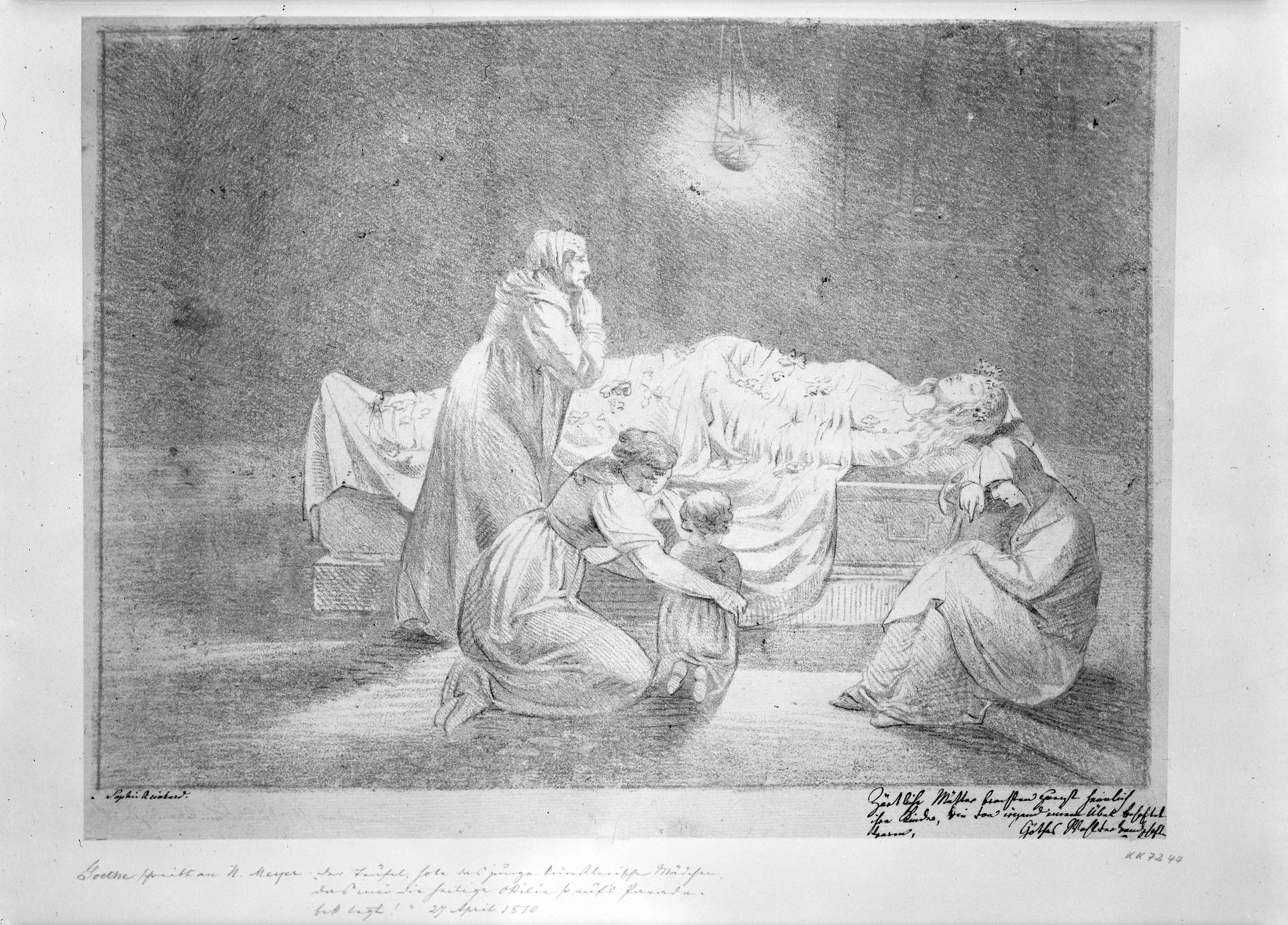
Ottilie auf dem Totenbett. Szene
aus J. W. v. Goethes Wahlverwandtschaften.
Klassik Stiftung Weimar,
Museen/Inv.-Nr. KK 7244
Z 11 Italienisches Mädchen
in Festtagstracht. Um
1810/1811
Aquarell über Bleistift
28,3 x 21,8 cm
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe,
Inv.-Nr. 1986-62
Sammlung Karl Friedrich Emrich
Freiherr von Uexküll-Gyllenband
Horst Vey, Die Sammlung des Freiherrn von Üxküll (1755-1832) und ihre
späteren Geschicke, in: Jahrbuch der Staatlichen Kunstsammlungen in
Baden-Württemberg, Bd. 42, 2005, S. 88
Katrin Seibert, Rom besuchen –
Italienreisen deutscher Künstlerinnen zwischen 1750 und 1850, München
2009, Bd. 1, S. 236, Bd. 2, S. 77 und 187, Abb. 200
Z 12 Italienisches
Skizzenbuch. Um 1813
48 elfenbeinfarbige
Zeichenblätter mit einem Wz.: Wappen mit bekröntem Adler, darunter: B.
19,8 x 26,0 (Skizzenbuch); 19,0 x
25,2 cm (Blätter)
Vorsatzblatt, leer, danach sind
die folgenden Blätter von 1 bis 47 durchnummeriert
Fol. 1 Verschiedene Pflanzen
zwischen Steinen
Fol. 1r weiß
Fol. 2 Betender Mönch
Bez. l. u.: nach der Natur
Fol. 2r weiß
Fol. 3 Lesender Mönch
Bez. r. u.: nach der Natur
Fol. 3r weiß
Fol. 4 Rechter und linker Ärmel
eines Kleides
Fol. 4r weiß
Fol. 5 Sitzende Frau nach links
(Kleiderärmel wie Fol. 4)
Fol. 5r weiß
Fol. 6 Sitzender rauchender Mann
Fol. 6r weiß
Fol. 7 Flöte spielender Hirte
Bez. auf dem Stein: Giovanni
Santalamaza/Capraro/18. anni/1813. Cacentione
Rechts daneben: Ziegenpelz
weiß/Stiefel u. Schuh schw./Capinal u. Hosen/blau.
Fol. 7r weiß
Fol. 8 Brunnen in Landschaft mit
Bäumen
Fol. 8r weiß
Fol. 9 Zwei Faltenstudien eines
Mantels
Fol. 9r weiß
Fol. 10 Blick auf eine
Häusergruppe in Rom
Bez. r. u.: Pallazzo Rospiliori/a
Roma
Fol. 10r weiß
Fol. 11 Zwei Portraits
Bez. l. u.: Marianna von Mez,
darunter in der Mitte: Portrait
Fol. 11r weiß
Fol. 12 Der Dom von Orvieto
Bez. r. u.: Duomo di Orvietto
Fol. 12r weiß
Fol. 13 Abtei in Orvieto
Bez. l. u.: Abtey zu Orvietto
Fol. 13r weiß
Fol. 14 Sitzender Christus mit
Kelch
Bez. r. u.: nach einer alten
Statue zu/Orvietto
Fol. 14r weiß
Fol. 15 Romantisches Gemäuer mit
Hirten bei Orvieto
Bez. r. u.: Abbatia vicino
d’orvietto
Fol. 15r weiß
Fol. 16 Umrisse zweier stehender
Männer
Fol. 16r weiß
Fol. 17 Bianca Milesi, auf einem
Esel reitend
Bez. u. r.: Bianca Milesi a
Somaro/d’al vero
(http://swbexpo.bsz-bw.de/skk/detail.jsf?id=E36A4E0B404F00F633FD8EB2077FF1F0&img=1
, Zugriff vom 05. Juni 2013)
Fol. 17r weiß
Fol. 18 Architekturkulisse mit
zwei Mönchen in Orvieto
Bez. r. u.: Cortile dei
Dominicani/a Orvietto
Fol. 18r weiß
Fol. 19 Ansicht eines Stadttores
in Orvieto und einer spinnenden Bäuerin
Bez. l. u.: Porta a Orvietto
Fol. 19r weiß
Fol. 20 Stadttor in Orvieto
Bez. l. u.: Porta della rocca a
Orvietto
Fol. 20r weiß
Fol. 21 Brustbild eines
männlichen Modells
Fol. 21r weiß
Fol. 22 Skizze eines knienden
Königs und einer Frau nach dem Fresko von Perugino im Oratorio di Santa
Maria dei Bianchi in Città della Pieve
Bez. u. Mitte: nach Pietro
Perugino
Fol. 22r weiß
Fol. 23 Skizzen eines knienden
Königs und des heiligen Joseph nach dem Fresko von Perugino im Oratorio di
Santa Maria dei Bianchi in Città della Pieve
Bez. u. Mitte: nach P. Perugino
Fol. 23r weiß
Fol. 24 Portrait des Pietro
Perugino
Bez. r. u.: Pietro Perugino,
1504/Città della Piéve.
Fol. 24r weiß
Fol. 25 Eingang zur Chiesa di
Sant’ Agostino in Città della Pieve
Bez. r. u.: Madonna delle/vechi
chiusi fuori della/porta di St. Agostino di città/della Pieve.
dipinta di/P. Perugino.
Fol. 25r weiß
Fol. 26 Portrait eines bärtigen
Mannes
Fol. 26r weiß
Fol. 27 Sitzende Madonna mit
Jesuskind auf dem Schoß nach dem Fresko von Perugino im Oratorio di Santa
Maria dei Bianchi in Città della Pieve
Bez. u. Mitte: nach P. Perugino
Fol. 27r weiß
Fol. 28 Vaterhaus des Pietro
Perugino in Città della Pieve
Bez. r. u.: Casa Paterna di
Pietro Vannuci/detto Perugino, in città della/Pieve sua Patria.
Fol. 28r weiß
Fol. 29 Portal der Chiesa di Sant’
Agostino in Città della Pieve
Bez. r. u.: Porta di St.
Agostino/città della Pieve
Fol. 29r weiß
Fol. 30 Kastell in Orvieto
Bez. r. u.: Castello a Orvietto
Fol. 30r weiß
Fol. 31 Palazzo dei Papi in
Orvieto
Bez. r. u.: a Orvietto
Fol. 31r weiß
Fol. 32 Sechs Vogelstudien
Bez. r. u.: nach der Natur
Fol. 32r Durchzeichnung eines
Vogels
Fol. 33 Zeichnende Frau und
Brustbild eines Mannes
Bez. l. o.: ? Eißenlohr
Fol. 33r weiß
Fol. 34 Portrait einer Frau mit
gelocktem Haar
Bez. r. u.: nach Natur
Fol. 34r weiß
Fol. 35 Sitzende Frau von vorne
Fol. 35r weiß
Fol. 36 Betende vor einem Altar
mit Standbild des auferstandenen Christus’
Bez. r. u.: Composizion v. S R.
Fol. 36r weiß
Fol. 37 Cecha, Haushälterin bei
Bianca Milesi
Bez.: Signora Cecha/bonna della
Sca/Bianca
Fol. 37r weiß
Fol. 38 Epitaph für Martin
Rethausen auf dem Campo Teutonico in Rom
Bez. auf dem Stein: MARTIN/RETHA/USIN./LAUTENMACHER/AUS
SALZBURG/1542
Rechts daneben: Grabstein auf/dem
Schweizer/Gotsacker zu R.
Fol. 38r weiß
Fol. 39 Torbogen vor der Kirche
San Saba in Rom
Bez. r. u.: S. Saba. Roma
Fol. 39r weiß
Fol. 40 Frauenportrait
Bez. r. u.: nach Natur
Fol. 40r weiß
Fol. 41 Studie eines Baumes,
eines Hundes und ein Mädchenportrait
Fol. 41r weiß
Fol. 42 Kinderportrait
Fol. 42r weiß
Fol. 43 Sitzender Junge mit
übereinandergeschlagenen Beinen
Bez. r. u: nach Natur Roma
Fol. 43r weiß
Fol. 44 Portrait einer jungen
Frau
Fol. 44r weiß
Fol. 45 Pinie im Garten des
Palazzo Colonna in Rom
Bez. r. u.: Pigna im Garten
Collonna zu Rom
Fol. 45r weiß
Fol. 46 Sitzender Mann mit Hut
Fol. 46r weiß
Fol. 47 leer
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe,
Inv.-Nr. 1969-7
Auf dem vorderen Umschlagdeckel
ist ein Schildchen aufgeklebt mir dem von fremder Hand geschriebenen Text:
Sophia Reinhard’s/Röm. Skizzenbuch/v.
1813. Der vordere
Innendeckel des Skizzenbuches enthält folgenden von fremder Hand
geschriebenen Text: vermutl. 1813 s. Zeichnung „Capraro“/Skizzenbuch d.
Malerin/Sophia Carolina, Friderica, Petronella Reinhard – der
Schwester der Mutter meines Grossvater’s/Hauptmann
Max Eisenlohr/gezeichnet um 1813./Sophie Reinhard, die Erbauerin/des
Lindenstrass-Häuschens (Kriegsstr. 52)/im Jahr 1826 – s. Grundstein
daselbst./geb. 9. Juni 1775 zu Kirchberg/gest. 17. Dez 1844 zu Karlsruhe, B.
69 alt/Rob. Schnetzler. Herrsching/(Heimat Karlsruhe).
Die Skizzen und Zeichnungen
lassen den Schluss zu, dass das Skizzenbuch von der Künstlerin um 1811
begonnen wurde (am 20. Juni 1811 schreibt sie an Freiherr von Uexküll: „Die
nechste Woche gedenke ich nach Tivoli zu gehn, um einige Pflanzen zu
zeichnen“), ab Fol. 12 werden Eindrücke ihrer Reise im Juli 1813 zusammen
mit Bianca Milesi nach Orvieto und Città della Pieve, der Heimat Peruginos,
dargestellt, ab Fol. 32 zeichnet sie mehrmals römische Motive.
Rudolf Theilmann und Edith
Ammann, Die deutschen Zeichnungen des 19. Jahrhunderts, Staatliche
Kunsthalle Karlsruhe, Karlsruhe 1978, S. 451, Nr. 2902
Zwischen Ideal und Wirklichkeit –
Künstlerinnen der Goethe-Zeit zwischen 1750 und 1850,
herausgegeben von Bärbel Kovalevski, Ausst.-Kat. Schlossmuseum Gotha und Rosgartenmuseum
Konstanz, Ostfildern-Ruit 1999, Abb. 38, S. 75, G 25, S. 211
Joachim Rees, Lust und Last des Reisens,
Kunst- und reisesoziologische Anmerkungen zu Italienaufenthalten deutscher
Maler 1770-1838, in: Frank Büttner und Herbert W. Rott (Hrsg.),
Kennst Du das Land. Italienbilder der Goethezeit, Ausst.-Kat. Neue
Pinakothek München, München und Köln 2005, S. 73, Abb. 8
Katrin Seibert, Rom besuchen –
Italienreisen deutscher Künstlerinnen zwischen 1750 und 1850, München
2009, Bd. 2, S. 77 und 189, Abb. 203 und 204, S. 190, Abb. 205 und 206, S.
191, Abb. 207
Viaggio
in Italia, Künstler auf Reisen 1770-1880,
Ausst.-Kat. Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, Karlsruhe 2010, Nr. 17, S. 105
Z 13 Kindliche
Treue. Die Flucht
des Caspar Maler von Pforzheim nach Landau. 1818
Zeichnung
Stadtarchiv Pforzheim (laut
Schreiben vom 14.07.2015 dort nicht mehr auffindbar)
Es ist zu
vermuten, dass diese Zeichnung als Kupferstich im Taschenbuch „Rheinblüten“
erscheinen sollte. Vielleicht verzögerte sich die Fertigstellung der
Zeichnung durch die Reise von Sophie Reinhard mit Bianca Milesi im Frühjahr
1818 nach Ungarn. Jedenfalls erschien tatsächlich im 1. Jahrgang, der von
Friederike Robert herausgegebenen „Rheinblüten“, zu der Geschichte
„Kindliche Treue“ ein Kupferstich, gezeichnet von Joseph Peroux, gestochen
von Aloys Kessler. Verlegt wurden die „Rheinblüten“ seit 1819 von Gottlieb Braun,
dem Bruder der Herausgeberin, in Karlsruhe.
Für den 2. Jahrgang der
„Rheinblüten“ fertigte Sophie Reinhard dann die Zeichnung zu dem Kupferstich
„Adolph von Nassau“.
Hadwig Hoffmann, Die
Familien-Stipendien-Stiftungen der Familie Maler in Baden, in: Archiv
für Sippenforschung, 51. Jg., 1985, Heft 100, Abb. S. 285
„Caspar Maler
floh nach der von den Schweden verlorenen Schlacht von Nördlingen (6. 9.
1634) mit seiner Familie vor den kaiserlichen Truppen von Pforzheim nach
Landau in der Pfalz. Seine alte Mutter zog er auf einem Handkarren den
weiten Weg bis zum Rhein. … In seinem „Badischen Sagenbuch“ hielt Eduard
Brauer diese Flucht in Gedichtform fest und die Malerin Sophie Reinhardt
illustrierte sie mit Hilfe von alten Familienbildnissen.“
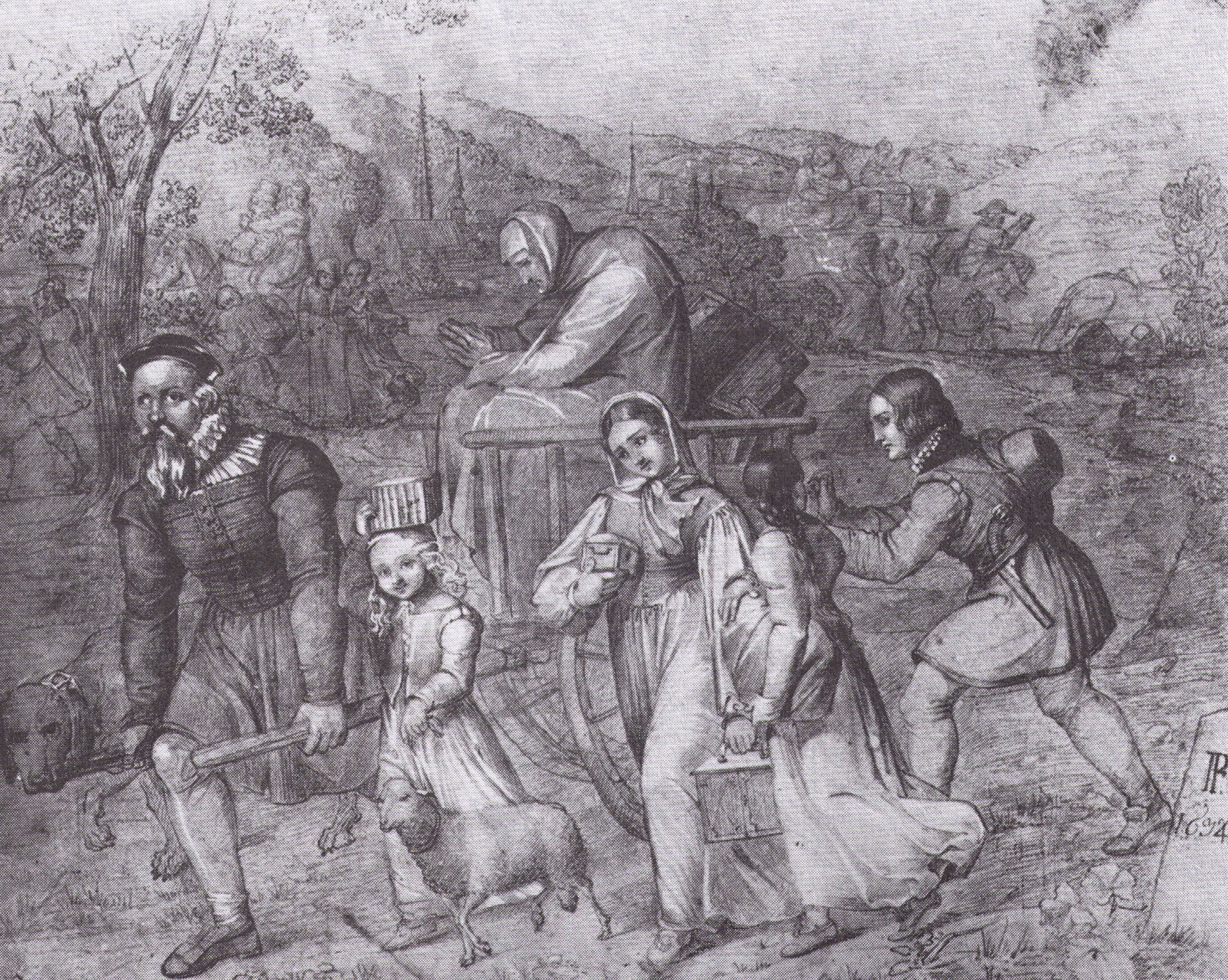
Die Flucht des Caspar Maler mit
seiner Familie von Pforzheim nach Landau.
Stadtarchiv Pforzheim (Foto: Karl
Deuchler, Pforzheim)
Z 14 Hans und Verene aus
Hebels Alemannischen Gedichten. Um 1820
Bleistift auf beigefarbenem
Papier mit Wz.: A F
26,6 x 22,0 cm
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe,
Inv.-Nr. VIII 2211
Rudolf Theilmann und Edith
Ammann, Die deutschen Zeichnungen des 19. Jahrhunderts, Staatliche
Kunsthalle Karlsruhe, Karlsruhe 1978, S. 451, Nr. 2901
Rudolf Theilmann und Edith
Ammann, Die deutschen Zeichnungen des 19. Jahrhunderts, Abbildungen,
Karlsruhe 1978, S. 417
Schwarzwaldbilder
–
Kunst des 19. Jahrhunderts,
Ausst.-Kat. Städtische Galerie Karlsruhe, Karlsruhe 2016, S. 227, Abb. 3, S.
38
Z 15 Die Häfnet-Jungfrau aus
Hebels Alemannischen Gedichten. Um 1820
Aquarell und Gouache
Verbleib unbekannt
Kunst- und Industrie-Ausstellung
Karlsruhe 1823, Katalog Nr. 65
Ludwig Schorn, Kunstblatt,
4. Jg., Tübingen 1823, S. 195: „Aus der
Hefnetjungfrau würde der treffliche Alemannische Sänger sein eignes Lied
wieder herausdichten können, wenn es sich auch in seinem Gedächtniß bis auf
die lezte Spur verwischt hätte. So muß man Poesie in Gestalt und Farbe
übersetzen.“
Archiv für Geschichte, Statistik,
Literatur und Kunst,
14. Jg., Wien 1823, S.116 („Trefflich hat sie in Gouache, „die
Häfnetjungfrau“ aus Hebels alemanischen Gedichten ausgeführt, wie die
übermüthige Jungfrau von ihrem stattlichen Schloß, über rothe Tücher zur
Kirche schreitet, und über die Gräber des Freydhofs, bey dem Beinhause
angelangt, von einem ehrwürdigen Greise, ernste Worte der Mahnung und
Warnung hören muß. Im Hintergrund sieht man durch die offene Pforte in die
Kirche hinein, wo das Hochamt bereits begonnen hat, und Altar und Priester
von einem, durch bunte Fenster einfallenden Lichtstrahl herrlich beleuchtet
sind.“)
Arthur von Schneider, Die
Förderung des Klassizismus durch den Badischen Kunstverein, in:
1818-1968, Festschrift zum 150jährigen Jubiläum des Badischen Kunstvereins
Karlsruhe, Karlsruhe 1968, S. 52
Z 16 Ländliches Fest aus
Anlass der Aufhebung der Leibeigenschaft in Baden am 23. Juli 1783 durch
Markgraf Karl Friedrich. 1821
Aquarell, Tuschpinsel und
Deckfarben auf beigefarbenem Papier mit Wz.: J WHATMAN/1813
53,4 x 69,3 cm
Signiert und datiert u. r. von
der Mitte „S. Reinhard fecit/1821“
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe,
Inv.-Nr. P. K. I 489-169
Kunst- und Industrie-Ausstellung
Karlsruhe 1821, Katalog Teil II, No. 1
Ludwig Schorn, Kunstblatt, 2. Jg., 1821, S. 311
„Voll Leben und Bewegung, trefflich angeordnet und gerundet, die Motive
naiv, nicht gemein, wie bey so manchen Holländern und Flamändern.“
Brief der Künstlerin über
abgelieferte Pflichtbilder für den Großherzoglichen Hof vom 24. Juni 1823
Karlsruher Beobachter, Nr. 59,
23. Juli 1846
Friedrich von Bötticher,
Malerwerke des neunzehnten Jahrhunderts, Leipzig 1901, Bd. 2/1, S. 376,
Nr. 2
Karl Koelitz, Katalog der
Gemälde-Galerie. Staatliche Kunsthalle zu Karlsruhe, Karlsruhe 1920,
Neuerwerbungen 1882-1920, Inv.-Nr. 768, S. 113
Arthur von Schneider, Die
Förderung des Klassizismus durch den Badischen Kunstverein, in:
1818-1968, Festschrift zum 150jährigen Jubiläum des Badischen Kunstvereins
Karlsruhe, Karlsruhe 1968, S. 56
Rudolf Theilmann und Edith
Ammann, Die deutschen Zeichnungen des 19. Jahrhunderts, Staatliche
Kunsthalle Karlsruhe, Karlsruhe 1978, S. 450, Nr. 2900
Kunst in der Residenz – Karlsruhe
zwischen Rokoko und Moderne,
herausgegeben von Siegmar Holsten, Ausst.-Kat. Staatliche Kunsthalle
Karlsruhe, Heidelberg 1990, S. 113, Nr. 25
Karin Stober, Denkmalpflege
zwischen künstlerischem Anspruch und Baupraxis, Stuttgart 2003, Abb. 3,
S. 37 „Als Kulisse dienen heimische Fachwerkhäuser und die Lichtenthaler
Klosterkirche“
Siehe dazu auch: Adrian
Braunbehrens (Hrsg.), Sophie Reinhard, Zehn Blätter zu Hebels
Alemannischen Gedichten, Neuauflage, Heidelberg 1996, S. 53

Ländliches Fest aus Anlass der
Aufhebung der Leibeigenschaft in Baden am 23. Juli 1783 durch Markgraf Karl
Friedrich.
Aquarell von Sophie Reinhard,
1821.
© Staatliche Kunsthalle
Karlsruhe. Inv.-Nr. P. K. I 489-169
Z 17 Biblische Geschichten. Um
1822
Zeichnungen
Verbleib unbekannt
Ludwig Schorn,
Kunstblatt, 3. Jg., Tübingen 1822, S. 68: „Fräulein
Reinhard hat einige geistvolle
Zeichnungen aus der biblischen Geschichte vollendet.“
Z 18 Tod des Tasso im Kloster
San Onofrio. Um 1823
Aquarell und Gouache
Verbleib unbekannt
Kunst- und Industrie-Ausstellung
Karlsruhe 1823, Katalog Nr. 60
Ludwig Schorn, Kunstblatt,
4. Jg., Tübingen 1823, S. 195: „Als der
unsterbliche Dichter des befreyten Jerusalems sein Ende herannahen fühlte,
ließ er sich ins Kloster St. Onofrio in Rom bringen, und starb dort, unter
dem Gebete frommer Mönche. Wir halten die Composition dieses Bildes für die
vorzüglichste unter denen, welche die Künstlerin zur Ausstellung gegeben.
Alles ist tief empfunden und die Zeichnung und Anordnung haben etwas
Großartiges. Vielleicht hätte Tasso selbst weniger historisch aufgefaßt
werden sollen. Allerdings hatte ein feindseliges Geschick jede Lust und
Kraft seines Lebens zerstört, und sein Herz war im derben Leid gebrochen.
Allein der Engel seiner lezten Stunde konnte ja den bösen Traum der
Vergangenheit von seiner Stirne hinwegscheuchen, und das trübe Auge durch
einen Blick nach oben erheitern. — Durch die Verbindung der Aquarell mit der
Guaschmanier ist es der Künstlerin gelungen, mehr Kraft und Haltung in das
Bild zu bringen, und der Oelmalerey näher zu kommen.“
Druckgraphik
D 1, I Zehn Blätter nach Hebels
Allemannischen Gedichten, componirt und radirt von Sophie Reinhard. (=Titel auf
Original-Interimsumschlag).
Plattengröße ca. 31,5 x 26,5 cm;
Bildgröße ca. 26,0 x 22,0 cm; Großfolio (Blattgröße unbeschnitten) ca. 55,5
x 43,0 cm.
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, Inv.-Nr.
1944-591 (gebundenes Exemplar mit eingebundenem Original-Interimsumschlag)
und Inv.-Nr. 1950-163 bis 172, (beide Exemplare ohne Blattnummerierung),
British Museum, Signatur 2003,0531.24.1-10 (http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=1336678&partId=1&searchText=&images=&people=134163&place=&from=&fromDate=&to=&toDate=&object=&subject=&matcult=&technique=&school=&material=ðname=&ware=&escape=&museumno=&bibliography=&citation=&sortBy=producerSort&peoA=134163-3-14&plaA=&termA=&view=list&page=12).
Textblatt mit dem Vorwort von Johann
Peter Hebel sowie Angaben zum Druckort und Verlag fehlen in
den Exemplaren der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe und des Britischen Museums.
Blatt 1 der Radierungen: Rechts
unten signiert in kleiner Druckschrift: S. Reinhard fec.
Darunter mittig mit Lettern gedruckt: Der
Carfunkel. „Hesch echt ’s
Eckstei=Aß? ’s
bidütet e rothe Carfunkel;
Blatt 2 der Radierungen: Rechts
unten signiert in Schreibschrift: Sophie Reinhard fec.
Darunter mittig mit Lettern gedruckt: Der
Carfunkel. „Nummen uf en einzig Wörtli!“ „Loß mi ung’heit
iez!
Blatt 3 der Radierungen: Unten
mittig mit Lettern gedruckt: Der Charfunkel. „O mi bluetig Herz,“
so stöhnts no lisli im Falle,
Ohne Signatur.
Blatt 4 der Radierungen: Rechts
unten signiert in Schreibschrift: S. Reinhard. fec.
Darunter mittig mit Lettern gedruckt: Das
Hexlein. se chunnt e Hexli wohlgimuth, und frogt no frey: „Haut’s
Messer gut?“
Blatt 5 der Radierungen: Rechts
unten signiert in Schreibschrift: S. Reinhard fecit.
Darunter mittig mit Lettern gedruckt: Hans und
Verene. Chumm, lüpf mer Hans! Was fehlt der echt?
Blatt 6 der Radierungen: Unten
mittig mit Lettern gedruckt: Gespenst an der Kanderer Straße. z’lezt
seit er: „Bini echterst, woni sott?“
Ohne Signatur.
Blatt 7 der Radierungen: Unten
mittig mit Lettern gedruckt: Der Statthalter von Schopfheim. „Friedli,
bischs?“ –
„I mein’s
emol!“ –
Ohne Signatur.
Blatt 8 der Radierungen: Unten
mittig mit Lettern gedruckt: Der Statthalter von Schopfheim. „Nu, se sagi
Jo, i willich ordli regiere.“
Ohne Signatur.
Blatt 9 der Radierungen: Unten
mittig mit Lettern gedruckt: Auf einem Grabe. Schlof wohl, schlof wohl im
chüele Bett!
Ohne Signatur.
Blatt 10 der Radierungen: Unten
mittig mit Lettern gedruckt: Der Wegweiser. Guter Rath zum Abschied. Doch
wandle du in Gottis Furcht, i roth der, was i rothe cha!
Ohne Signatur.
D 1, II Zehn Blätter nach Hebels
Alemannischen Gedichten, componirt und radirt von Sophie Reinhard.
Heidelberg, bey Mohr und Winter.
1820.1
Plattengröße ca. 31,5 x 26,5 cm;
Bildgröße ca. 26,0 x 22,0 cm; Großfolio (Blattgröße unbeschnitten) ca. 55,5
x 43,0 cm.
Art Institute Chicago,
Gift of Dorothy Braude Edinburg to the Harry B.
and Bessie K. Braude Memorial Collection, 2013.427 (http://www.artic.edu/aic/collections/artwork/129560?search_no=1&index=0),
Universitätsbibliothek Heidelberg, Signatur C7259 Gross RES, Badische
Landesbibliothek Karlsruhe, Signatur 052C 8 RH (Original-Interimsbroschur
mit montiertem Titelschild2 auf Vorderumschlag), Philadelphia
Museum of Art, Accession-Nr. 1985-52-42085, Württembergische
Landesbibliothek Stuttgart, Signatur 53g/90010.
Textblatt mit dem Vorwort von Johann
Peter Hebel.3
Blatt 1 der Radierungen: Rechts
unten signiert in kleiner Druckschrift: S. Reinhard fec.
Darunter mittig mit Lettern gedruckt: Der
Carfunkel. „Hesch echt ’s
Eckstei=Aß? ’s
bidütet e rothe Carfunkel;
Blatt 2 der Radierungen: Rechts
unten signiert in Schreibschrift: Sophie Reinhard fec.
Darunter mittig mit Lettern gedruckt: Der
Carfunkel. „Nummen uf en einzig Wörtli!“ „Loß mi ung’heit
iez!
(Rechts oben Blattnummerierung 2
aufgestempelt, bläuliche Stempelfarbe).
Blatt 3 der Radierungen: Rechts
unten signiert in kleiner Druckschrift: S. Reinhard fec.
Darunter mittig mit Lettern gedruckt: Der
Charfunkel. „O mi bluetig Herz,“
so stöhnts no lisli im Falle,
(Rechts oben Blattnummerierung 3
aufgestempelt, bläuliche Stempelfarbe).
Blatt 4 der Radierungen: Rechts
unten signiert in Schreibschrift: S. Reinhard. fec.
Darunter mittig mit Lettern gedruckt: Das
Hexlein. se chunnt e Hexli wohlgimuth, und frogt no frey: „Haut’s
Messer gut?“
Blatt 5 der Radierungen: Rechts
unten signiert in Schreibschrift: S. Reinhard fecit.
Darunter mittig mit Lettern gedruckt: Hans und
Verene. Chumm, lüpf mer Hans! Was fehlt der echt?
Blatt 6 der Radierungen: Rechts
unten signiert in kleiner Druckschrift: S. Reinhard fec.
Darunter mittig mit Lettern gedruckt: Gespenst
an der Kanderer Straße. z’lezt
seit er: „Bini echterst, woni sott?“
Blatt 7 der Radierungen: Rechts
unten signiert in kleiner Druckschrift: S. Reinhard fec.
Darunter mittig mit Lettern gedruckt: Der
Statthalter von Schopfheim. „Friedli, bischs?“
–
„I mein’s
emol!“ –
Blatt 8 der Radierungen: Rechts
unten signiert in kleiner Druckschrift: S. Reinhard fec.
Darunter mittig mit Lettern gedruckt: Der
Statthalter von Schopfheim.4 „Nu, se sagi Jo, i willich ordli
regiere.“
Blatt 9 der Radierungen: Rechts
unten signiert in kleiner Druckschrift: S. Reinhard fec.
Darunter mittig mit Lettern gedruckt: Auf einem
Grabe.5
Schlof wohl, schlof wohl im chüele Bett!
(Rechts oben Blattnummerierung 9
aufgestempelt, bläuliche Stempelfarbe).
Blatt 10 der Radierungen: Rechts
unten signiert in kleiner Druckschrift: S. Reinhard fec.
Darunter mittig mit Lettern gedruckt: Der
Wegweiser. Guter Rath zum Abschied. Doch wandle du in Gottis Furcht, i roth
der, was i rothe cha!
(Rechts oben Blattnummerierung 10
aufgestempelt, bläuliche Stempelfarbe).
Ludwig Schorn,
Kunstblatt, 1. Jg., Tübingen 1820, S. 59
Ludwig Schorn, Kunstblatt,
1. Jg., Tübingen 1820, S. 319
In einem
Brief der Künstlerin über abgelieferte Pflichtbilder für den
Großherzoglichen Hof vom 24. Juni 1823 sind die „zehn radirte und von mir
componierte Blätter zu Hebels Allemannischen Gedichten“ ebenfalls
aufgeführt.
Karl Goedeke, Grundrisz zur
Geschichte der deutschen Dichtung, 2. Auflage, Dresden 1906, 7. Bd., S.
538.
Arthur Rümann,
Die illustrierten deutschen Bücher des 19.
Jahrhunderts,
Stuttgart 1926, S. 224, No. 1747.
1
Über den Verkaufspreis finden sich sehr unterschiedliche Angaben, welche zum
einem auf die Umrechnung von Gulden-Währung in Taler-Währung zurückzuführen
sein könnten oder der unterschiedliche Preis bezieht sich auf
unterschiedliche Ausgaben:
Ludwig Schorn, Kunstblatt,
1. Jg., Tübingen 1820, S. 319. Preis: 5 Gulden 30 Kreuzer.
Allgemeiner Bericht von neuen
Büchern, Landkarten, Musikalien und andern Kunstartikeln, April, Mai und
Juni 1820, Heidelberg
Mohr und Winter, S. 162. Preis: 8 Gulden 15 Kreuzer.
Johann Samuel Ersch, Handbuch
der deutschen Literatur seit der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts bis auf
die neueste Zeit, Leipzig 1823, 2. Bd., S. 70, Nr. 559. Preis: 7 Thaler
12 Groschen.
2
Titelschild ca. 21,5 x 34,5 cm klebt über dem aufgedruckten Titel und
lautet: Zehn Blätter/nach/Hebels Alemannischen Gedichten,/componiert und radirt/von/
Sophie Reinhard./Heidelberg,/bey
Mohr und Winter./1820.
3
Der Text des Vorwortes lautet:
„Die Verlagshandlung dieser Blätter wünscht, daß ich sie mit einem Vorwort
begleiten möge. Die Künstlerin erlaubt es, und ich spreche unbedenklich vor
dem Publicum meine Freude an den schönen und sinnreichen Gestaltungen aus,
welche sie geistreich und gemüthlich den Phantasieen der Dichtung gegeben
hat. Mehreres darüber zu sagen enthalte ich mich. Es ist eine undankbare
Bereitwilligkeit, dem Publicum loben zu wollen, was sich selber lobt, und
denen, die Sinn und Gefühl haben, vorzusagen, was sie sehn und fühlen
sollen. Nur Eins erlaube ich mir daher zu sagen, was sich nicht von selbst
sehen und erkennen läßt. Schon oft haben Personen, welche die alemannischen
Gedichte mit ihrem Beifall ehren, den Wunsch geäußert, daß Kupfer dazu in
getreuer Nachbildung der nationalen Tracht und Eigenthümlichkeit des
Völkleins, das in ihnen lebt, gegeben werden möchten. Ein Versuch, der in
der dritten Auflage der Gedichte gemacht wurde, ist nur wenig gelungen.
Sophie Reinhard, die selbst einige Jahre in jener Gegend gelebt hat, und für
sie eine treue Erinnerung und Liebe bewahrt, hat diese Aufgabe vollkommen
erreicht.
So sind sie in ihrem ganzen Thun
und Wesen bis in ihr Inneres hinein, wie sie hier Theilweis erscheinen. Das
schöne Bild der Tochter des Statthalters ist auch in dieser Hinsicht
meisterhaft. Wie an ihr die vollständige weibliche, so stellt sich in
Käthchen neben dem Kapuziner die leichtere jungfräuliche Tracht vollendet
dar, und wer besonders die ältere und schönere sogenannte marggräfler
Kleidung noch kannte, die sich immer mehr modernisirt und verkünstelt, der
wird sie mit Vergnügen hier wieder finden, und dem Andenken aufbewahrt sehn.
Verene am Brunnen ist in eine benachbarte vaterländische Nationaltracht
eingekleidet, zu deren Wahl die aufmerksame Künstlerin, so wie zu dem
Heiligenbilde auf dem Brunnen durch die Stelle: « Du hast mich aus dem
Fegfeuer geholt » sich veranlaßt sah.
Noch bin ich der sinnreichen
Künstlerin die Gerechtigkeit des Geständnisses schuldig, daß ich nur einige
dieser Kunstwerke fast in ihren ersten Entwürfen, und die meisten erst in
den vollendeten Abdrücken gesehen habe, und an allem Verdienst ihrer Anlage
und der weiteren Ausführung einiger Gedanken keinen Antheil habe, auch nicht
an den heiter launigten Zuthaten, welche die Einweihung des Statthalters
umgeben.
Hebel.“
4
An diesem Blatt ist besonders deutlich zu erkennen, dass Julius Nisle 1837
bei seinen Umrissen zu „J. P. Hebel’s allemanischen Gedichten“ auf die
Vorlage von Sophie Reinhard zurückgegriffen hat. August Lewald schreibt dazu
in Europa, Jg. 1837, Bd. 2, Seite 336: „Dieses sechste Blatt zu dem
Statthalter von Schopfheim ist nach einem rad. Blatte von Sophie Reinhard
gearbeitet, welches Hebel sehr hoch hielt. In dem jungen Manne links, der
das beobachtende Auge auf die Gruppen richtet, hat unser Künstler sich
selbst porträtirt.“
5
Auf dem
Friedhof stehen Kreuze und Grabmale, welche die Namen von verstorbenen
Verwandten und Freunden der Künstlerin tragen: Auf der linken Seite ein
Steinkreuz mit der Inschrift A. MILESI (wohl Antonietta Milesi, die 1814
verstorbene Schwester ihrer Freundin Bianca Milesi) und darunter ein
Holzkreuz mit dem Namen S. GRIESBACH (wohl Salome Griesbach). In der Mitte
steht ein großes Steinkreuz mit dem Namen MAX REINHARD (Vater der
Künstlerin, gestorben 1812) und auf der rechten Seite zwei mit einem
gewundenen Kranz verbundene Kreuze, welche die Initiale W. M. und E. M.
tragen und darunter ein Grabstein mit den Initialen C. R. (wohl für Carl
Reinhard, Bruder der Künstlerin, der im März 1800 als Kaufmann nach St.
Thomas/Westindien ging und um 1807 auf See verschollen ist) und daneben ein
Kreuz mit der Inschrift M. Geiger (Margarete Geiger). Bei den Initialen W.
M. und E. M. könnte es sich um die Eltern ihrer Schwägerin Amalia Reinhard
handeln. Deren Vater war der wirkliche Geheimrat Emanuel Meier (gest. am 5.
Juni 1817) und deren Mutter Wilhelmine Meier geb. Maler (verl. Armin G.
Meyer und Sabine Meyer-Carillon, Ortsfamilienbuch Karlsruhe, Teil 2,
Reformierte Kirche 1722-1821, Karlsruhe 2014, S. 358).
D 1, III Zehn Bilder zu den
Alemannischen Gedichten von J. P. Hebel.1
Carlsruhe. [ca. 1820]2
(Titel auf
Original-Interimsumschlag)
Plattengröße ca. 31,5 x
26,5 cm; Bildgröße ca. 26,0 x 22,0 cm; Großfolio (Blattgröße) ca. 46 x 34
cm.
Universitätsbibliothek Basel,
Signatur: Hoff 831 Folio (https://www.e-rara.ch/bau_1/doi/10.3931/e-rara-56101
Zugriff vom 26.04.2019)
Das Blatt mit dem Vorwort von
Johann Peter Hebel ist nicht vorhanden.
Blatt 1 der Radierungen: Rechts
unten signiert in kleiner Druckschrift: S. Reinhard fec.
Darunter mittig mit Lettern gedruckt: Der Carfunkel. „Hesch echt ’s
Eckstei=Aß? ’s
bidütet e rothe Carfunkel;
Blatt 2 der Radierungen: Rechts
unten signiert in Schreibschrift: Sophie Reinhard fec.
Darunter mittig mit Lettern gedruckt: Der Carfunkel. „Nummen uf en einzig Wörtli!“
–
„Loß mi ung’heit
iez!
Blatt 3 der Radierungen: Rechts
unten signiert in kleiner Druckschrift: S. Reinhard fec.
Darunter mittig mit Lettern gedruckt: Der Charfunkel. „O mi bluetig Herz,“
so stöhnts no lisli im Falle,
Blatt 4 der Radierungen: Rechts
unten signiert in Schreibschrift: S. Reinhard. fec.
Darunter mittig mit Lettern gedruckt: Das Hexlein. se chunnt e Hexli wohlgimuth, und frogt no frey: „Haut’s
Messer gut?“
Blatt 5 der Radierungen: Rechts
unten signiert in Schreibschrift: S. Reinhard fecit.
Darunter mittig mit Lettern gedruckt: Hans
und Verene. Chumm, lüpf mer Hans! Was fehlt der echt?
Blatt 6 der Radierungen: Rechts
unten signiert in kleiner Druckschrift: S. Reinhard fec.
Darunter mittig mit Lettern gedruckt: Gespenst an der Kanderer Straße. z’lezt
seit er: „Bini echterst, woni sott?“
Blatt 7 der Radierungen: Rechts
unten signiert in kleiner Druckschrift: S. Reinhard fec.
Darunter mittig mit Lettern gedruckt: Der
Statthalter von Schopfheim. „Friedli, bischs?“
–
„I mein’s
emol!“ –
Blatt 8 der Radierungen: Rechts
unten signiert in kleiner Druckschrift: S. Reinhard fec.
Darunter mittig mit Lettern gedruckt: Der
Statthalter von Schopfheim. „Nu, se sagi Jo, i willich ordli regiere.“
Blatt 9 der Radierungen: Rechts
unten signiert in kleiner Druckschrift: S. Reinhard fec.
Darunter mittig mit Lettern gedruckt: Auf
einem Grabe. Schlof wohl, schlof wohl im chüele Bett!
Blatt 10 der Radierungen: Rechts
unten signiert in kleiner Druckschrift: S. Reinhard fec.
Darunter mittig mit Lettern gedruckt: Der
Wegweiser. Guter Rath zum Abschied. Doch wandle du in Gottis Furcht, i roth
der, was i rothe cha!
1
Im Gegensatz zu den Ausgaben D 1, I und D 1, II ist der Titel von „Zehn
Blätter nach…“ leicht abgewandelt in „Zehn Bilder zu den …“.
2
Als Druckort ist im Gegensatz zur Ausgabe D 1, II Carlsruhe statt Heidelberg
angegeben, Verleger sowie das Jahr des Druckes fehlen.
https://www.e-rara.ch/download/pdf/15133702?name=Zehn Bilder zu den
Alemannischen Gedichten von J P Hebel (Zugriff vom 26.04.2019)
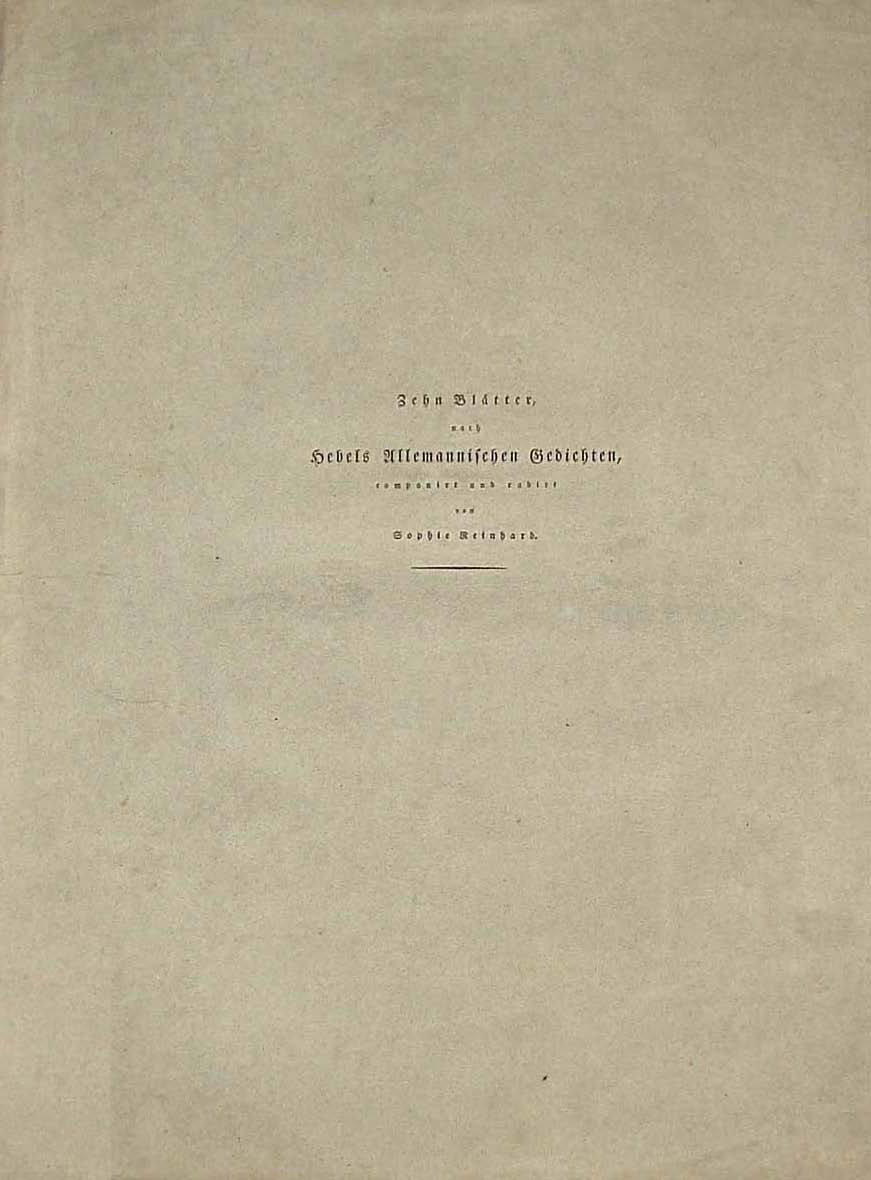
Titel auf dem
Vorderumschlag der Interimsbroschur zu den Radierungen
von Sophie Reinhard (Ausgabe D 1, I)
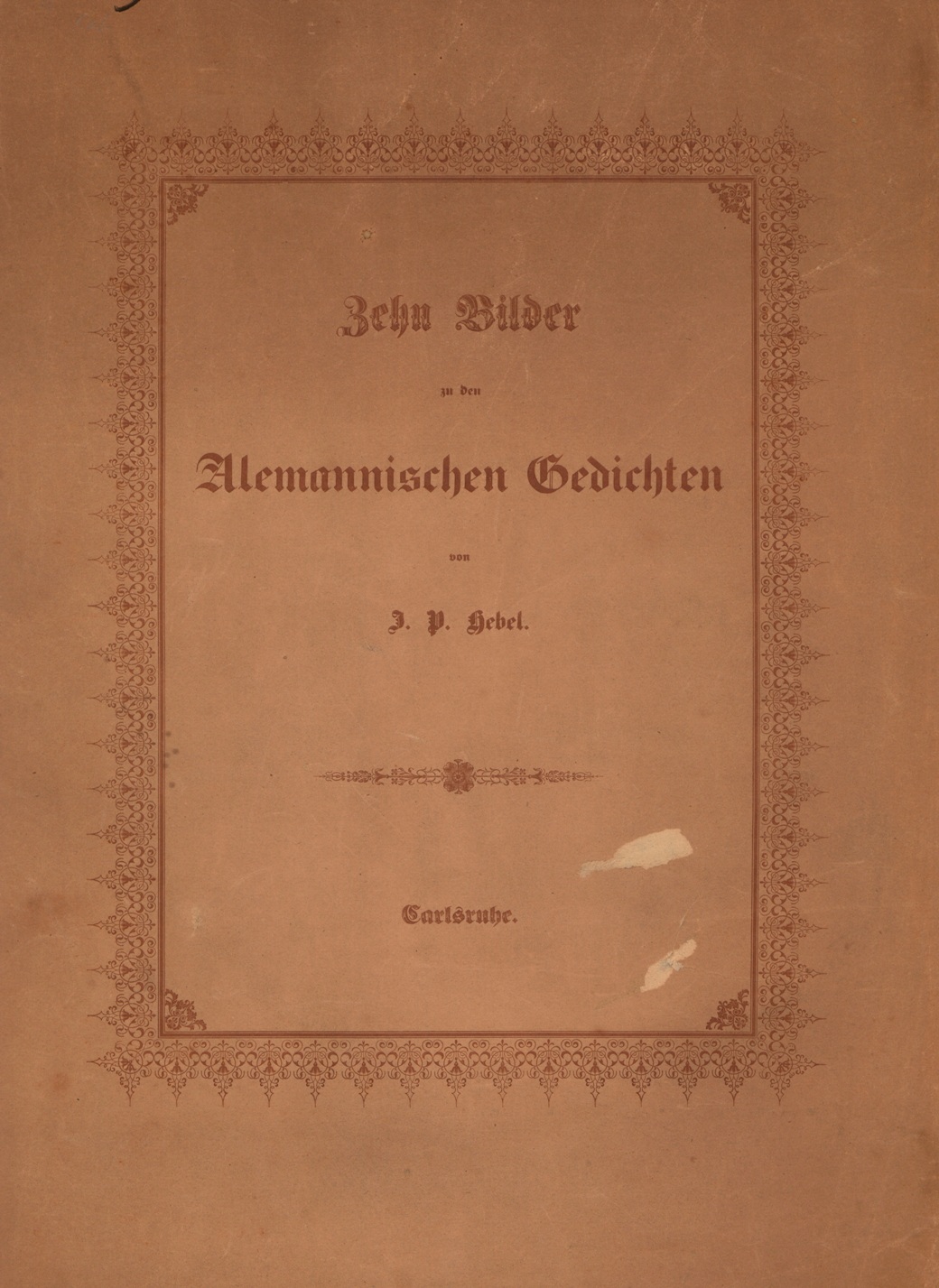
Titel auf dem
Vorderumschlag der Interimsbroschur zu den Radierungen
von Sophie Reinhard (Ausgabe D 1, III)
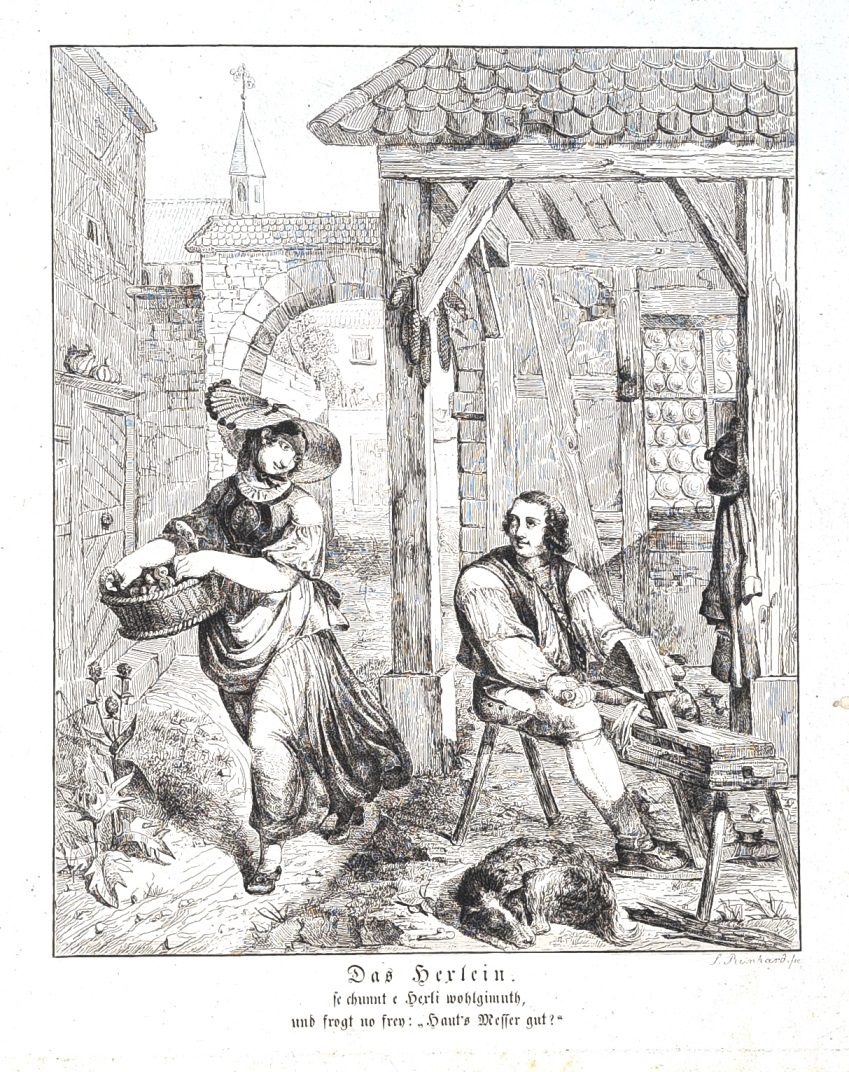
Blatt vier:
„Das
Hexlein.“
nach Hebels Alemannischen Gedichten, Zeichnung und Radierung von Sophie
Reinhard (Ausgabe D 1, I)
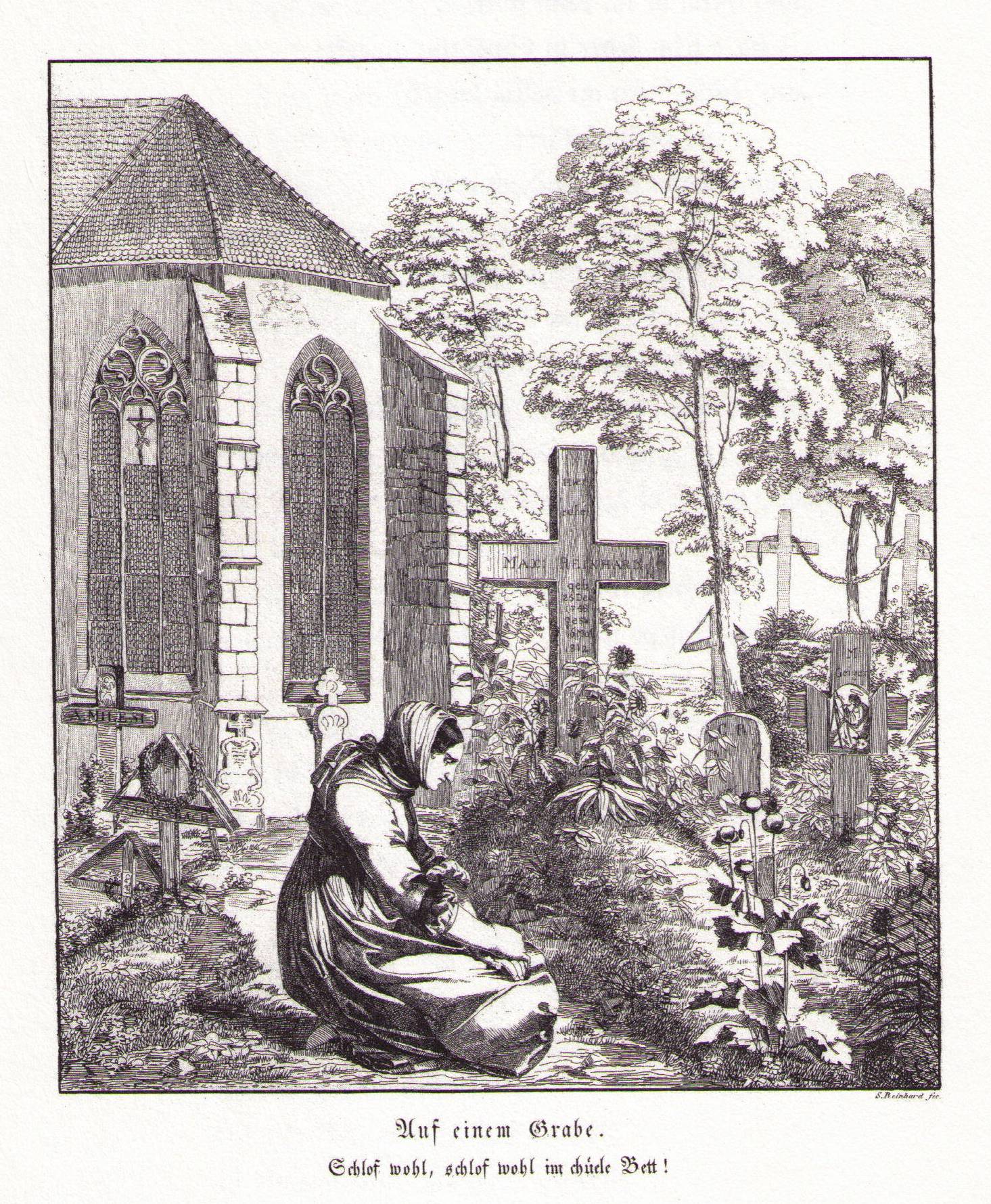
Blatt neun:
„Auf einem Grabe.“
nach Hebels Alemannischen Gedichten, Zeichnung und Radierung von Sophie
Reinhard (Ausgabe D 1, II)
D 2 Adolph von Nassau,
gezeichnet von Sophie Reinhard und radiert von Franz Hegi.
Bildgröße ca. 10,5 x 8,1 cm.
Rechts unten signiert: F. Hegi
fec.
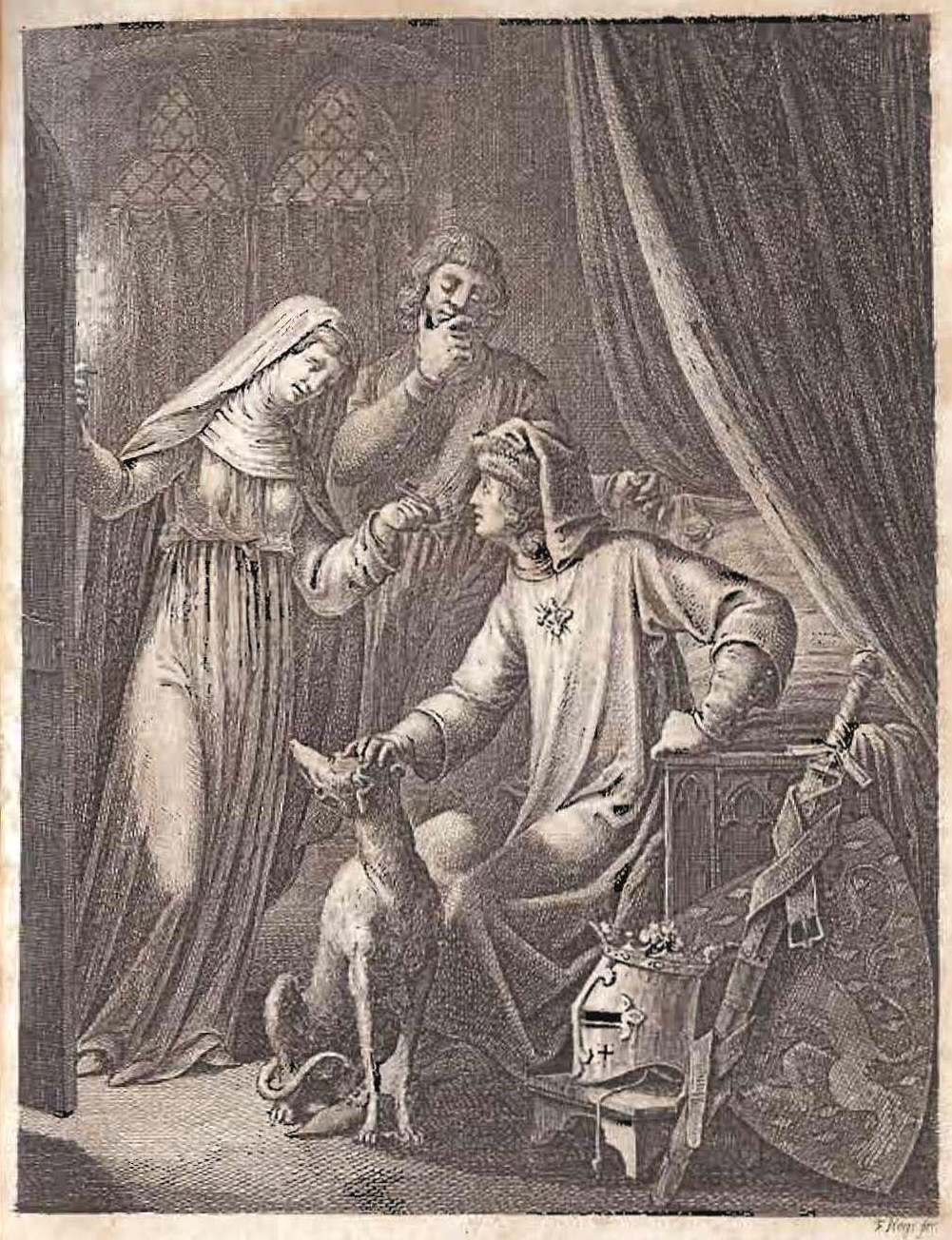
Adolf von Nassau,
gezeichnet von Sophie
Reinhard und radiert von Franz Hegi (Bildnachweis: E. Fecker)
Kupferstich zu der historischen
Novelle „Adolph von Nassau“ von Aloys Schreiber in Rheinblüten, 2. Jahrgang,
Taschenbuch auf das Jahr 1822, Karlsruhe G. Braun. 1821.
In der „Erklärung der Kupfer“
Seite XVI ist zu dem Kupferstich zu lesen: „Das historische Blatt, nach
einer schönen Zeichnung von unsrer geist- und gemüthreichen Sophie Reinhard,
von Hegi trefflich radiert, ist durch die Erzählung Adolf von Nassau, wohin
der Moment gehört, hinreichend erklärt.“ Mitherausgeberin der „Rheinblüten“ war
Friederike Robert, Schwester des Verlegers Gottlieb Braun.1
Badische Landesbibliothek
Karlsruhe, Signatur
ZA 1315,RH,2.1822
(siehe auch
http://www.musenalm.de/abbild.php?iid=55888&aid=754 Zugriff vom
22.07.2015)
1
Friederike Robert war ursprünglich mit Giambatista Primavesi verheiratet.
Nach ihrer Scheidung heiratete sie den Dichter und Publizisten Ludwig
Robert, den Bruder der Schriftstellerin Rahel Varnhagen von Ense (vergl.
Jutta Rebmann, Friederike Robert (1795-1832) – „Madame! Sie sind die
schönste aller Frauen! : neue biographische Züge aus Friederikes Tagebuch
von 1824, in: Vom Salon zur Barrikade : Frauen der Heinezeit,
herausgegeben von Irina Hundt, Stuttgart
2002, S. 143-155).
Ausstellungen
(zeitlich geordnet)
1811
Beteiligung an der
Kunstausstellung des freien Zeichen-Instituts in Weimar mit den
Kreidezeichnungen „Ottilie mit totem Kind im Kahn“ und „Ottilie auf dem
Totenbett“.
(Siehe dazu: Zwischen Ideal und
Wirklichkeit – Künstlerinnen der Goethe-Zeit zwischen 1750 und 1850,
herausgegeben von Bärbel Kovalevski, Ausst.-Kat. Schlossmuseum Gotha und Rosgartenmuseum
Konstanz, Ostfildern-Ruit 1999, S. 154 und Weimarische Kunstausstellung
1811, in: Journal des Luxus und der Moden, herausgegeben von Carl Bertuch, Weimar
1811, 26. Bd., S. 699ff.)
1818
Beteiligung an der Kunstausstellung des Kunstvereins Karlsruhe mit den
Gemälden „Der Tod der heiligen Catharina“ und „Elisabeth und Johannes als
Kind“ mit der Bemerkung „gehören der großh. Gallerie“.
(Siehe
dazu: Handschriftliches Verzeichnis der Kunstausstellung im Museum in
Karlsruhe vom 12. bis 19. April 1818, GLA 69 Badischer Kunstverein/1)
1821
Beteiligung an der Kunst- und
Industrie-Ausstellung in Karlsruhe mit dem Gemälde „Die heilige Cecilie“
(Katalog Teil I, No. 4) und dem Aquarell „Ein ländliches Fest im Oberland
wegen Aufhebung der Leibeigenschaft im Jahre 1783, der Ehrentag Carl
Friedrichs“ (Katalog Teil II, No.1).
(Siehe dazu: Rezension von Aloys
Schreiber im Kunstblatt, 2. Jg. S. 311 sowie Bericht über die Kunst und
Industrie-Ausstellung für 1821 erstattet von dem Vorstand des Kunst- und
Industrie-Vereins für das Großherzogthum Baden.
Karlsruhe, im
October 1821, C. F. Müller)
1823
Beteiligung an der Kunst- und
Industrie-Ausstellung in Karlsruhe mit den „Oel-Gemälden“ „Markgräfin Anna
von Baden, geborene Pfalzgräfin von Veldenz, Mutter des Markgrafen Georg
Friedrich, speist Arme und theilt Arzneien aus“ (Kat. Nr. 9), und „Composition
nach Herrn Hofrath Schreibers Gedicht, Beruhigung an Frieda“ (Kat. Nr. 11),
sowie mit den „Gemälden in Aquarell“ „Tasso’s Tod“ (Kat. Nr. 60) und „Die
Hefnetjungfrau aus Hebels allemannischen Gedichten“ (Kat. Nr. 65).
(Siehe dazu: Kunstnachrichten aus
dem Badischen, Schorns Kunstblatt, 4. Jg., S. 27 und Die Kunst- und
Industrie-Ausstellung in Karlsruhe im Mai 1823, Schorns Kunstblatt, 4. Jg.
S. 193ff. „Markgräfin
Anna von Baden speist Arme und theilt Arzneyen aus. – Komposition nach Aloys
Schreibers Gedicht: Beruhigung. An Frida“
im neuesten Jahrgang der Cornelia, Taschenbuch für Deutsche Frauen auf das
Jahr 1823, herausgegeben von Aloys Schreiber. Ferner Karl Nehrlich, Ueber
die Kunst- und Industrie-Ausstellung für das Großherzogthum Baden von 1823
in Karlsruhe. Verlag G. Braun, Karlsruhe, sowie Katalog über die Kunst- und
Industrie-Ausstellung für das Großherzogthum Baden von 1823 zu Karlsruhe, G.
Braun)
1825
Beteiligung an der
Kunstausstellung in der Akademie zu Prag zu Anfang des Jahrs 1825 mit dem
Gemälde „Heilige Familie“.
(Siehe dazu: Die Kunstausstellung
zu Prag im Jahr 1825, Kunstblatt, 6. Jg., S. 157 sowie Kunstausstellung in
der Akademie zu Prag zu Anfang des Jahrs 1825, Prag, Haase, 1825)
Beteiligung an der Kunst- und
Industrie-Ausstellung vom 10. bis 26. Mai 1825 in Karlsruhe mit den Gemälden
„Heilige Familie“ (Kat. Nr. 35) und „Markgraf Christoph der erste, entläßt
die Gesandten Kaiser Maximilian’s des ersten, welche ihn unter glänzenden
Anerbietungen gegen seinen Freund den Churfürsten v. der Pfalz zum Krieg zu
bewegen suchen, mit der Antwort: »Ehr u. Eid gilt bei uns mehr denn Land u.
Leut.«“ (Kat. Nr. 50).
(Siehe dazu: Schorns Kunstblatt,
6. Jg., S. 193 sowie Katalog über die Kunst- und Industrieausstellung für
das Großherzogthum Baden von 1825 zu Karlsruhe, C. F. Müller)
1827
Beteiligung an der Kunst- und
Industrie-Ausstellung in Karlsruhe mit den Gemälden „Bettelmönche von der
Insel Ischia“ (Kat. Nr. 9), „Ein Kind in einer Landschaft“ (Kat. Nr. 29),
„Ruth“ (Kat. Nr. 76) und „Conradin von Schwaben und Friedrich von Österreich“
(Kat. Nr. 160).
(Siehe dazu: Schorns Kunstblatt,
8. Jg., S. 209:„Bettelmönche auf Ischia; ein Kind in einer Landschaft; Ruth;
Conradin von Schwaben und Friedrich von Oestreich“ sowie Katalog über die
Kunst- und Industrie-Ausstellung für das Großherzogthum Baden von 1827 zu
Karlsruhe, G. Braun)
1829
Beteiligung an der Kunst- und
Industrie-Ausstellung in Karlsruhe mit den Gemälden „Der Tod des
Torquato Tasso im Kloster
zu St. Onofrio zu Rom“ (Kat. Nr. 26),
„Pifferari
vor einem Madonnenbild“ (Kat. Nr. 30), „Johannes Evangelista“ (Kat. Nr. 53)
und „Die heilige Maria“ (Kat. Nr. 54).
(Siehe dazu: Die Kunst- und
Industrie-Ausstellung in Carlsruhe 1829, Schorns Kunstblatt, 11. Jg.,
Tübingen 1830, S. 45 sowie Katalog über die Kunst- und Industrie-Ausstellung
für das Großherzogthum Baden von 1829 zu Karlsruhe, C. F. Müller)
1914
Die Frau im Buchgewerbe und in der Graphik,
Sondergruppe der Weltausstellung für Buchgewerbe und
Graphik, Leipzig, 1914, 1. Auflage
(Nr. 990 „Radierung, Sophie
Reinhardt, nach Held. Karlsruhe, Zähringer Museum.“)
1961
Aus
Karlsruher Privatbesitz, Gemälde Aquarelle Zeichnungen 1790-1940,
Ausst.-Kat. Badischer Kunstverein Karlsruhe, Karlsruhe
1961
(Kat.
Nr. 139 „Das Rittermahl“)
1981
Eden revisited, Graphic Works by German Romantic
Artists, Exhibition Goethe House New York,
introduction and catalogue by Anneliese Harding, New York 1981
(One plate of Illustrationen zu Hebels Alemannischen
Gedichten „The Visit of the Little Witch“ is included as cat. 53)
1990
Kunst in der Residenz – Karlsruhe
zwischen Rokoko und Moderne,
Ausst.-Kat. Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, herausgegeben von Siegmar Holsten,
Heidelberg 1990
(„Ländliches Fest aus Anlass der
Aufhebung der Leibeigenschaft in Baden am 23. Juli 1783 durch Markgraf Carl
Friedrich“, „Markgräfin Anna von Baden-Durlach verteilt Almosen an Arme und
Kranke“)
1995
Achim Aurnhammer, Christina
Florack-Kröll, Dieter Martin, Torquato Tasso in Deutschland,
Gedenkausstellung zum 400. Todestag (25. April 1995) im Goethe-Museum
Düsseldorf, Heidelberg 1995
(„Tod des Torquato Tasso“, 1829)
1999
Zwischen Ideal und Wirklichkeit –
Künstlerinnen der Goethe-Zeit zwischen 1750 und 1850,
hrsg. Bärbel Kovalevski, Ausst.-Kat. Schlossmuseum Gotha und Rosgartenmuseum
Konstanz, Ostfildern-Ruit 1999
(„Margarete Geiger beim Kopieren,
1807“, „Die heilige Ottilie auf dem Totenbett, 1811“, „Ottilie mit totem
Kind im Kahn, 1811“, „Dame auf einem Esel reitend, aus einem Skizzenbuch um
1813“, „Selbstbildnis, um 1812“, „Die heilige Cäcilie, 1821“, „Markgräfin
Anna von Baden-Durlach verteilt Almosen, 1823“)
Biedermeier in Heidelberg
1815-1853, Ausst.-Kat.
Kulturamt der Stadt Heidelberg 1999
(S. 37 „Profilbildnis eines
Knaben“)
2005
Frank Büttner und Herbert W. Rott (Hrsg.),
Kennst Du das Land. Italienbilder der Goethezeit, Ausst.-Kat. Neue
Pinakothek München, München und Köln 2005
(S. 73, Abb. 8 „Dame auf einem
Esel
reitend, um 1813“)
2010
Viaggio
in Italia, Künstler auf Reisen 1770-1880,
Ausst.-Kat. Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, Karlsruhe 2010
(S. 105 „Bianca Milesi, auf einem Esel
reitend, Skizzenbuch, fol. 17, 1813“)
2011
Unser Schwarzwald, Romantik und
Wirklichkeit,
Ausst.-Kat. Augustinermuseum Freiburg,
Gesamtleitung: Tilmann von Stockhausen, Konzeption: Maria Schüly,
Katalogredaktion: Kathrin Fischer,
Petersberg 2011
(S. 103 „Der Charfunkel“,
„Gespenst an der Kanderer Straße“ aus den Illustrationen zu Hebels
Alemannischen Gedichten)
2016
Schwarzwaldbilder – Kunst des 19.
Jahrhunderts,
Ausst.-Kat. Städtische Galerie Karlsruhe, Karlsruhe 2016
(S. 38 „Hans und Verene“
Zeichnung zu den Illustrationen zu Hebels Alemannischen Gedichten)
Bibliographie
Albrecht Adam, Aus dem Leben
eines Schlachtenmalers, Selbstbiographie nebst einem Anhange,
herausgegeben von Hyazinth Holland, Stuttgart 1886
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:wim2-g-3490414
http://www.zeno.org/nid/20003845761
Maria Luisa Alessi,
Una
„Giardiniera“
del Risorgimento italiano : Bianca
Milesi : con Documenti inediti,
Genova, Torino, Milano 1906
Arianna Arisi Rota, Milesi, Bianca, in:
Dizionario Biografico degli Italiani, Vol. 74, Roma 2010, S. 477-480
Jutta Assel und Georg Jäger,
Johann Peter Hebel, Alemannische Gedichte. Illustriert von Julius Nisle und
Sophie Reinhard, Goethezeitportal, Einstellung Oktober 2013
http://www.goethezeitportal.de/wissen/illustrationen/johann-peter-hebel/johann-peter-hebel-alemannische-gedichte-illustriert-von-julius-nisle.html
Hela Baudis, Rudolph Suhrlandt
(1781-1862) Grenzgänger zwischen Klassizismus und Biedermeier,
Inauguraldissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors
der Philosophie der Philosophischen Fakultät der
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, 2007
Bettina Baumgärtel, Angelika
Kauffmann und der Freundschaftskult der Künstlerinnen. Bildtypologien der
Freundschaft um 1800, in: Schwestern und Freundinnen: Zur
Kulturgeschichte weiblicher Kommunikation, Kongressbericht herausgegeben von
Eva Labouvie, Köln 2009, S. 221-240
Franz Bene (Hrsg.), Baronin
Johanna von Vay, geborene Freiin von Adelsheim, geboren in Pforzheim, den 5.
August 1776, gestorben in Golop, den 26. Februar 1863, Wien 1864
Joseph August Beringer,
Badische Malerei 1770-1920, 2. Auflage, Karlsruhe 1922
Joseph August Beringer, Jakob
Friedrich Dyckerhoff 1774-1845, Ingenieur, Architekt, Maler und
Daguerreotypeur in Mannheim, in: Zeitschrift für die Geschichte des
Oberrheins, N. F., Bd. 47, 1934, S. 259-352
Pietro Berri, Il dottor Benedetto Mojon, Giornale storico e
letterario della Liguria, Anno XVIII, 1942, S.101-149
Kunst- und andere Nachrichten
aus Carlsruhe, in:
Journal des Luxus und der Moden, herausgegeben von
Carl Bertuch, Weimar 1810, 25. Bd., S. 443-445
Weimarische Kunstausstellung
1811, in: Journal des
Luxus und der Moden, herausgegeben von Carl Bertuch, Weimar 1811, 26. Bd.,
S. 699-702
Harry Blättel, Internationales
Lexikon Miniatur-Maler Porzellan-Maler Silhouettisten, München 1992
Friedrich von Boetticher,
Malerwerke des neunzehnten Jahrhunderts, Leipzig 1891-1901
Karl August Böttiger, Kunst
und Alterthum, in: Abend-Zeitung auf das Jahr 1821, herausgegeben von
Theodor Heil und Friedrich Kind, Dresden 1821
Adrian Braunbehrens (Hrsg.),
Sophie Reinhard, Zehn Blätter zu Hebels Alemannischen Gedichten,
Neuauflage, Heidelberg 1996
Bernd Breitkopf, Die alten
Landkreise und ihre Amtsvorsteher, Beiträge zur Geschichte des
Landkreises Karlsruhe, Bd. 1, Ubstadt-Weiher, 1997
Yves Bruley, De la Révolution
au Romanisme,
in: La Trinité-des-Monts redécouverte, Ausst.-Kat. herausgegeben von Yves
Bruley, Rom 2002, S. 166-176
Carl Brun, Kreuz- und Querzüge
eines Schweizer Malers [Jakob Wilhelm Huber], Neujahrsblatt der
Künstlergesellschaft Zürich, N. F. 45, Zürich 1885
Johann Friedrich Cotta (Hrsg.),
Morgenblatt für gebildete Leser, 5. Jg., Tübingen 1811
Johann Samuel Ersch, Handbuch
der deutschen Literatur seit der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts bis auf
die neueste Zeit, Leipzig 1823
Edwin Fecker (Hrsg.), Marie
Ellenrieder : Der schriftliche Nachlass, Maulburg 2014
Edwin Fecker, Die Großherzoglich Badische
Hofmalerin Sophie Reinhard (1775-1844) – Leben und Werk, Maulburg 2018
Manfred Fellhauer, Industrie, Handwerk und
Gewerbe, in: Grünwinkel : Gutshof, Gemeinde, Stadtteil, herausgegeben
von Manfred Fellhauer, Manfred Koch und Gerhard Strack, Karlsruhe 2009, S.
158-167
Gertrud Fiege, Verzeichnis der
Plastiken, Gemälde, Handzeichnungen, Scherenschnitte im
Schiller-Nationalmuseum und Deutschen Literaturarchiv Marbach, Marbach
am Neckar 1978, 2 Bände
Michael Frauenberger,
Familienbuch der reformierten Pfarrei Kirchberg 1656-1875, Veröff. der
Westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde e.V. Sitz Köln, Nr. 212, Köln
2005
Gottlieb Abraham Frenzel, Die
Kunstsammlung des Freiherrn C. F. L. F von Rumohr, Öffentliche Versteigerung
Dresden den 19. October 1846 durch Robert Julius Köhler, Lübeck 1846
Pankraz von Freyberg, Maria
Electrine Freifrau von Freyberg geb. Stuntz (1797-1847), Oberbayrisches
Archiv, Bd. 110, 1985
Gabriele Fünfrock, Jakob
Friedrich Dyckerhoff – ein Architekt des Frühklassizismus im Großherzogtum
Baden – 1774-1845, Worms 1983
Ferdinand Gademann, Das
Zeichenbuch der Katharina Geigerin, Würzburg 1929
Margarete Geiger, Briefe der
Malerin aus Würzburg, Bamberg, München und Wien an ihre Familie in
Schweinfurt 1804-1809, Einführung Erich Schneider. Friederike Kotouč
(Hrsg.), Schweinfurter Museumsschriften, 12/1987, Nürnberg 1987
Gedichte von S. Gessner,
Zürich bey Orell Gessner und Comp. 1762
Briefwechsel zwischen Goethe
und Knebel (1774-1832),
2. Teil, Leipzig 1851
Paul Hagen, Friedrich
Overbecks Handschriftlicher Nachlaß in der Lübeckischen Stadtbibliothek,
Veröffentlichungen der Stadtbibliothek der freien und Hansestadt Lübeck, 2.
Stück, Lübeck
1926
Johann Peter Hebel, Briefe der
Jahre 1784-1824, Gesamtausgabe, herausgegeben von Wilhelm Zentner,
Karlsruhe 1957
Karl Herbster, Die Röttler Landschule und
das Lörracher Pädagogium, in: Das Markgräfler Land, 9. Jg., 1938, S.
97-142
Fritz Hirsch, 100 Jahre Bauen
und Schauen, Karlsruhe 1928
Hadwig Hoffmann, Die
Familien-Stipendien-Stiftungen der Familie Maler in Baden, in: Archiv
für Sippenforschung, 51. Jg., 1985, Heft 100, S. 279-297
Hyazinth Holland,
Schlachtenmaler Albrecht Adam und seine Familie, München 1915
Rebekka Horlacher und Daniel Tröhler (Hrsg.),
Sämtliche Briefe an Johann Heinrich
Pestalozzi : Kritische
Ausgabe, Band 3,
1810-1813, Zürich 2011
Joseph von Hormayr, Miscellen,
in: Archiv für Geographie, Historie, Staats- und Kriegskunst, Bd. 13, 1822,
S. 232
Margaret Howitt, Friedrich
Overbeck. Sein Leben und Schaffen, Freiburg i. Br. 1886
Hea-Jee Im, Karlsruher
Bürgerhäuser zur Zeit Weinbrenners, Mainz 2004
Karlsruher Frauen 1715-1945.
Eine Stadtgeschichte.
Hrsg. Stadt Karlsruhe – Stadtarchiv. Veröffentlichungen des Karlsruher
Stadtarchivs, Bd. 15, Karlsruhe 1992
Robert Keil, Heinrich
Friedrich Füger 1751-1818. Nur wenigen ist es vergönnt das Licht der
Wahrheit zu sehen, Wien 2009
Gerda Kircher, Vedute und
Ideallandschaft in Baden und der Schweiz : 1750-1850, Heidelberger
Kunstgeschichtliche Abhandlungen, 8, 1928
Gerda Franziska Kircher,
Zähringer Bildnissammlung im neuen Schloss zu Baden-Baden, Karlsruhe
1958
Joachim Kleinmanns, Klassische Größe –
einfache Gestalt, Weinbrenners Werke, in:
Friedrich Weinbrenner 1766-1826,
Architektur und Städtebau des Klassizismus,
Ausst.-Kat. der Städtischen Galerie Karlsruhe und des Südwestdeutschen
Archivs für Architektur und Ingenieurbau am KIT, Petersberg 2015, S. 438-441
Joachim Kleinmanns, Friedrich Weinbrenners
Schüler, in:
Friedrich Weinbrenner 1766-1826, Architektur und Städtebau des Klassizismus,
Ausst.-Kat. der Städtischen Galerie Karlsruhe und des Südwestdeutschen
Archivs für Architektur und Ingenieurbau am KIT, Petersberg 2015, S. 442-452
Johann Ludwig Klüber,
Beschreibung von Baden bei Rastatt und seiner Umgebung, Tübingen 1810
Manfred Koch, Karlsruher Chronik.
Stadtgeschichte in Daten, Bildern, Analysen, Veröffentlichungen des
Karlsruher Stadtarchivs, Band 14, Karlsruhe 1992
Karl Koelitz, Katalog der
Gemälde-Galerie. Staatliche Kunsthalle zu Karlsruhe, Karlsruhe 1920
Paul Köster, Eberhard Wächter
(1762-1852), Ein Maler des deutschen Klassizismus, Diss. Bonn, 1968
F. de Lansac
(Hrsg.), Encyclopédie biographique du XIXe siècle, Médecins
célèbres, Paris 1845
Jan Lauts und Werner Zimmermann,
Katalog neuere Meister 19. und 20. Jahrhundert, Staatliche Kunsthalle
Karlsruhe, Karlsruhe 1971
Ernst Lemberger,
Bildnis-Miniatur in Deutschland von 1550 bis 1850, München 1909
Ernst Lemberger,
Meisterminiaturen aus fünf Jahrhunderten, Stuttgart 1911
August Lewald (Hrsg.), Europa.
Chronik der gebildeten Welt, Leipzig und Stuttgart, Jg. 1837, 2. Bd.
Lexikon der Künstlerinnen
1750-1850, Deutschland Österreich, Schweiz,
herausgegeben von Jochen Schmidt-Liebich, München 2005
Otto von Lutterotti, Joseph
Anton Koch 1768-1839, Berlin 1940
Hans Merkle, Carl Wilhelm
Markgraf von Baden-Durlach und Gründer der Stadt Karlsruhe (1679-1738),
Heidelberg 2012
Armin G. Meyer und Sabine
Meyer-Carillon, Ortsfamilienbuch Karlsruhe, Teil 2, Reformierte Kirche
1722-1821, Karlsruhe 2014
Bianca Milesi, Vita di Maria
Gaetana Agnesi, in: Vite e ritratti d’ illustri italiani,
Quaderno Primo, Padova, Tipografia Bettoni, 1813
Bianca Milesi, Vita di Saffo,
in: Vite e ritratti di donne illustri, Padova, Tipografia Bettoni,
1815
Bianca Milesi Mojon, Prime
letture pe’ fanciulli di tre in quattro anni,
Milano, Fontana 1831, 83 S.
Bianca Milesi Mojon,
Lezioni elementari di
storia naturale ad uso dei fanciulli, Milano, Tipografia e Libreria
Pirotta, 1838, 86 S., 1 Tafel
Bianca Milesi Mojon, A
Glance at Natural History, London, Darton and Clark, [1840], 96 S., mit
zahlr. Abb. im Text
Dorothea Minkels, Elisabeth
von Preussen, Königin in der Zeit des AusMärzens, Norderstedt 2007
Benedetto Mojon,
Dissertazione sull’utilità della musica tanto nello stato di sanità che in
quello di malattia, Genua [1801]
Benedetto Mojon,
Mémoire sur les effets
de la castration dans le corps humain,
Montpellier 1804
Benedetto Mojon,
Leggi fisiologiche, Genua 1806
Katharina Mommsen (Hrsg.), Die
Entstehung von Goethes Werken in Dokumenten, Band VII, Hackert -
Indische Dichtungen, Berlin 2015
Friedrich Müller und
Karl Klunzinger, Die Künstler aller Zeiten und Völker oder Leben und
Werke der berühmtesten Baumeister, Bildhauer, Maler, Kupferstecher,
Formschneider, Lithographen etc., Stuttgart 1864, Band III, S. 325
Georg Kaspar Nagler, Neues
allgemeines Künstler-Lexikon, München 1837
Karl Nehrlich, Ueber die
Kunst- und Industrie-Ausstellung für das Großherzogthum Baden von 1823 zu
Karlsruhe, Karlsruhe 1823
Friedrich Noack, Das
Deutschtum in Rom, seit dem Anfang des Mittelalters, Stuttgart 1927
Karl Obser, Feodor Iwanow. Ein
Karlsruher Hofmaler aus der Zeit des Klassizismus, in: Ekkhart, Jahrbuch
für das Badner Land, 11. Jg., 1930, S. 18-27
Karl Obser, Galeriedirektor
Philipp Jakob Becker und sein künstlerischer Nachlaß, in: Oberrheinische
Kunst, Bd. 8, 1939, S. 154-176
Ernst Ochs, Badisches
Wörterbuch, Lahr 1925-1940
Rolf Paulus und Gerhard Sauder
(Hrsg.), Friedrich Müller genannt Maler Müller, Werke und Briefe,
Briefwechsel, Kritische Ausgabe, Teil 1: Briefwechsel 1773-1811, Teil 2:
Briefwechsel 1812-1825, Teil 3: Kommentar zu den Briefen 1773-1811, Teil 4:
Kommentar zu den Briefen 1812-1825, Heidelberg 1998
Frederico Piscopo, Bianca
Milesi arte e patria nella Milano risorgimentale, Crespano 2020
Jutta Rebmann, Friederike
Robert (1795-1832) – „Madame! Sie sind die schönste aller Frauen! : neue
biographische Züge aus Friederikes Tagebuch von 1824, in: Vom Salon zur
Barrikade : Frauen der Heinezeit, herausgegeben von Irina Hundt, Stuttgart
2002, S. 143-155
Sophie Reinhard, Zehn Blätter
nach Hebels Alemannischen Gedichten, Heidelberg 1820 (Neuauflage,
herausgegeben von Adrian Braunbehrens, Heidelberg 1996)
Zehn Blätter, nach Hebels
allemannischen Gedichten componirt und radirt von Sophie Reinhard,
in: Ludwig Schorn, Kunstblatt, 1. Jg., Tübingen 1820, S. 319
Zehn Blätter nach Hebels
Alemanischen Gedichten, componiert und radirt von Sophie Reinhard,
in: Europäische Annalen, herausgegeben von Ernst Ludwig Posselt, 11. Jg.,
Stuttgart und Tübingen 1820
Zehn Blätter, nach Hebels
Alemannischen Gedichten, componirt und radirt von Sophie Reinhard,
in: Konversationsblatt. Zeitschrift für wissenschaftliche Unterhaltung,
herausgegeben von Franz Gräffer, 3. Jg., Wien 1821
Wilhelm Reinhard, Ueber jetzige Zeit und
Deutschlands zeitgemäße Politik, Karlsruhe und Baden 1831
Wilhelm Reinhard, Ernst und
Laune, aus meinen alten Papieren, Carlsruhe und Baden 1838
Arthur Rümann, Die
illustrierten deutschen Bücher des 19. Jahrhunderts, Stuttgart 1926
Johann Christian Sachs,
Einleitung in die Geschichte der Marggravschaft Baden, Fünfter Theil,
Carlsruhe 1773
Oliver Sänger, Münz- und
Geldwesen, Rheingold und Silberbergbau unter Karl Wilhelm, in: Karl
Wilhelm 1679-1738, Ausst.-Kat. Badisches Landesmuseum Karlsruhe, München
2015, S. 195-199
Jochen Schmidt-Liebich,
Lexikon der Künstlerinnen 1700-1900, Deutschland, Österreich, Schweiz,
München 2005
Arthur von Schneider, Karl
Friedrich v. Uexküll (1755-1832) ein deutscher Kunstschriftsteller des
Klassizismus, in: Zeitschrift für Kunstgeschichte, 7. Bd., H. 4, 1938,
S. 316-341
Arthur von Schneider, Badische
Malerei des 19. Jahrhunderts, 2. Auflage, Karlsruhe 1968
Arthur von Schneider, Die
Förderung des Klassizismus durch den Badischen Kunstverein, in:
1818-1968, Festschrift zum 150jährigen Jubiläum des Badischen Kunstvereins
Karlsruhe, Karlsruhe 1968, S. 37-60
Christian Schuchardt, Goethe’s
Kunstsammlungen,
Erster Theil, Jena 1848
Lore Schwarzmaier, Der
badische Hof unter Großherzog Leopold und die Kaspar-Hauser-Affäre: Eine
neue Quelle in den Aufzeichnungen des Markgrafen Wilhelm von Baden, in:
Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins, Bd. 134, N. F. 95, 1986, S.
245-262
Robert Schweitzer, Die alten
und wertvollen Bestände der Stadtbibliothek, Der Wagen. Ein Lübeckisches
Jahrbuch, 1992, S. 73-105 und 269-278
Katrin Seibert, Rom besuchen –
Italienreisen deutscher Künstlerinnen zwischen 1750 und 1850, 2 Bände,
München 2009
Émile Souvestre,
Blanche Milesi-Mojon. Notice biographique, Angers 1854
Ellen Spickernagel,
Zwischen Ideal und Wirklichkeit.
Künstlerinnen der Goethezeit zwischen 1750 und 1850. Schloßmuseum Gotha,
1.4.-18.7.1999. Rosgartenmuseum Konstanz 7.8.-10.10.1999,
in: kritische berichte – Zeitschrift für Kunst und Kulturwissenschaften, Bd.
27, Nr. 4/1999, S. 87-90
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe
(Hrsg.), Neuerwerbungen für die Gemäldegalerie 1972-1984, Karlsruhe
1984
Carsten Bernhard Sternberg, Die Geschichte
des Karlsruher Kunstvereins, Dissertation, Karlsruhe 1977
Karin Stober, Denkmalpflege
zwischen künstlerischem Anspruch und Baupraxis, Stuttgart 2003
Helmut Tenner,
Mannheimer Kunstsammler und Kunsthändler bis zur Mitte des neunzehnten
Jahrhunderts, Heidelberg 1966
Rudolf Theilmann und Edith
Ammann, Die deutschen Zeichnungen des 19. Jahrhunderts, Staatliche
Kunsthalle Karlsruhe, Karlsruhe 1978
Ulrich Thieme und Felix Becker,
Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur
Gegenwart, Leipzig 1907
Michael Thimann, Raffael als
Idee. Ein Künstlerphantasma der Romantik, Vortrag bei Fichter
Kunsthandel, Frankfurt 2014
Karl Friedrich von
Uexküll-Gyllenband, Fragmente über Italien. In Briefen an einen Freund,
Cöln 1811
Arthur Valdenaire, Friedrich
Weinbrenner, sein Leben und seine Bauten, 2. Auflage, Karlsruhe 1926
Margrit-Elisabeth Velte, Leben
und Werk des Badischen Hofmalers Feodor Iwanowitsch Kalmück (1763-1832),
Karlsruhe 1973
Horst Vey, Die frühen Jahre
der Karlsruher Kunsthalle, ihr erster Direktor, Hofmaler Becker und das
Inventar von 1823, in: Jahrbuch der Staatlichen Kunstsammlungen in
Baden-Württemberg, Bd. 41, 2004, S. 103-141
Horst Vey, Die Sammlung des Freiherrn von
Üxküll (1755-1832) und ihre späteren Geschicke, in: Jahrbuch der
Staatlichen Kunstsammlungen in Baden-Württemberg, Bd. 42, 2005, S. 83-115
Ilka Voermann, Die Kopie als Element
fürstlicher Gemäldesammlungen im 19. Jahrhundert, Berlin 2012
Karl von Wechmar, Handbuch für
Baden und seine Diener, Heidelberg 1846
Hans-Joachim Weitz, Sulpiz
Boisserée, Tagebücher 1808-1854, Bd. 1 bis Bd. 5, Darmstadt 1980 bis
1995
R. Armin Winkler, Die Frühzeit
der deutschen Lithographie, München 1975
Zentralinstitut für
Kunstgeschichte München (Hrsg.), Reallexikon zur Deutschen
Kunstgeschichte, Bd. VII, München 1981
Margarete Zündorff, Marie
Ellenrieder : Ein deutsches Frauen- und Künstlerleben, Konstanz 1940
Ausstellungskataloge
(zeitlich geordnet)
Katalog über die Kunst- und
Industrie-Ausstellung für das Großherzogthum Baden von 1823 zu Karlsruhe,
Karlsruhe 1823
Katalog über die Kunst- und
Industrieausstellung für das Großherzogthum Baden von 1825 zu Karlsruhe,
Karlsruhe 1825
Katalog über die Kunst- und
Industrie-Ausstellung für das Großherzogthum Baden von 1827 zu Karlsruhe,
Karlsruhe 1827
Katalog über die Kunst- und
Industrie-Ausstellung für das Großherzogthum Baden von 1829 zu Karlsruhe,
Karlsruhe 1829
Die Frau im Buchgewerbe und in der Graphik,
Sondergruppe der Weltausstellung für Buchgewerbe und
Graphik, Leipzig, 1914, 1. Auflage
Aus Karlsruher Privatbesitz, Gemälde Aquarelle Zeichnungen 1790-1940,
Ausst.-Kat. Badischer Kunstverein Karlsruhe, Karlsruhe 1961
1818-1968, Festschrift zum
150jährigen Jubiläum des Badischen Kunstvereins Karlsruhe,
Redaktion G. Bussmann, Karlsruhe 1968
Gottlieb Schick. Ein Maler des
Klassizismus,
Ausst.-Kat. hrsg. von Ulrike Gauß und Christian von Holst, Staatsgalerie
Stuttgart, Stuttgart-Bad Cannstatt 1974
Carl Friedrich und seine Zeit,
Ausst.-Kat. Baden-Baden, Markgräflich Badische Museen, Karlsruhe 1981
Eden revisited, Graphic Works by German Romantic
Artists, Exhibition Goethe House New York,
introduction and catalogue by Anneliese Harding, New York 1981
Albrecht Adam und seine
Familie.
Zur Geschichte einer Münchner Künstlerdynastie im 19. u. 20. Jh.,
hrsg. Ulrike von Hase-Schmundt, Ausst.-Kat. Münchner Stadtmuseum vom 23.
Oktober 1981 bis 15. Januar 1982, München 1981
Baden und Württemberg im Zeitalter Napoleons,
Ausst.-Kat. Württembergisches Landesmuseum Stuttgart, Stuttgart-Bad
Cannstatt 1987
Stephanie Napoleon Großherzogin
von Baden 1789-1860,
Ausst.-Kat. Badisches Landesmuseum Karlsruhe, Karlsruhe 1989
Johann Friedrich Overbeck
1789-1869, hrsg.
Andreas Blühm und Gerhard Gerkens, Ausst.-Kat. Museum für Kunst und
Kulturgeschichte der Hansestadt Lübeck, Lübeck 1989
Carl Ludwig Frommel 1789-1863,
Zum 200. Geburtstag,
Ausst.-Kat. Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, Karlsruhe 1989
Kunst in der Residenz – Karlsruhe
zwischen Rokoko und Moderne,
hrsg. Siegmar Holsten, Ausst.-Kat. Staatliche Kunsthalle Karlsruhe,
Heidelberg 1990
Gerhard Bott und Heinz Spielmann,
Künstlerleben in Rom, Bertel Thorvaldsen (1770-1844), Ausst.-Kat. des
Germanischen Nationalmuseums Nürnberg, Nürnberg 1992
175 Jahre Badischer Kunstverein
Karlsruhe. Bilder im Zirkel,
hrsg. Jutta Dresch
und Wilfried Rößling, Ausst.-Kat. Badischer Kunstverein Karlsruhe, Karlsruhe
1993
Bettina Baumgärtel, „…ihr
werten Frauenzimmer, auf!“, Malerinnen der Aufklärung, Ausst.-Kat.
Roseliushaus Bremen, Bremen 1993
Achim Aurnhammer, Christina
Florack-Kröll, Dieter Martin, Torquato Tasso in Deutschland,
Gedenkausstellung zum 400. Todestag (25. April 1995) im Goethe-Museum
Düsseldorf, Heidelberg 1995
Zwischen Ideal und Wirklichkeit –
Künstlerinnen der Goethe-Zeit zwischen 1750 und 1850,
hrsg. Bärbel Kovalevski, Ausst.-Kat. Schlossmuseum Gotha und Rosgartenmuseum
Konstanz, Ostfildern-Ruit 1999
Biedermeier in Heidelberg
1815-1853, Ausst.-Kat.
Kulturamt der Stadt Heidelberg 1999
Max Kunze (Hrsg.), Antike zwischen
Klassizismus und Romantik. Die Künstlerfamilie
Riepenhausen, Ausst.-Kat. Winckelmann-Gesellschaft Stendal, 2001
Katja
Herlach, Souvenir
de Pompéi, Der Zürcher Vedutenmaler Jakob
Wilhelm Huber (1787-1871),
Ausst.-Kat. Graphische Sammlung
der ETH Zürich, 16. Januar bis 22. März 2002, Zürich 2002
Sehnsucht Italien. Corot und die frühe
Freilichtmalerei 1780-1850, Ausst.-Kat. Museum Langmatt, herausgegeben
von Felix A. Baumann, Baden/Schweiz 2004
Frank Büttner und Herbert W. Rott
(Hrsg.), Kennst Du das Land. Italienbilder der Goethezeit,
Ausst.-Kat.
Neue
Pinakothek München, München und Köln 2005
Viaggio in Italia, Künstler auf
Reisen 1770-1880,
Ausst.-Kat. Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, Karlsruhe 2010
Stefan Borchardt, Wilhelm
Friedrich Gmelin, Veduten und Ideallandschaften der Goethezeit,
Ausst.-Kat. Kunstmuseum Hohenkarpfen, Beuron 2010
Unser Schwarzwald, Romantik und
Wirklichkeit,
Ausst.-Kat. Augustinermuseum Freiburg, Gesamtleitung: Tilmann von
Stockhausen, Konzeption: Maria Schüly, Katalogredaktion: Kathrin Fischer,
Petersberg 2011
Karl
Wilhelm 1679-1738, Ausst.-Kat. Badisches Landesmuseum Karlsruhe, München
2015
Friedrich
Weinbrenner 1766-1826, Architektur und Städtebau des Klassizismus,
Ausst.-Kat. der Städtischen Galerie Karlsruhe und des Südwestdeutschen
Archivs für Architektur und Ingenieurbau am KIT, Petersberg 2015
Schwarzwaldbilder
–
Kunst des 19. Jahrhunderts,
Ausst.-Kat. Städtische Galerie Karlsruhe, Karlsruhe 2016
Quellen
(zeitlich geordnet)
|
1 [NL Adam, StA München
Nr. 104]1 Karlsruhe d. 13. Jenner 1810
Lieber Adam;
Soeben erhalte ich Ihren zweiten
Brief, der mich bestimmt Ihnen zu schreiben, längst wäre dieses geschehn,
wenn mir nicht meistens alle Stimmung fehlte, die man haben muß um nicht gar
zu langweilige Briefe zu schreiben. Daß ich Sie in Wien noch gerne gesehn
hätte können Sie denken, daß mich Ihr glückliches Los, welches Ihnen in
Mailand zufiel freut wissen Sie auch, also weiter im Text! – Ihren Bruder2
suchte ich gleich auf, und fand ihn in der Gallerie, in jenem Zimmer wo sich
die Diener aufhalten, und saas mit der Brille auf der Nase, welche ihm
sogleich abgesprochen, und nur beym arbeiten zugestanden wurde, ich ging mit
ihm nachhaus, fand alles ordentlich, und recht hübsche Arbeiten, es kann
allerdings etwaß aus ihm werden, daß er manchmal zu viel Geld ausgibt
gestund er mir auf mein scharfes Examen aufrichtig, und versprach Besserung,
ich habe ihm eine schöne Zeichnung welche Nördlingen darstellt, entführt,
und das Pferd von Ihnen mitgenommen das Sie mir anwiesen, das Portrait auch
von der Geiger3 gesehn – Bey der K.4 fand mein Vorsaz
noch weiter zu gehn, ehe ich mich in M. auf die bewußte Art fixiere, Beifall
und ich wurde in den schmeichelhaftesten Ausdrüken eingeladen mich alsdann
wieder einzufinden, meine Gemälde fanden mehr Beifall als ich mir je hätte
denken können, so auch hier, wo es nach wie einer Wahlfahrt zu der Madonna
geht, einige aus Rom kommende Künstler sprachen mir besonders zu diesen
Sommer nach Rom zu gehn, ob es passiert weiß ich nicht, hätte ich eine
Reisegesellschaft so wäre mein Endschluß gefaßt, finde ich keine, so nehme
ich für diesesmahl mit Paris vorlieb, daß ich nicht hier bleibe ist ganz
gewiß denn leider liegen die 3 Monate welche ich noch nicht ganz hier war,
wie soviel Jahre in meinem Gedächtniß, ich kann nicht vergnügt seyn! ich
passe nicht mehr in den Zirkel denn ich hier fand, mein einziges Bestreben,
ist in der Kunst weiter zu kommen und da sind wenige die etwaß verstehn,
niemand der mir etwaß sagen könnte, ich sitze allein auf meinem Zimmer mahle
zeichne, componiere, und wünsche auch oft sehnsuchtsvoll zu dem Original
meines Portraits, von der guten auch gewiß glücklichen Geiger!5
meine gute Laune ist dahin, und recht gerne würde ich dieses obige Treiben
nach Ruhe, mit dem kalten langen Schlaf vertauschen. Ich kann mir nicht
denken daß je Glück für mich sich finden kann, das Hüttchen verwandelt sich
in ein Schloß, die traulichen Freunde in Hofdamen! und mein Herz wird bey
meinem vollen Beuttel leer bleiben! –
Hören Sie nichts von Ruß?6
Ich schrieb ihm bald nach meiner Ankunft, einen langen Brief, auch an
Kirchner,7 von keinem erhielt ich Andwort, ich kann mir dieses
nicht erklären, mit dem Abschied den besonders Ruß von mir nahm, mir ward
ein solches Lebewohl von uns genommen wenn sich auch meine Fantasie den
Abschied meines ersten Geliebten noch so feurig mahlt, so bleibt gegen
diesem zurück, und doch ist`s nur Freundschaft, von beiden Seiten, dien
und wer das rasche in`s Ruß Caracter kennt, dem wird nichts auffallen, aber
auffallend bleibt doch immer sein Stillschweigen, das aber vieleicht eben
ab auch durch das vieleicht zu rasche Wesen erklärt wird, denn alles waß
zu weit vom gewöhnlichen abweicht, ist meistens von kurzer Dauer; so auch in
der Freundschaft das Gegenstück von Ruß, nämlich Abel,8 schrieb
mir ein in seiner Art heißen Brief, das zu dem Benehmen in den letzten Tagen
als ich in Wien war ganz paßt, aber – mich lächert! er ist und bleibt Bruder
Samuel, ohne daß ich mich zur Juela machen will, wird ihn danndoch am Ende
von irgend einem schönen Händgen, ein Treff der Art versagt werden!
Dame Friedrich folgte uns auf
unserer Reise bis Ulm, überall musste ich mit dem Aas unter einem Dache
Nachten, endlich in Ulm nahm Sie einen andren Weg, uf und ich kam
zufällig mit dem Theil ihrer Reisegefährten zusammen, die Gelegenheit hatten
ihren schönen verbuhlten Caracter kennen, und verachten zu lernen, sie
erzehlten mir Sachen die ekelhaft sind! und ekelhaft ist auch das daß Hr. v.
Geiger9 so zärtlich und mit tausend Thränen von ihr Abschied
nahm, sie an das halten ihres Versprechens errinnerte, und Briefe versprach
zu schreiben, ja so stets mit dem alten schwachen Wohllüstling, mit Mühe
konnte ich mich entschliessen vor wenig Tagen den ersten Brief an ihn zu
schreiben. Von Schweinfurth erhielt ich keine Andwort, und so ist denn alles
zerrissen durch den Tod! – in meinem Herzen aber, liegt tief die Erinnerung
Trauer, ach auf immer verlohrene Freundschaft! ich habe verlohren waß nicht
ersezt wird, und wonach mein Herz sich so lange sehnte, eine Freundin für
Kopf, Herz und die Kunst! – ich bin ein armer armer Schelm!
Waß Sie mir in Ihrem ersten Brief
von Ihren Eltern schreiben beunruhigt mich, und ich kann nicht fragen es
ärgert mich wenn Sie auch in Briefen die fatale Gewohnheit bey behalten sich
halb auszudrüken! auf meinem Zimmer konnte ich fragen, pressen bis es kam,
aber von hier bis Mailand? es ist recht dumm von einem Hofmahler! sowie auch
die Faust ich möchte in Augsburg nach allerley Straucheleien, und
Augenmittelgen fragen! mein Gott, ich bin ja doch sonst nicht dumm noch
gegen meine Freunde bös! das mögen wohl in Nördlingen die Caffé Basen thun,
nein ich begreife nicht wie Sie dafür sich fürchten konnten! übrigens kam
ich Nachts in Augsb. an und ging vor Tag wieder ab, sah also niemand, ich
schwöre Ihnen aber daß selbst ein Aufenthalt von Jahren mich gewiß nicht
verführt hätte, Fragen zu thun, welche engen Seelen Licht über eine Sache
gegeben hätten, die ich nehme wie sie ist – und die ich nur insofern
schädlich für Sie halte als ich glaube es könne Gewohnheit daraus werden,
übrigens bleibe ich bey dem waß ich Ihnen sagte, wer wird ausschlagen wenn
er gebethen wird, kein Jüngling von Leben und Feuer, vieleicht ein Abel,
oder – der dessen Herz mit reiner Liebe an einem Mädchen hängt – also
vergeben ist Ihnen dieses und anderes, aber hören Sie meine Bitte, und
nehmen Sie sich in Acht! – ich fürchte immer!
Um das schöne Papier nicht
unbeschrieben den weiten Weg zu schiken muß ich Ihnen doch auch ein Wort von
meinen hießigen Arbeiten sagen, ich habe ein Bild aus Geßners Idillen
gemahlt, aus dem ersten Schiffer das Mädgen als sie die Vögel mit ihren
Jungen beobachtet,10 und sich dadurch auch nach Menschen sehnte,
der Ausdruk des Kopfs, Unschuld und Melancholie ist mir gelungen, aber über
das andere traue ich nicht zu urtheilen, das Portrait meines Vatters habe
ich auch angefangen,11 das sehr ähnlich zu werden verspricht,
dabey noch nach Gipsanatomie, basreliefs, gezeichnet, und auch 4 Sachen
componierd, wovon ich wohl 2 mahlen möchte!
Huber12 ist fleißig,
hat die Kost bey uns, bleibt aber immer der alte Kindskopf, der öfters
gezankt muß werden, übrigens ist er wohl gelitten in unserem Haus, und ich
hoffe er bekommt auf das Frühjahr Arbeit in einem Pallast für die Gräfin G.13
wo er sich Geld verdienen kann, der Brunnen mit den Pferden von Ihnen findet
Beifall, ich hoffe er soll ihn gut anbringen.
Schreiben Sie mir waß Sie
mahlen, und schreiben Sie überhaupt ausführlich so wie ich es thue, recht
eng und auf dünnes Papier, die Briefe kosten sonst so viel, und ich lebe
nicht wie Sie a la Midas.
Wie gings Ihnen mit dem Ring von
der Geiger? sehen Sie nach den Alten? ich bitte schreibe Er ordentlich
Adämle er is auch recht lieb und wird recht gekusselt wenn ich Ihn auf
meiner Reise nach Rom besuche, kommt er nicht auch hin so kann er dann doch
wieder eine Gouvernante brauchen, die Er an mir finden soll, kleide Er sich
auch ordentlich und wenn Er mir einmal eine kleine kleine Skizze so von
Trachten oder waß Er will schikte so wäre er recht artig. – Apropos Stunz14
war fürlich hier und hat mich mit seiner Tochter besucht, das Mädgen hat
Talent, der Vatter ist mir aber ein unausstehlicher Schwätzer, der sogar die
Sachen von Ruß so elend tadelte, daß beynah meine Gedult zu Ende ging, das
ist ein wiederlicher Kerl! er hat sich nun in München ganz angesiedelt, und
auf dem Anger15 ein Haus gekauft.
Adieu lieber Adam, leben Sie
wohl, und erinnern Sie Sich recht oft Ihrer wahren Freundin
Sophie Reinhard
in der Spital Gasse.16
1
Brief von Sophie Reinhard an Albrecht Adam aus dem Nachlass des Malers im
Stadtarchiv München.
2
Heinrich Adam (1787-1862), Maler der Münchner Künstlerdynastie. Bruder von
Albrecht Adam.
3
Margarete Geiger (1783-1809), befreundete Malerin aus Schweinfurt.
4
Königin Caroline von Bayern in München.
5
Die Freundin Margarete Geiger war einige Monate zuvor in Wien an Typhus
gestorben.
6
Karl Ruß (1779-1843), Maler, Radierer und Lithograph. Enger Freund der
Künstlerin in Wien.
7
Vielleicht Johann Jakob Kirchner (1796-1837).
8
Josef Abel (1764-1818), Historienmaler in Wien.
9
Wohl Herr von Geiger, Onkel von Margarete in Wien.
10
Salomon Gessner (1730-1788), „Der erste Schiffer“ zuerst erschienen in:
Gedichte von S. Gessner, Zürich bey Orell Gessner und Comp. 1762. Die Anregung zu diesem Gemälde
könnte Sophie Reinhard noch im Jahr zuvor bei Heinrich Füger in Wien
erhalten haben. Füger hat sich mit Themen aus dem „Ersten Schiffer“ mehrfach
befasst (vergl. Robert Keil, Heinrich Friedrich Füger 1751-1818, Wien
2009, S. 207, 321 und 362).
11
Maximilian Wilhelm Reinhard (1748-1812), Vater der Künstlerin.
12
Jakob Wilhelm Huber (1787-1871), befreundeter Maler aus Zürich.
13
Bei
diesem Palastbau kann es sich nur um das Gräflich Hochbergische Palais am
Rondellplatz in Karlsruhe handeln, das von 1798 bis 1814 von Friedrich
Weinbrenner geplant und gebaut wurde (vergl. Fritz Hirsch, 100 Jahre
Bauen und Schauen, Karlsruhe 1928, Bd.1, S. 22ff. und Friedrich
Weinbrenner 1766-1826, Architektur und Städtebau des Klassizismus,
Ausst.-Kat. der Städtischen Galerie Karlsruhe und des Südwestdeutschen
Archivs für Architektur und Ingenieurbau am KIT, Petersberg 2015, Katalog
Nr. 3.71-3.86).
14
Johann Baptist Stuntz (1753-1836) und seine Tochter Electrine Stuntz
(1797-1847), später verh. Freifrau von Freyberg.
15
Am 28. September 1809 kaufte Johann Baptist Stuntz das Haus der Thekla von
Stubenrauch am Unteren Anger Nr. 218 (vergl. Pankraz von Freyberg, Maria
Electrine Freifrau von Freyberg geb. Stuntz (1797-1847), Oberbayrisches
Archiv, Bd. 110, 1985, S. 12).
16
Das Haus der
Familie von Maximilian Wilhelm Reinhard befand sich in Karlsruhe in der
Spitalstraße (später umbenannt in Markgrafenstraße). Die Straße wurde Ende
des 18. Jahrhunderts erschlossen (vergl. Fritz Hirsch,
100 Jahre Bauen und
Schauen,
Karlsruhe 1928, Bd. 1, S. 119ff.).
|
|
2
[NL Adam, StA München
Nr. 104]1 C. R. d. 7 März
1810
Lieber Adam,
Heute erhielte ich Ihren Brief,
den ich nicht würde abgewartet haben, sondern Ihnen längst schon wieder
geschrieben hätte, wenn ich nicht in der Ungewissheit gewesen wäre ob Sie
auch mein Schreiben richtig erhalten haben? – denn ich habe wichtige Dinge
mit Ihnen abzuthun, mein Endschluß nächsten Sommer nach Rom zu gehn ist
fest, ich gedenke im August von hier dort hin über Mailand abzugehn, ich
frage daher ob es nicht möglich ist daß Sie auch ihre Reise dann mit
mir antretten könnten? ich beschwöre Sie alles anzuwenden daß möglich ist,
damit ich den Trost und die Freude habe in Ihrer Gesellschaft die lange und
für mich furchbare Reise zu machen, daß ich dort in dem fremden Lande einen
Menschen habe den ich als geprüften Freund und geschikten Künstler kenne,
dem ich manchmal das Herz daß so sehr die Mittheilung bedarf ausschütten
kann, der mir beistehe wenn ich trübe oder krank des Beistands bedarf! o
lieber Adam lassen Sie Sich nicht (wie damal als ich u die Geiger2
so baten, Sie möchten nach W.3 mitgehn) auch diesmal vergeblich
an Ihr Herz sprechen! bedenken Sie wie groß meine Freude wäre! Sie werden
doch nicht viel länger mehr warten, sollten Sie aber früher gehn, so richte
ich mich nach Ihnen wiewohl, es der beste Zeitpunkt in Ansehung der
Jahreszeit seyn würde, auf jeden Fall thun Sie mir den Gefallen und
erkundigen sich gleich bey Cassanova in Mailand wieviel es kostet mit
eine Person mit Coffre nach Rom zu bringen wenn der Veturin die ganze Reise
nebst Zehrung und Nachtquartier bestreitet, auch wie viel Zeit man zu dieser
Reise braucht, alles recht bestimmt und ob man, im Fall ich allein gehn
müsste, auch auf gute Gesellschaft zu rechnen wäre? fände ich keine
Gesellschaft von hier bis Mailand, so wird mich mein Vatter so weit
begleiten, aber von dort aus, wenn nicht mein guter Genius waltet daß Sie
mitgehn, muß ich armer Schelm allein gehen! Ach Adam wie Feuer lasse ich
mirs werden, und wie wenig Rosen unter den vielen Dornen! doch die Hoffnung
daß ich das unbeschreibliche Vergnügen haben könnte, mit Ihnen zu gehn soll
mich noch trösten, wenn ich nur recht bitten recht Ihnen alles ans Herz
legen könnte! aber der Buchstabe ist so kalt, wie ein Kupferstück gegen ein
Gemälde! gehn Sie doch mit der König schlägt Ihnen dies Gesuch gewiß nicht
ab, das grosse Bild wird noch fertig, und al andere werden Sie in Rom
mahlen so gut und besser als in Mailand, ich sehe Sie folglich alles anderes
mündlich, nur das daß ich über den bösen Italiäner nicht bös bin!4
ohne ihn hätte ich keine Hoffnung Sie mit mir in R. zu sehn! – trösten Sie
sich mit mir, mein altes Herz spielt mir der Streiche genug; unsere Beichten
werden gegenseitig seyn! – doch zähle ich auch al auf Ihre Nachsicht
und Verschwiegenheit! – am besten wäre es für mich, die Musen gäben mir
Kraft in Rom ein nahmhaftes Bild zu mahlen, und dann kämen die wohlthätigen
Partzen und trennten einen Faden, der mir zu dauernder Freude für mich
werden kann, wohl der Geiger!5 Sie hat überwunden und ich! ach
Gott wie werde ich glücklich, mit meinem verdammten weichen Herzen! – von
der Geiger Schwester6 erhielt ich einen langen Brief, unter
vielen Thränen sah ich die Schrift wieder, die ich in so paradiesischen
Zeiten las! – ich habe ihr nun den Orde beschrieben und Anleitung gegeben
wie man ihn paken soll, er hat ihnen keinen Buchstaben, seit der Anzeige des
Todes geschrieben, auch nichts selbst die Verlassenschaft nicht von der G.7
geschikt ! o der elende Wicht! ich habe ihr von den Haaren in ein Medaillon
gelegt, ich hoffe sie tragts gerne das Kind ist nur 4 Wochen alt geworden,
auch habe ich der Schwester geschrieben waß ihr Künstler Leben betrift,
damit es in Meusels Künstler Lexicon8 eingerükt werde.
Huber9 ist wohl, und
fleißig es gefällt ihm hier – er wird Ihnen schreiben. Nun nochmahl die
herzliche heiße Bitte, reisen Sie mit! waß werde ich Ihnen alles erzehlen!
schreiben Sie ja bald, Sie können denken, daß ich auf Andwort sehnlichst
harre, – noch eins dem armen Ruß geht’s übel, und ich bin vieleicht so
glücklich seinem Schiksal eine bessere Wendung zu geben, vieleicht kommt er
hier in Dienst. Ich fange nächste Woche ein groses Bild an aus Göthes
Wahlverwandschaften,10 dieß und das Portrait meiner Mutter11
(meinen V. habe ich schon gemahlt) soll meine lezte hiesige Arbeit seyn,
Adam Adam gehn Sie mit, lassen Sie nicht allein ziehn Ihre bis in den Tod
treue
S. R.
1
Brief von Sophie Reinhard aus Karlsruhe:
„a Signore
Alberto Adam, Pittore
del
vice Re nella Contrada
della
Passarella cassa Pozzi
No
439.
à
Milano“
aus dem Nachlass des Malers im
Stadtarchiv München.
2
Margarete Geiger (1783-1809), befreundete Malerin aus Schweinfurt, mit der
Sophie Reinhard gemeinsam in Wien studierte.
3
Wien.
4
Gemeint ist wohl Adams Dienstherr Eugène de Beauharnais.
5
Die am 4. September 1809 in Wien verstorbene Freundin Margarete Geiger.
6
Katharina Sattler geb. Geiger (1789-1861), Schwester der Margarete Geiger
(vergl. Ferdinand Gademann, Das Zeichenbuch der Katharina Geigerin,
Würzburg 1929).
7
Die in Wien verstorbene Margarete Geiger.
8
Johann Georg Meusel, Teutsches Künstlerlexikon, Lemgo.
9
Jakob Wilhelm Huber (1787-1871), befreundeter Maler aus Zürich.
10
Johann Wolfgang von Goethe’s Roman „Die Wahlverwandtschaften“ war erst ein
Jahr zuvor in Tübingen bei Cotta erschienen.
11
Jacobina Reinhard (1752-1826), Mutter der Künstlerin.
|
|
3
[NL Uexküll,
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe]1 [Karlsruhe, den 15. Juli 1810]
Hochwohlgebohrner Freyherr,
Hochgeehrtester Herr Geheimer
Rath,
Schon vor mehreren Wochen
erhielte ich durch die Gräfin Wrangel2 die Nachricht, Euer
Excellenz würden sich vieleicht entschließen, mich bey Ihrer bevorstehenden
Reise nach Rom, wohin ich zu gehn gedenke, in Ihre Gesellschaft aufzunehmen,
und Hr. Professor Danneker3 würde desfalls an mich schreiben, da
ich den Werth mit einem Manne der meine ganze Hochachtung und mein ganzes
Vertrauen verdient, diese Reise zu machen, wohl kenne so wartete ich bisher
mit Verlangen auf Nachricht von Hr. P. Danneker, und da diese bis jetzo
nicht erfolgt ist nehme ich mir die Freiheit mich an Euer Excellenz selbst
zu wenden, und zu fragen, ob ich wohl Hoffnung habe diese Reise in
Gesellschaft Euer Excellenz vorzunehmen.
Von hier bis Zürich ist einer
früheren Verabredung gemäß der Wagen mit 4 Personen besezt, von Zürich bis
Mailand werde ich in Gesellschaft meines Vatters und meiner Schwägerin4
reisen, welche sich aber dort von mir trennen, und es wäre möglich daß ich,
wenn sich keine Reisegesellschaft für mich fände von Mailand bis Rom, allein
mit ganz fremden Menschen reisen müßte, ein Maler den ich kenne, und der in
Mailand bey dem vice König angestellt ist5 wird sich zwar bemühn
eine für mich passende Gelegenheit zu finden, aber im glücklichsten Fall
wird kein Begleiter mir das seyn waß ich von Euer Excellenz Geborgenheit
hoffe. – Meine Reise würde ich gegen das Ende vom Monat August antretten,
meinen Weg über Stutgard nehmen wenn ich hoffen dürfte mit Euer Excellenz
reisen zu können, jedoch sowohl in Abstich auf die Zeit, als die
übrige Einrichtung meiner Reise, würde ich gerne alles so einrichten wie Sie
wünschen. Ich habe die Ehre mit ausgezeichneter Hochachtung zu seyn
Euer Excellenz
Karlsruhe d. 15 July 1810
gehorsamste
Sophie Reinhard
1
Brief von Sophie Reinhard an Karl Friedrich Freiherr von Uexküll (1755-1832)
aus dessen Nachlass in der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe.
2
Gräfin
Wrangel, vielleicht Caroline Sophie Reichsgräfin Truchseß von Waldburg
(1777-1816), verh. seit dem 5. Mai 1801 mit August Ludwig von Wrangel.
3
Johann Heinrich von Dannecker (1758-1841), Bildhauer aus Waldenbuch,
Professor an der Hohen Karlsschule in Stuttgart.
4 Amalia Reinhard
geb. Meier (1784-1832), seit 1803 verheiratet mit Wilhelm Reinhard dem Bruder der
Künstlerin.
5
Albrecht Adam (1786-1862), Schlachten- und Pferdemaler aus Nördlingen, den
Sophie Reinhard aus ihrer Studienzeit in München und Wien kannte, war damals
in Diensten des Vizekönigs Eugène de Beauharnais in Mailand.
|
|
4
[NL Uexküll,
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe]1
[Karlsruhe, den 22. Juli 1810]
Hochwohlgebohrner Freyherr,
Hochgeehrtester Herr Geheimer
Rath,
Sie waren so gütig mir Ihren
Reiseplan mitzutheilen, der in Rücksicht der kurzen Zeit die er erfordert,
und des wenigen Geldes das er kosten wird, ganz nach meinem Wunsch wäre,
wenn nicht dadurch die Reise meines Vatters scheitern müßte, auf mein
Zureden entschloss sich, mein 62.jähriger Vatter,2 der seit
40jährigem Dienst nichts für sein Vergnügen that, bis Mailand mit zu gehn,
er verspricht sich Vergnügen von dieser Reise, und ich hoffe eine
Luftveränderung soll seine oft schwankende Gesundheit stärken, gerne würde
sich aber mein guter Vatter jeden Plan zu seinem Vergnügen, aufgeben,
wenn es mir nützen kann, so würde er auch gewiß ohne Anstand dieser Reise
entsagen, wenn ich mit dem Herrn Geheimen Rath ginge, besonders da er das
vortheilhafte in dieser Gesellschaft nach Rom zu reisen wohl einsieht, –
Aber ich gestehe es offenherzig, daß ich fest entschlossen bin jede
Reisegesellschaft wenn sie auch noch so angenehm für mich seyn sollte,
lieber auszuschlagen wenn sich die Reise meines Vatters nicht damit
vereinigen ließe, ich würde mir gewiß oft Vorwürfe machen die Ausführung
dieses Plans gefördert zu haben, der so guten Folgen Eindruk auf
seinen Geist und Körper haben kann! – ich danke Ihnen daher recht sehr, und
bedaure daß ich nicht so glücklich seyn kann in Ihrer Gesellschaft diese
Reise zu machen, ich hoffe der Himmel verlässt mich nicht und führt mir in
Mailand wenigstens irgend einen ehrlichen Menschen zu, in dessen
Gesellschaft ich versorgt bin, der Zufall hat schon oefters für mich
gesorgt, wenn ich es nicht konnte, die Liebe zur Kunst hatt mich schon
mehrere mahl in aehnliche Verlegenheiten gebracht. – Ich habe die Ehre mit
Vollkommenster Hochachtung zu seyn
Euer Hochwohlgebohrn
Karlsruhe d. 22 July 1810
gehorsamste
Sophie
Reinhard
1
Brief von Sophie Reinhard an Karl Friedrich Freiherr von Uexküll (1755-1832)
aus dessen Nachlass in der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe.
2
Maximilian Wilhelm Reinhard (1748-1812), Vater der Künstlerin.
|
|
5
[NL Uexküll,
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe]1
[Karlsruhe, den 27. Juli 1810]
Hochwohlgebohrner Freyherr.
Hochgeehrtester Herr Geheimer
Rath.
Ihren Brief vom 25. erhielte ich
gestern, und mit einigem Vergnügen ergreife ich heute die Feder, um Ihnen zu
andworten, und zu sagen daß ich nun hoffe ich werde mit Ihnen und mit Ihrer
Gesellschaft nach Rom reisen können! – wenn unser Reiseplan bestehn kann,
und Sie mich in Mailand aufnehmen wollen so weiß ich gar nichts mehr waß
meine Hoffnung stören könnte, ich werde dann gerne alle meine Wünsche auf
die Ihrigen beschränken, wir sind entschlossen zu Ende Augusts von hier weg
zu reisen, reisen aber nicht bey Nacht, werden in Zürich 2 Tage bleiben, da
ich aber weder den Weg noch irgend einen Gasthof in Mailand kenne so kann
ich nicht bestimmen wann wir dort seyn können, und wo wir uns einfinden
sollen, ich muß daher den Herrn Geheimen Rath bitten, selbst auszurechnen,
wann wir dort seyn können, und wo
wir uns einquartieren sollen? wir werden dann alles anwenden, um in Mailand
zu seyn, bevor Sie dort ankommen, damit Ihre Reise nicht aufgehalten werde,
mein Vatter, und meine Schwägerin bleiben ohne das mehrere Tage da, ehe sie
Ihre Rükreise antretten, was ich mithehme ist ein kleiner Koffre, der meine
Kleidung und Wesche enthält, ich gestehe daß ich mich von diesem nicht
trennen mag, weil ich erfahren habe wie fatal das voran schiken
unentbehrliche Sachen oft anfällt, als ich von Wien hier her reiste schikte
ich einen Verschlag welcher meine Mahlkiste Farben Pinsel, und Gipsabgüsse
enthielt, ich war 2 Monat hier bevor dieses ankam waß ich doch 4 Wochen vor
meiner Abreise von Wien abschikte, und durch mein Freund besorgen ließ, der
alles that, um diese Kiste bald hierher zu bringen. – Weiter weiß ich
nichts mehr hi zu sagen was
irgend einer Erwähnung bedürfte. – daß ich es für ein Glück halte wenn ich
in Rom an Ihrer Frau Gemahlin3 eine Freundin finde, ist gewiß,
ich lernte in Wien Verwande von ihr kennen die mir vieles von ihr sagten,
das sie mir achtungswerth machte. –
Ich sollte es zwar bedauern wenn der Herr
Geheimrath expres nach Carls R. kommen, aber ich muß gestehn daß ich es
freylich wünsche, wenn sich dadurch der Reiseplan mit Ihnen zu gehn
befestigt, und ich hoffe dieses gewiß. – Heute gehe ich nach Steinbach, wo
ich bis Sonntag bleibe, längstens Montag früh wieder zurück komme. –
Ich habe die Ehre mich zu empfehlen
Karlsruhe d. 27
July
1810
Sophie Reinhard
Wir werden über den Gothart gehn.
Mit Bedauern muß ich bysezen daß
dieser Brief durch meine Schuld bis heute hier liegen geblieben ist. Den 2t
Aug. 10. M. W. Reinhard. Geh. Rath.4
1
Brief von Sophie Reinhard an Karl Friedrich Freiherr von Uexküll (1755-1832)
aus dessen Nachlass in der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe.
2
Maximilian Wilhelm Reinhard (1748-1812),
Vater der Künstlerin.
3
Elisabeth Freifrau von Uexküll geb. Hardegg (1771-1814), Gemahlin des Karl
Friedrich von Uexküll.
4
Nachsatz beigesetzt von Maximilian Wilhelm Reinhard, dem Vater der
Künstlerin.
|
|
6
[Thorvaldsens Museum, gmVI, nr. 46]1
[Rom] d. 17. Mai.
Hiebey folgt
die Zeichnung zurück welche Sie die Güte hatten mir auf einige Zeit zu
überlassen,
wofür ich Ihnen auf das verbindlichste danke.
Sophie
Reinhard.
1
© Ernst Jonas Bencard,
Kira Kofoed & Inge Lise Mogensen Bech (eds.): The Thorvaldsen Letter
Archives, Letter of 17. Mai between Sophie Reinhard and Bertel Thorvaldsen
http://brevarkivet.thorvaldsensmuseum.dk/letters/gmVI,nr.46
, Zugriff vom 24. Mai
2013
»All Signor/Torvalsen
[in Rom].« Brief ohne
Jahreszahl (möglich in den Jahren 1811
bis 1814).
|
|
7
[NL Uexküll,
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe]1
Rom am Himmelfahrts-
tag2
Für die Nachricht Ihrer
glücklichen Ankunft in Neapel danke ich Ihnen recht sehr, es freut mich
herzlich daß die Frau von Ixküll3
sich dort so gut gefällt, und ich hoffe daß der gute Erfolg der Seebäder
auch Ihnen den dortigen Aufenthalt angenehm machen wird. Den Auftrag an den
Kofferwirth besorgte ich sogleich, und bereits werden Sie einen Brief
erhalten haben, den ich Samstag schon dort fand, als ich einen von meinem
Vatter4
abholte, mit
Erstaunen mußte ich in diesem Brief meines Vatters kein Wort von Lindemair5
zu finden, ich begreife gar nicht wo er steckt! – Huber6
ist heute 8 Tag mit Keller7
nach Aricia gegangen, die freundschaftliche Erinnerung an alle übrige
Künstler habe ich ausgerichtet, nur Wagner8
sah ich noch nicht. Bey Matrazo9
sah ich das angefangene Bild von der F v. Guviez das mir ausnehmend wohl
gefiel, und lezten Samstag war ich mit einer Gesellschaft von Künstlern in
der Capelle von Fiesole,10
die mir weit besser gefiel als ich erwartete, ich war ganz erstaunt über die
herrlichen Bilder! lezten Sonntag war ich ebenfalls in großer Gesellschaft
in einer Vigre nicht weit von der Villa albano, wo wir zu Mittag assen und
Abends im schönen Garten spazieren gingen, es ist mir leid daß ich diesen
Ort erst jezo kennen lernte, vieleicht hätten Sie und Frau von Ixküll
manchen Abend vergnügt dort hingebracht, man hat eine himmlische Aussicht,
ist gut und billig bedient, in
reinlichem Zimmer. –
Inzwischen hat sich die Zahl meiner Hausgenossen vermehrt, ein junger
Architect aus Kassel Nahmens Engelhart11
wohnt seit wenig Tagen bey Pollinis,12
er hat auch Empfehlungen an Sie. – Roos13
und seine Frau wollte ich heute besuchen traf aber niemand an; ich
hinterließ aber die Nachricht Ihrer Glücklichen Ankunft der Alten Magd. Von
der Rosa und Giuseppe sah und hörte ich seit Ihrer Abreise nichts, übrigens
sah ich auch nie hinauf, da michs nicht freut die Fenster verschlossen zu
sehn. Die Hitze und Zahl der Flöhe nehmen hier mit jedem Tag zu, inzwischen
ist beides noch erträglich, und Rom bleibt immer schön wenn auch schmuzig
hoffentlich wird die Reinlichkeit in Neapel nicht alle Annehmlichkeiten Roms
überwiegen? An Kramer14
und Fischer15
mein Compl. – der Frau v Ixküll, und Ihnen empfehle ich bestens,
Sophie
Reinhard
1
Brief von Sophie Reinhard:
„a
Monsieur
le Baron d’Ixkull,
freres
Breyer
à
Naples”
aus dessen Nachlass in der
Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Bei den Frères Breyer dürfte es sich um
eine aus Stuttgart stammendes Familie handeln,
die sich Ende
des 18. Jahrhunderts in Neapel niederließ und dort Handel betrieb. 1808 ist in Neapel ein
Ludwig Breyer nachweisbar.
2
Als Datum kommt nur der 23. Mai (Himmelfahrtstag) 1811 in Frage. Anlässlich
seiner letzten Italienreise machte sich Freiherr von Uexküll mit seiner Frau
am 14. Mai 1811 von Rom nach Neapel auf (vergl. Horst Vey, Die Sammlung
des Freiherrn von Üxküll (1755-1832) und ihre späteren Geschicke, in:
Jahrbuch der Staatlichen Kunstsammlungen in Baden-Württemberg, Bd. 42, 2005,
S. 94).
3
Elisabeth Freifrau von Uexküll geb. Hardegg (1771-1814), Gemahlin des Karl
Friedrich von Uexküll.
4
Maximilian Wilhelm Reinhard (1748-1812), Vater der Künstlerin.
5
Wohl Karl Lindemann, Kaufmann aus Markirch/Elsaß, der mit Carl Ludwig
Frommels ältester Schwester Katharina Philippina (1787-1829) verheiratet
war.
6
Jakob Wilhelm Huber (1787-1871), befreundeter Maler aus Zürich.
7
Wohl Dr. Carl Urban Keller (1772-1844), Advokat und dilettierender Zeichner
aus Marbach bei Stuttgart.
8
Johann Martin Wagner (1777-1858), Maler und Bildhauer aus Würzburg, lebte
seit 1804 in Rom.
9
José Madrazo (1781-1859), spanischer Maler und Radierer, lebte von 1803 bis
1819 in Rom. 1811 bis 1815 Kammermaler des in Rom lebenden Exkönigs Karl IV.
von Spanien.
10
Wohl die von Fra Angelico da Fiesole ausgemalte Kapelle Nikolaus V. im
Vatikan in Rom.
11
Johann Daniel Engelhard (1788-1856), Architekt aus Kassel, lebte von 1811
bis 1812 in Rom.
12
Wohl die Vermieter des Hauses an der Piazza Trinità die Monti in dem Sophie
Reinhard wohnte.
13
Karl Roos (1775-1837), Kunsttischler aus Ludwigsburg, lebte seit 1804 in
Rom.
14
Tjarko Meyer Cramer (1780-1812), Maler aus Ostfriesland, lebte seit 1804 in
Rom.
15
Ferdinand Fischer (1784-1860), Baumeister aus Stuttgart, lebte von 1808 bis
1812 in Rom. Fischer und Cramer begleiteten die Familie Uexküll nach Neapel
(vergl. Horst Vey, Die Sammlung des Freiherrn von Üxküll (1755-1832) und
ihre späteren Geschicke, in: Jahrbuch der Staatlichen Kunstsammlungen in
Baden-Württemberg, Bd. 42, 2005, S. 94).
|
|
8
[NL Uexküll,
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe]1 Rom Sonntags Juni2
Gestern hörte ich von H. v.
Schmidt3 Sie würden noch 4-6 Wochen in Neapel bleiben, ich freue
mich über diese Nachricht da sie mir ein Beweiß zu seyn scheint daß Ihnen
die Luft dort nun besser bekommt, da ich aber auch weiß wie sehr Sie Sich
für alles waß R.4 angeht interesieren so will ich das was sich
seit wenig Tagen zutrug getreu berichten. Vor 8 Tagen hatten wir Abends 10
Uhr ein heftiges Erdbeben das zwar nicht so stark war als jenes im Winter,5
uns aber doch in nicht geringe Furcht sezte, und wieder viele Menschen auf
die Straße jagte, Huber6 der in Aricia war erzehlt daß es dort
viel stärker gewesen sey als alle andere welche man bisher spührte, auch
hatte das Zimmer in welchem Sie und F. v. Ixkull schliefen einen zimlichen
Sprung bekommen. Vorgestern fand man morgens das hölzerne Crucifix im
Collosseo, (unter dem Bogen beym Torwirt) ganz zerstümmelt, Hände Füsse und
der Kopf waren abgesägt, und lagen theils auf dem Altar in der Capelle
theils im Coloseo zerstreut, daß dies viel Aufsehn erregte werden Sie
glauben, eine Menge anderer die mit Vertrauen dort ihr Gebet verrichteten,
versammelten sich und äusserten ihr Mißvergnügen, daher bleiben viele
gestern bey der Illumination zu Hauß, worunter auch ich war, das wenige waß
ich von der Loge des Hauses sehn konnte ist alles, doch hörte ich daß sich
das ganze schön ausgenommen habe, besonders das Colloseo, das aber
verschlossen war, auch der Corso war schön beleuchtet die neben Strasen aber
blos durch den Mond! heute ist Girandola und Cupol, aber auch dieses werde
ich nur von der Loge sehn. Der alte Capell Meister der Peterskirche bekam
den Auftrag auf dieses Fest eine Musik zu componieren, er schlug es ab, und
wurde gestern nach Corsica abgeführt. Gestern Abend 11 Uhr waren wieder zwei
Er[d]stöße. – Inzwischen hat sich abermahl unser Haus vermehrt, und zwar durch
die Ankunft eines Architekten aus Carlsruh den ich kenne, und dessen
Gesellschaft mir Vergnügen macht.7 Heute 8 Tag waren wir in der Villa borgese
dort am See, es waren 11 Personen, Eberhard8 Steinkopf9
u Leipold10 waren auch dabey, wir assen etwas kaltes, und genossen
den herrlichen Abend.
Koch11 hat bereits die
Parzen fertig, ich glaube diese Zeichnung wird Ihnen Vergnügen machen, mit
dem goldenen Zeitalter ist er auch zimlich weit. Signor Keller,12
auch Schleichle genannt, war mit Sposa auf dem Land, und hat dem Stugarder
Keller13 erzehlt die Geschichte des Geldes, welches Sie
ihm geliehen haben erzehlt und bemerkt Sie müßten die Venus nehmen,
Sie hätten sie bestellt, er habe sie verfertigt, und darüber andere Arbeiten
liegen lassen, Huber will nun ein Billet an ihn schreiben, und wird Ihnen
dann das weitere berichten. Gemmerig14 und der unstäte Raktig15
sind lezten Montag abgereist, lezterer kam noch vor der Abreiße zu mir um
mir endlich freundschaftliche Erinnerungen von Ihnen und der Frau v. Ixkull
auszurichten – oder – um zwei Empfehlungs Schreiben bey von mir zu
bekommen die ich ihm nicht gegeben hätte wegen seiner späten Visite, wenn er
nicht der armen Witwe unser Wascherin 9 Scudi gegeben hätte, diese Frau hat
eine schwere Brustkrankheit gehabt, und kam dadurch in große Noth, sie ist
nun wieder auf, gestern besuchte ich sie, und war in Versuchung ihr etwaß in
Ihrem oder der Fr v. Ixkul Nahmen zu reichen, da ich Ihre Wohltätigkeit
kenne, und das Elend dieser braven Famillie sah! die Tochter ist auch ganz
mager geworden.
Die Rosa war auch bey mir, und
erzehlte Signor Day16 sey dermahlen propio senza denaro, und er
nebst der Signora Day ließen mich sehr einladen sie zu besuchen, ich war
aber noch nicht dort, und der Sohn sey mehr Narr als je.
Schik17 befindet sich
in Aricia beinahe wieder ganz wohl, der Huber sagt er arbeite gehe
spazieren, und sey recht wohl zufrieden, – daß der brave Roden18
Rom verlässt, ist mir sehr leid, und allen die ihn kennen, es möchte wohl
schwer seyn, daß sein er ersezt wird, denn Redlichkeit,
Geschiklichkeit, mit Bildung verbunden, ist doch etwaß seltenes – Baron
Kniphausen19 sehe ich manchmal durch die Straßen schweben, hatte
aber noch nicht die Gnade von denselben besucht zu werden, doch das wäre zu
verschmerzen, aber das bereits einer meiner Pretendenten von meinem
Triumpfwagen loß, und an einen andern gespannt hat, das ist traurig, Canova20
heurathet eine Witwe aus Florenz, Staches21 besucht mich noch
immer, will mir aber nur seine knöcherne Hand reichen, wenn ich mich bekehre
und catolisch werde, aber ich war stark blieb dem Glauben meiner Väter, und
dem großen Calvin getreu, und so wird denn nun auch dieser Jüngling für mich
verlohren seyn!!! – Madam Heß22 die Witwe des Mahlers, heurathet
Stelze aus Bremen, der nun nach Zürich zieht.
Mit Roos23 und seiner
Frau war ich im Teater, und sah Graf Armand24 elend geben, hörte aber auch die
berühmte Heser,25 die zwar künstlich singt, mir aber doch nicht
recht gefiel.
Hr. v. Huth26 ist nun
in dikster amur mit der jüngsten Tochter der Marona in aricia, Huber brachte
eine Liste mit die wenigstens eine Cana27 mißt auf welcher und nichts
als Band Perlen x enthält, die hier eingekauft werden, und dort von Huth dem
Mädchen geschenkt werden. Sie sind wohl mein Geschwäz herzlich satt? – ich
empfehle mich Ihnen und der Fr v. Ixkull bestens
S. R
1
Brief von Sophie Reinhard an:
„Monsieur
le Baron d’Ixkull
chez les freres Breyer
à
Naples”
aus dessen Nachlass in der
Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe.
2
Als Datum kommt nur der Juni des Jahres 1811 in Frage.
3
Dr. Ludwig Friedrich von Schmidt (1764-1857), Hofprediger und Berater von
Caroline Königin von Bayern geb. Prinzessin von Baden.
4
Abkürzung für Rom.
5
Das „European Archive of Historical Earthquake Data“ verzeichnet am
18.02.1811 ein Erdbeben der Magnitude von 4,8 mit dem Epizentrum Rom.
6
Jakob Wilhelm Huber (1787-1871), befreundeter Maler und Reisebegleiter von
Sophie Reinhard aus Zürich.
7
Bei dem namentlich nicht genannten Architekten könnte es sich um den
Weinbrenner-Schüler Johann Friedrich Dyckerhoff (1789-1859), Bruder des
bekannteren Ingenieurs und Architekten Jakob Friedrich Dyckerhoff
(1774-1845), handeln. Jakob Friedrich Dyckerhoff kann es nicht gewesen sein,
denn Beringer bestreitet, dass Jakob Friedrich jemals in Rom gewesen sei
(vergl. Joseph August Beringer, Jakob Friedrich Dyckerhoff 1774-1845,
Ingenieur, Architekt, Maler und Daguerreotypeur in Mannheim, in:
Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins, N. F., Bd. 47, 1934, S. 267).
Gabriele Fünfrock hat ferner darauf hingewiesen, dass Jakob Friedrich
Dyckerhoff im Juni 1811 laut seinem Tagebuch mit dem Umbau des Treppenhauses
von Schloss Herrnsheim bei Worms beschäftigt und außerdem kein
Weinbrenner-Schüler war, sondern erst 1816 als Hofarchitekt nach Karlsruhe
berufen wurde, weshalb Sophie Reinhard ihn vor ihrer Abreise nach Rom auch
nicht kennenlernen konnte (vergl. Gabriele Fünfrock, Jakob Friedrich
Dyckerhoff – ein Architekt des Frühklassizismus im Großherzogtum Baden –
1774-1845, Worms 1983, S. 16, 18, 38 und 164).
8
Wohl Konrad Eberhard (1768-1859), Bildhauer aus Hindelang, lebte mit seinem
Bruder in Rom von 1806 bis 1819 und von 1821 bis 1826.
9
Gottlieb Friedrich Steinkopf (1779-1860), Maler aus Stuttgart, lebte von
1808 bis 1814 in Rom.
10
Karl Jakob Leybold (1786-1844), Maler aus Stuttgart, lebte wie Steinkopf von
1808 bis 1814 in Rom.
11
Joseph Anton Koch (1768-1839), Landschaftsmaler aus Obergiblen in Tirol,
lebte seit 1795 in Rom. Die Zeichnung der Parzen ist bei Lutterotti WV Koch
nicht aufgeführt. Zur Zeichnung „Das Goldene Zeitalter“ vergleiche
Lutterotti WV Koch Nr. 392.
12
Heinrich Keller, genannt Schleichle (1771-1832), Bildhauer und
Schriftsteller aus Zürich, lebte seit 1794 in Rom.
13
Dr. Carl Urban Keller (1772-1844), Advokat und dilettierender Zeichner aus
Marbach bei Stuttgart. Begleitete Freiherr von Uexküll und seine Frau auf
der Reise von Stuttgart nach Rom.
14
Gemmerig, nicht ermittelt.
15
Raktig, nicht ermittelt.
16
Alexander Day (1773-1841), englischer Maler und Kunsthändler.
17
Gottlieb Schick (1776-1812), Maler aus Stuttgart, lebte in Rom seit 1802.
18
Johann Martin von Rohden (1778-1868), Landschaftsmaler aus Kassel, lebte
seit 1795 in Rom.
19
Carl Freiherr von Knyphausen aus Lütersburg im Fürstentum Ostfriesland (vergl. Lutterotti WV Koch Nr. 424).
20
Antonio Canova (1757-1822), Bildhauer aus Possagno, lebte seit 1779 in Rom.
Sein Grabmal
für die Erzherzogin Marie Christine in der Augustinerkirche in Wien hatte
Sophie Reinhard während ihrer Ausbildung bei Füger kennen und bewundern
gelernt.
21
Staches, nicht ermittelt.
22
Ludwig Heß (1760-1800), Maler und Kupferstecher aus Zürich, war von 1790 bis
zu seinem Tode verheiratet mit Anna Barbara geb. Wegmann.
23
Karl Roos (1775-1837), Kunsttischler aus Ludwigsburg, lebte seit 1804 in
Rom.
24
Graf Armand, Oper von Luigi Cherubini.
25
Charlotte Vera geb. Häser (1784-1871), Sängerin aus Leipzig, sang erstmals
1808 in Rom, heiratete 1814 den Konservator des städtischen Archivs
Giuseppe Vera und lebte in Rom bis zu ihrem Tod im Jahre 1871.
26
Carl Wilhelm von Huth (1778-1818), dänischer Hauptmann.
27
Canna, italienisches Längenmaß, 1 canna = 2 Meter.
|
|
9
[NL Uexküll,
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe]1 Rom d 20 Juny
1811
Sey es nun Spott oder Ernst daß
ich dort oben für mein Geschauer den Lohn bekommen solle, so klingt es doch
genehmer, als wenn man für die beste Meinung hören muß die Weiber seyn böse
Kröten waß mir so oft hier, mit Ihnen begegnete und jedes Mal mein Herz
durchschnitten hat! aber ich hoffe das Salz des Seewassers soll einige
wohlthätige Wirkung haben, und das der Zunge in etwaß dämpfen.
Vor allem ein Wort über den
schönen Plan nach welchem ich bis 1814 im Mai hier bleiben könnte, ja so
wohl wird mir nicht, viel früher wird die Stunde meiner Abreise kommen, und
mit ihr das Ende meines Lebens, denn das heißt nicht leben wie ich weiter
hier in C.R2 oder an einem andern Ort leben werde, ohne Genuß und
ohne Freiheit, und der Wunsch daß meine lezte Reise nach der Piramide3
seyn möchte ist mir daher weit verzeilicher als gewissen Leuten, die immer
wieder nach Rom kommen können, und geht mir auch gewiß mehr von Herzen, wenn
ich an die Abreise denke läuft mir die Katze den Rüken herauf. – Schleichle4
wird wohl an Sie geschrieben haben? – der Wascherin gab ich die 4 Scudi in
Ihrer und der Fr. v Ixkull Nahmen, mit dank heißem Dank nahm sie das
Geld, und gestand daß ihre Lage sehr bedrängt sey, ein zweiter Anfall hat
sie so mager gemacht, daß ich glaube das Ende ihres Elends ist bald da, ich
soll dem guten Paar in Neapel sagen, daß sie es nie vergessen, und den
Himmel um Segen für Sie beide bitten werde.
Wegen dem Modell vom M. Aurel5
hat Eberhard6 mit Posky7 gesprochen, er hat es erst
angefangen, weil er bisher mit dem verfertigen der Schweine und Hunde
beschäftigt war. – Waß sagen Sie dazu daß Schiks8 Frau in
gesegneten Umständen ist? der Thäter hat den Plan gemacht Sie sollten
seine Frau und das jüngste Kind mit nach Stutgart nehmen, wohin er in Jahr
und Tag dann auch kommen will, doch will ich von dem alles nichts gesagt
haben, denn leicht könnte mir’s üble Früchte tragen – Koch9 war
soeben mit dem Aeltsten Rippenhausen10 bey mir, lezterer ging
früher fort da sagte ich ihm waß Sie mir von ihm geschrieben haben, es
freute ihn sehr, und bey der Gelegenheit entdekte er mir er möchte Sie und
die F v. I. gerne zu Gevatter11 bitten wenn er wüßte Sie thätens
nicht mit Wiederwillen, und in der Überzeugung daß es nicht Interresse
sondern aus die lauterste Absicht sey. Ich bin bereits förmlich
geladen, und thue es mit Vergnügen, – Wenn Sie doch dem braven Mann, seine
Schweizer Landschaft verkaufen könnten an Häugele!12
Vom 28 Mai erhielte ich Briefe
von Hauß wieder kein Wort von Lindemann!13 Die Costum sind
angekommen, und haben Freude gemacht. Gestern ist Roden14 fort,
heute wieder ein Wagen voll es wird recht leer von deutschen Künstler.
Feodor der Kalmuc15 ist längst in CR. angekommen, aber noch nicht
bey meinen Eltern gewesen! der hat doch auch die platte Nase nicht umsonst.
Keller16 der fleißige Zeichner ist heute nach Fraskati nebst dem
gelben Hund, der sich ganz fest an ihn hält, und nicht übel dabey fährt, er
hat ihn nun auf dem Hals, und ist zu gutmüthig um ihn fort zu jagen, Sie hat
jenes oft wohlthätige Scepter dafür bewahrt. Fankerl17 der sehr
von der Hitze leidet empfiehlt sich Ihnen, und dem Morle bestens, ich habe
nun auch 2 schöne Holztauben, in meinem Zimmer spazieren.
Die Girandola18 und
Cupolbeleuchtung sah ich sehr gut von meiner Loge aus, auf dem piazza
Navonna sah ich das Pferdrennen, ein einzig schöner Anblick, daß hätten Sie
sehn sollen, viele Freude hätten Sie gehabt, im August soll ein weiteres
seyn.
Drei Juden welche unter dem fr.
Militair sind haben das Cruzifix im Colossé zerstümmelt und sitzen bereits.
Auf der isola farnese hat man
neuerdings schöne Sachen gefunden, unter andren 2 kolossalische Köpfe von
Tiber, und August (dieser soll besonders schön seyn) zu beiden hoft man auch
die Statuen zu finden, Eberhart war gestern mit Wagner19 dort.
Die nechste Woche gedenke ich
nach Tivoli zu gehn, um einige Pflanzen zu zeichnen, aber hauptsächlich um
frische Luft zu athmen, die Hitze ist unerträglich, schon 2 Grad höher als
vorigen Sommer im August, waß wird das am Ende noch werden? heute haben wir
starken Wind, und einige phrofezeihn ein Erdbeben, ein schöner Trost!
Schmekt denn der Fr v. I. die
neapolitanische Küche? Und vergißt sie denn Rom ganz? – Leben Sie recht wohl
und behalten in gutem Angedenken
Sophie R
d 21.
1
Brief von Sophie Reinhard an:
„Monsieur
le Baron d’Ixkull,
chez les
freres Breier
à
Naples”
aus dessen Nachlass in der
Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe.
2
Abkürzung für Carlsruhe.
3
Protestantischer Friedhof an der Pyramide des Cestius.
4
Heinrich Keller, genannt Schleichle (1771-1832), Bildhauer und
Schriftsteller aus Zürich, lebte seit 1794 in Rom.
5
Freiherr von Uexküll hatte im Januar 1811 für 60 Piaster bei Giuseppe
Boschi, Bildhauer und Bronzegießer, ein Modell der „Reiterstatue des Mark
Aurel“ in Bronze bestellt.
6
Wohl Konrad Eberhard (1768-1859), Bildhauer aus Hindelang, lebte mit seinem
Bruder in Rom von 1806 bis 1819 und von 1821 bis 1826.
7
Posky = Giuseppe Boschi.
8
Gottlieb Schick (1776-1812), Maler aus Stuttgart, lebte seit 1802 in Rom.
9
Joseph Anton Koch (1768-1839), Landschaftsmaler aus Obergiblen in Tirol,
lebte seit 1795 in Rom.
10
Franz Riepenhausen (1786-1831), Maler aus Göttingen, lebte seit 1805 mit
seinem Bruder Johann (1788-1860) in Rom.
11
Gevatter = Taufpate.
12
Die Landschaft aus den Schweizer Alpen = Der Schmadribachfall I (Lutterotti
WV Koch Nr. 16). Mit Häugele könnte Heigelin gemeint sein.
13
Wohl Karl Lindemann, Kaufmann aus Markirch/Elsaß, der mit Frommels ältester
Schwester Katharina Philippina (1787-1829) verheiratet war.
14
Johann Martin von Rohden (1778-1868), Landschaftsmaler aus Kassel, lebte
seit 1795 in Rom.
15
Feodor Iwanowitsch, genannt Kalmück (um 1763-1832), seit 1806 badischer
Hofmaler, reiste am 23. November 1810 in Rom ab (vergl. Karl Obser,
Feodor Iwanow. Ein Karlsruher Hofmaler aus der Zeit des Klassizismus,
in: Ekkhart, Jahrbuch für das Badner Land, 11. Jg., 1930, S. 21). Feodor
Iwanowitsch wurde wie Sophie Reinhard bei Philipp Jakob Becker in Karlsruhe
ausgebildet. Er war der Künstlerin sicher schon vor ihrer Abreise nach
Italien bekannt, denn er war seit 1806 Hausgenosse von Friedrich
Weinbrenner, wo Sophie Reinhard häufiger Gast war (vergl. Margrit-Elisabeth Velte, Leben und Werk des Badischen Hofmalers Feodor Iwanowitsch Kalmück
(1763-1832), Karlsruhe 1973, S. 38).
16
Wohl Dr. Carl Urban Keller (1772-1844), Advokat und dilettierender Zeichner
aus Marbach bei Stuttgart.
17
Fankerl, Name des Hundes von
Sophie Reinhard.
18
Girandola = Feuerwerk.
19
Johann Martin Wagner (1777-1858), Maler und Bildhauer aus Würzburg, lebte
seit 1804 in Rom.
|
|
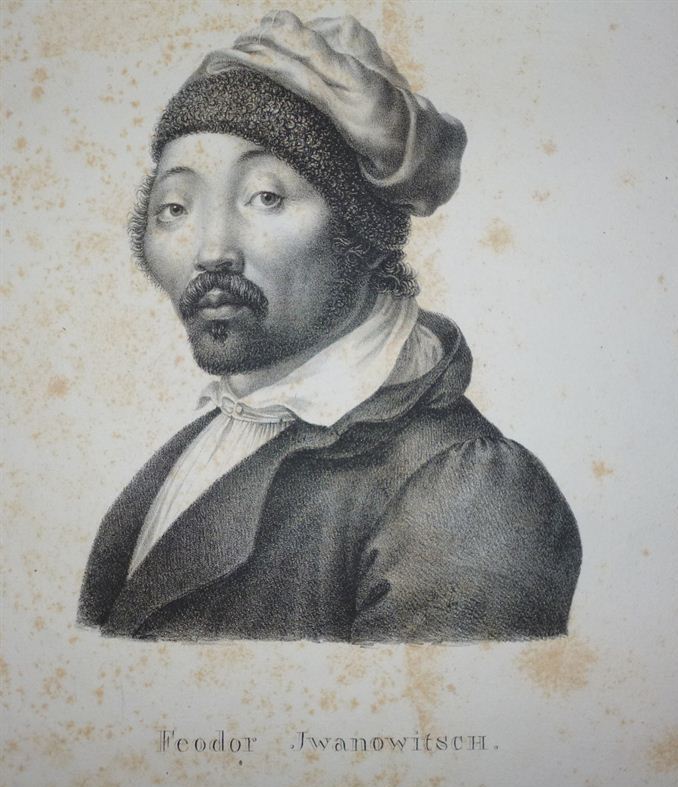
Brustbild des
Karlsruher Hofmalers
Feodor Iwanowitsch Kalmück (1763-1832).
Lithographie von Karl Joseph Brodtmann
nach einem Selbstportrait des Künstlers
(vergl.
Margrit-Elisabeth Velte, Leben und Werk des Badischen Hofmalers Feodor
Iwanowitsch Kalmück (1763-1832), Karlsruhe 1973, WV 2g, S. 232,
Bildnachweis: E. Fecker)
|
|
10
[NL Uexküll,
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe]1 Rom d. 26. 7ber
1811
Theils hoffte ich auf einen Brief
von Ihnen, theils auch auf Materialien um einen erträglichen Brief an Sie
theurer Freund schreiben zu können, aber von Ihnen kommt kein Brief und neues
will es hier auch nicht geben. Gestern erfuhr ich durch einen Brief von
meinem Vatter2 daß Sie wenigstens den 9ten dieses noch
nicht in CR3 waren, meine Eltern verlangen Sie und Fr v. Üxküll4
zu sehn.
Unser Freund und Gevatter Koch5
der wie er mir gestern sagte Ihre Hülfe anrufen will, wird Ihnen eine
traurige aber gewiß nicht übertriebene Beschreibung seiner Lage geben, der
arme Mann muß nun in Jahren wo doch jeder, der auch nur den 3tel
lernte von dem waß er weiß auf sicheres Brod rechnen kann, Rom, seine Frau
und Kind verlassen, um anderwärts Brod zu suchen, er that würklich alles waß
sich thun ließ um von Bayern etwaß zu erhalten, ich glaube aber nun selbst
daß ihm dort nicht aufgethan wird er klopfe auch an so oft er wolle! hier
wird es immer theurer, dazu immer weniger Freunde, darunter beinah keine die
etwaß kaufen, niemand missbilligt daher Kochs Vorhaben nach Wien zu gehn, es
ist nicht zu denken daß er der nichts verschmäht und in jedem Fache etwaß
gutes leistet, bey guten Empfehlungen seinen Zweck verfehle, sollte er aber
auch dort nichts finden, so hat er doch noch immer so viel als er hier
verließ. Geben Sie dem Ehrlichen Mann das Geld, so wird er Ihnen zum
zweitenmahl sein Glück danken, und ich zweifle nicht auch bald wenigstens
einen Theil der Summe zurück geben können. – Daß Hr. Schleichle6
sich nicht mehr bey mir bliken lässt wird Sie nicht wundern.
Reinhart7 soll auch in
einer mißlichen Lage seyn und denkt auch Rom zu verlassen; – kurz das Elend
steigt mit jedem Tag bey all denen die weder Vermögen noch ein Gehalt haben.
– Ab Poschi8 habe ich 18 Scudi gegeben gegen Quittung
Huber9 20, ich habe also noch 2 von Ihren in Händen, Day10
läßt nichts von dem Wagen hören, ich glaube beinah, Sie oder Hr. von Rak,11
hat sich an ihm einen üblen Geschäftsträger gewählt, seine Frau war mehrere
Monathe auser dem Hauß, wohnt aber jetzo wieder im Hauß ihres Mannes, doch
oben wo Sie wohnten, da sie fürchtet der Sohn möchte zum zweitenmal
glücklich seyn in seinem Versuch sie umzubringen. Kramer12 soll
am hinscheiden seyn in Neapel, seine Krankheit hat sich in eine Auszehrung
verwandelt, weßwegen er dort aus dem Hause gestoßen wurde, und mit Mühe
endlich noch in einer verlassenen Wohnung Obdach fand. – Ich war 3 Wochen in
Tivoli machte von da eine Reise nach Subiaco, zu Esel (den ich nun
meisterhaft reite) ich sah sehr viel schönes. – Meiner lieben Frau v. Uxküll
viele Empfehlungen. Leben Sie recht wohl
Reinhard
1
Brief von Sophie Reinhard an Karl Friedrich Freiherr von Uexküll (1755-1832)
aus dessen Nachlass in der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe.
2
Maximilian Wilhelm Reinhard (1748-1812), Vater der Künstlerin.
3
Abkürzung für Carlsruhe.
4
Elisabeth Freifrau von Uexküll geb. Hardegg (1771-1814), Gemahlin des Karl
Friedrich von Uexküll.
5
Joseph Anton Koch (1768-1839), Landschaftsmaler aus Obergiblen in Tirol,
lebte seit 1795 in Rom.
6
Heinrich Keller, genannt Schleichle (1771-1832), Bildhauer und
Schriftsteller aus Zürich, lebte seit 1794 in Rom.
7
Johann Christian Reinhart (1761-1847), Maler und Radierer aus Hof, lebte
seit 1789 in Rom.
8
Giuseppe Boschi, Bildhauer und Bronzegießer, bei dem Freiherr von Uexküll im
Januar 1811 für 60 Piaster ein Modell der „Reiterstatue des Mark Aurel“ in
Bronze bestellt hatte, das Sophie Reinhard am 30. Dezember 1811 in Empfang
nahm (vergl. Abrechnung zwischen Sophie Reinhard und Freiherr von Uexküll im
Jahre 1815).
9
Jakob Wilhelm Huber (1787-1871), befreundeter Maler aus Zürich.
10
Alexander Day (1773-1841), englischer Maler und Kunsthändler, verkaufte für
Uexküll eine Kutsche, wofür Day 20 Scudi zahlte (vergl. Abrechnung zwischen
Sophie Reinhard und Freiherr von Uexküll im Jahre 1815).
11
von Rak, nicht ermittelt.
12
Tjarko Meyer Cramer (1780-1812), Maler aus Ostfriesland.
|
|
11
[NL Adam, StA München
Nr. 104]1 Rom d. 22. 8ber
1811
Theurer Freund,
Es ist nun ein Jahr daß ich hier
bin, und beinahe ebenso lange daß ich Ihren Brief erhielt von Ancona,2
längst – das werden Sie mir glauben – hätte ich Ihnen geschrieben, wenn Sie
mir nicht in Ihrem Brief gesagt hätten Sie machten eine Reise, also auch
diese Zeilen schreibe ich auf geradewohl, und sobald Sie mir andworten werde
ich Ihnen von meinem hiesigen Leben schreiben, heute nur so viel, daß mir’s
bisher gut ging, und daß ich diese Reise nicht bereue da sie nützlich für
mich war. Überbringer dieses ist ein Landsmann von mir, der hier in große
Noth kam,3 eine Collecte die ich veranstaltete, sezt ihn in den
Stand bis Mailand und vielleicht weiter seiner Heimath zu, zu reisen, ich
bitte Sie können Sie ihm eine kleine Beisteuer geben, es zu thun wenig ist
viel für den der nichts hat, er ist ehrlich und würde ohne Hülfe im Elend
umkommen! – die Zahl derer die etwas geben können ist hier klein, und oft
fehlt auch der gute Wille, Sie sind in einer Lage die Ihnen das geben nicht
verbiethet, und Ihr Herz kenne ich. – Schreiben Sie ja gleich wenn Sie
dieses erhalten, Sie können sich vorstellen daß ich mit unveränderlicher
Freundschaft oft an Sie denke, und nach Nachrichten verlange, – viel werde
ich Ihnen schreiben, sobald ich weiß daß meine Briefe in Ihre Hände kommen.
Huber4 grüßt Sie –
unveränderlich Ihre
Freundin
Sophie Reinhard
1
Brief von Sophie Reinhard:
„al Signor
Adam, Pittore del vice
Ré
à
Milano
se trova a Monza”
aus dem Nachlass des Malers im
Stadtarchiv München.
2
Im Oktober 1809 war Albrecht Adam im Rang eines Kapitäns in die Dienste des
Vizekönigs von Italien Eugène de Beauharnais (1781-1824) getreten und nahm,
ausgehend vom Hof in Monza, an mehreren Feldzügen in Norditalien teil, so
kam er auch nach Ancona, das zum Besitz von Beauharnais gehörte.
3
Namentlich nicht genannter Landsmann der Künstlerin.
4
Jakob Wilhelm Huber (1787-1871), befreundeter Maler aus Zürich.
|
|
12
[NL Uexküll,
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe]1 Rom d. 9. 9ber 1811
Ich beandworte heute Ihre beyde
Briefe, vom 3 und 19 8ber, – daß ich mich ein wenig über das lange
Stillschweigen ergerte läugne ich nicht, und gestehe auch ebenso aufrichtig,
daß ich so gültig ich auch Ihre Abhaltungen finde, denn doch die Frau v.
Ixküll2 gar
nicht entschuldigt finde daß sie mir auch jetzo da sie bey meinen Eltern war
nicht ein Wort schrieb, da sie mir dieses doch mehr als einmahl versprach,
schön gesagte Briefe haben für mich wenig Werth, wenn sie die Sprache der
Freundschaft führen freuen sie mich, und wie man spricht soll man ja
schreiben, also könnte wohl die Freundin, der Freundin schreiben, die gewiß
alles versteht wie sie es verzeit, und viel Freude hätte!
Koch3
schreibt Ihnen selbst also von dieser Sache nichts.
Day4
hat den Wagen längst verkauft aber bisher das Geld in der Tasche, wo ich es
nicht zu bekommen weiß. Poschi5
jammert schreklich er könne ohne weitern Vorschuß den Aurel nicht endigen,
der wie Eberhard6
sagt recht gut seyn soll (nehmlich im Modell).
Von meinem Vatter7
werden Sie hören daß leider mein billiger Banquier failliert hat, und auch
nun Torlonia8
ebenso unbarmherzig schröpft wie alle anderen. – Hier geht alles im alten
Schlendrian, le Thier9
hat ein großes Bild ausgestellt welches
das Urtheil den
Brutus darstellt, wie er seinen Sohn verurtheilt, nach franzö. Sitte ist
natürlich einer schon enthauptet, es sind keine Römer, es sind Franzosen,
inzwischen hat das ganze viel Verdienst, und herrscht Seele in allem, wird
aber von vielen erbärmlich herunter gemacht, besonders von seinen
Landsleuten. Ein gewißer Cornelius10
aus Düsseldorf ist angekommen der aus Göthes Faust vortreffliche Zeichnungen
gemacht hat, von denen nun Koch, Müller11
und die Rippenhausen12
zusammen, und nach und nach jene in isidoro13
herabsetzen, woran die Ripp. schuld seyn mögen, denen Overbeck14
ein Stein des Anstoßes war, übrigens wird es schwer seyn jemand zu finden
der geschikter ist! Catel15
aus Berlin Mahler ist auch angekommen mit seinem Bruder der Architekt ist
und eine Frau bey sich hat, artige Leute, die Briefe an mich hatten, und die
ich alle 3 zu Kochs Frau logierte, die nun ihr Auskommen hat, wenn Koch
fortgeht. Huber16
ist auch in Geld Nöthen und wenn Sie erlauben werde ich ihm seine lezte
Platte von jäner Summe bezahlen welche Sie schiken. Roos17
der nun viel zu thun hat, ließ die Sache wegen Keller18
die er sich erboth auszufechten ganz liegen, mit dem ist gar nichts zu
machen! verspricht alles und hält nichts! – Die Frau ist glücklich daß das
Gewerbe so gut geht denn nun werden endlich ihre Ohren die lange gewünschten brillanti bekommen! Kramer19
lebt noch, aber ohne Hoffnung, vor 14 Tag hat er denn auch sein Ketzerthum
abgelegt, se fatto buono e a ricevuto jesu christo, wie meine Hausfrau
sagte, worüber ich und viele sich ärgern. Engelhard20
gab richtig das Mädchen auf, 14 Tage nachher spann er wieder an, und fand
auch wieder Gehör, wiewohl er in dem Absage Brief schrieb er habe sich
übereilt, und gefunden daß mir eine Italiänerin von anderer Religion,
Sprache; und ohne
Bildung für ihn nicht passe – das zweitemahl hielt er Wort heurathete sie
und zog vor 4 Wochen nachdem er noch Beweise seines verrückten Kopfes
ablegte mit ihr ab, war auch so niederthrächtig zu sagen, ich habe die
meiste Schuld daß er das erste mal zurück gegangen sey. – beyde werden
bezahlt werden er für seine Lügen und Dummheiten, sie für ihre Begirde unter
die Haube zu kommen, denn waß kann sie erwarten! – aber das Mädchen und die
Mutter sind eben auch Pack!
Könnten Sie nicht von Reinharts21
radierten Blättern in Stuttgard absetzen? – der October war 21 Tag himmlisch
schön, ich war 2 mahl auf testaccio,22
und 2 mahl in der Vigna, bey buna della ocrità sehr vergnügt. – Meine
Elisabetha23
habe ich untermahlt, und glaube sie wird weniger schlecht als meine andere
Arbeiten. Schik24
hat 4 exemplare von Kochs radierten blättern mitgenommen die bei mir in CR.25
bestellt wurden ich habe die 8 scudi längst an Koch bezahlt, und bin besorgt
die Blätter möchten nicht an Ort und Stelle kommen, haben Sie die Güte sich
zu erkundigen, wann Schik ankommt, sie sollen an Haldenwang26
adressiert werden.
Rohden27
und Sikler28
lassen nichts von sich hören.
Wie sieht den mein guter Vatter
aus? ich bin sehr unruhig wegen seiner Gesundheit! und habe mir vorgenommen
abzureisen wenn er kränkelt, um ihn wenigstens noch zu sehn, ach ich
verlöhre ja an ihm den besten liebsten Freund, den mir der Himmel gab! – und
wenn er nicht mehr ist, bin auch ich nur noch halb auf dieser Erde.
Möchten Sie recht gesund bleiben
und vergnügte Tage haben, gedenken Sie ferner mit Freundschaft an mich, und
glauben Sie daß ich die kleinen Geschäfte recht gerne besorge, so
gut ich kann.
RS.
1
Brief von Sophie Reinhard:
„a Monsieur
le Baron d’Ixkull
l’ainé
à
Stutgard
Wurtemberg.“
aus dessen Nachlass in der
Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe.
2
Elisabeth Freifrau von Uexküll geb. Hardegg (1771-1814), Gemahlin des Karl
Friedrich von Uexküll.
3
Joseph Anton Koch (1768-1839), Landschaftsmaler aus Obergiblen in Tirol,
lebte seit 1795 in Rom.
4
Alexander Day (1773-1841), englischer Maler und Kunsthändler, verkaufte für
Uexküll eine Kutsche, wofür Day 20 Scudi zahlte (vergl. Abrechnung zwischen
Sophie Reinhard und Freiherr von Uexküll im Jahre 1815).
5
Giuseppe Boschi, Bildhauer und Bronzegießer, bei dem Freiherr von Uexküll im
Januar 1811 für 60 Piaster ein Modell der „Reiterstatue des Mark Aurel“ in
Bronze bestellt hatte, das Sophie Reinhard am 30. Dezember 1811 in Empfang
nahm (vergl. Abrechnung zwischen Sophie Reinhard und Freiherr von Uexküll im
Jahre 1815).
6
Wohl Konrad Eberhard (1768-1859), Bildhauer aus Hindelang, lebte mit seinem
Bruder in Rom von 1806 bis 1819 und von 1821 bis 1826.
7
Maximilian Wilhelm Reinhard (1748-1812).
8
Giovanni Raimondo Torlonia (1754-1829),
italienischer Bankier.
9
Guillaume Lethière (1760-1832), von 1807 bis 1817 Direktor der französischen
Akademie in Rom.
10
Peter von Cornelius (1783-1867), Maler aus Düsseldorf, lebte von 1811 bis
1819 in Rom. Seine Faustzeichnungen hatte er in seinen Frankfurter Jahren
begonnen und dafür von Goethe reichlich Lob erhalten (Friedrich von
Boetticher, Malerwerke des neunzehnten Jahrhunderts, Leipzig
1891-1901, Bd. 1, S. 191, Nr. 28).
11
Friedrich Müller (1749-1825), Maler und Dichter, lebte seit 1778 in Rom.
12
Franz Riepenhausen (1786-1831), Maler aus Göttingen, lebte seit 1805 mit
seinem Bruder Johann (1788-1860) in Rom.
13
San Isidoro, verlassenes Kloster in Rom, welches sich die Lukasbrüder zu
ihrem Wohnort wählten.
14
Johann Friedrich Overbeck (1789-1869), Maler aus Lübeck, lebte seit 1810 in
Rom.
15
Franz Catel (1778-1856), Maler aus Berlin, lebte seit Ende 1811 mit seinem
Bruder Ludwig (1776-1819) in Rom.
16
Jakob Wilhelm Huber (1787-1871), befreundeter Maler und Radierer aus Zürich.
17
Karl Roos (1775-1837), Kunsttischler aus Ludwigsburg, lebte seit 1804 in
Rom.
18
Heinrich Keller (1771-1832), Bildhauer und Schriftsteller aus Zürich, lebte
seit 1794 in Rom.
19
Tjarko
Meyer Cramer (1780-1812), Maler aus Ostfriesland, lebte seit 1804 in Rom.
Cramer wurde im Oktober 1811 katholisch, mit neuem Taufnamen Lukas.
20
Johann
Daniel Engelhard (1788-1856), Architekt aus Kassel, heiratete am 3. November
1811 Annunziata Bossi, Tochter des Kupferstechers Giacomo Bossi.
21
Johann Christian Reinhart (1761-1847), Maler und Radierer aus Hof, lebte
seit 1789 in Rom.
22
Der Monte Testaccio ist ein kleiner Hügel in Rom.
23
Ihr Gemälde „Heilige Elisabeth mit dem Johannesknaben“.
24
Gottlieb Schick (1776-1812), Maler aus Stuttgart, lebte seit 1802 in Rom.
Schick reiste
anfangs September 1811 nach Stuttgart, wo er am 7. Mai 1812 starb.
Er
wanderte mit Koch 1804 nach Olevano, wo die ersten Zeichnungen zu Kochs
zwanzig Radierungen Römischer Ansichten entstanden (Otto von Lutterotti,
Joseph Anton Koch 1768-1839, Berlin 1940, S. 52).
25
Abkürzung für Carlsruhe.
26
Christian Haldenwang (1770-1831), aus Durlach, seit 1805 Hofkupferstecher in
Karlsruhe.
27
Johann Martin von Rohden (1778-1868), Landschaftsmaler aus Kassel, lebte
seit 1795 in Rom.
28
Friedrich Sickler (1773-1836), Altertumsforscher aus Gräfentonna, lebte seit
1805 in Rom.
|
|
13
[NL Uexküll,
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe]1
Rom d. 27. 9ber
1811
Vor einigen Tagen erhielte ich
Ihren Brief vom 11 dieses, nebst dem Wechsel, Fischer2 erhob diese 200 piastre bey T.2
und ich habe bereits Boschi3
weitere 20 ausbezahlt, recht gerne besorge ich die kleinen Geschäfte des
Freundes den ich ehre, und der gewiß viel mehr thun würde, wenn ich irgend
ein Gesuch hätte! inzwischen ärgerte ich mich über Boschi nicht wenig da ich
hörte er habe geäussert Sie hätten ihm bey der Abreise versichert es sey
alles besorgt wegen des Geldes für den M. A.4,
ich würde also wohl das Geld haben, und ihm vorenthalten, sey das nicht so
soll ich das von Day5
erle
für die Carette6
erlöste Geld zu bekommen suchen, Sie werden glauben daß ich nicht wenig
entrüstet war mich so nach italienischem Maßstab gemessen zu sehn! – ich
puzte ihn daher auch heute ordentlich deshalb aus, und sagte ihm daß ich
eine deutsche
sey, keine italiänerin, noch zu der Classe gehöre wozu ich Day zehle den ich
für einen getauften Juden hielte! – Mark Aurel7
soll bis Ende Xber fertig werden, und soll richtig durch De Sartio spediert
werden. Huber8
der auch in Geldnöthen war bezahlte ich eine Platte, ich muß daher bey den
lezten 20 Piaster die Boschi bekömt Kochs9
reisegeld angreifen, das gar nichts auf sich hat, da dieser erst im Aprill
nach W. geht, und zwar mit Frau und Kind, er mahlt an aqua cetosa10
für den Asbek in M. wird dieses Bild noch hier endigen, und vieleicht auch
das große der Regenbogen,11
das wie er hoft
sicher hoft nach Stut. kommt. Sie haben daher wegen Ihres Geldes nicht
nöthig in Sorgen zu seyn. – Ach könnte ich einen Tag mit Ihnen reden so
sollten Sie hören waß der gute Mann einen Drachen von Weib am Hals hat, ich
zehle auf heilige Verschwiegenheit, und sage Ihnen nur soviel, daß sie im
lezten Jahr vieleicht 100 Scudi zu unnöthigen Sachen heimlich, man kann
sagen dem Manne stohl, es wurden Diamanten Ohrenringe golden Ketten und
anderes angeschaft, während er halbsatt arbeiten mußte wie ein Pferd! – die
20 Scudi welche Sie ihr ins Kindbett gaben wurden abseits geschaft, und 4
andere welche ich ihr schenkte, auch Koch verhehlt, der es endlich durch
Zufall erfuhr, Catels12
hat sie so geschnürt das die nach einem Monat schon heute
fe
ausziehn, Koch hat zwar über vieles das er weiß, und dadurch das ihm einfiel
nachzurechnen waß er dieß Jahr verdient habe, Bariere geschlagen, aber er
wird wieder übertölpelt, und ich mäger Sie der Sie durch viele
Freundschaftdienste ein Recht haben etwaß zu sagen, sollten ihm einen
italiänischen
Brief schreiben worin Sie der Frau das Capitel über unnöthigen Aufwand
tüchtig lesen, ohne Datas aufzuführen weil Sie sonst auf mich verfallen
würde, und ich mag mit dem Aas nichts zu thun haben – sondern wünschte
vielmehr als
Sie sollten den Brief so einrichten als hätten Sie es von dennen die nach
Deutschl. zurück gekommen sind gehört. Kommt K. nach Wien, und verdient
Goldneberge, so muß er schlecht und wenig fressen und der
mistug
dürre Steiß der Madam wird alles bekommen, waß nicht auf Busen, und in den
Ohren Plaz findet! Oh der arme Mann! helfen Sie ich bitte, doch schonen Sie
meiner. Koch hält zwar viel auf mich, und ich habe sein ganzes Zutrauen,
aber ihm fehlts an Pfiff ich kann ihm nichts sagen, die Alte mit Zugehör hat
er aus dem Haus gejagt, nun erzehlte diese den Ankauf der Diamanten und
Ketten. Wenn doch nur eine Malingea oder so etwaß über das Mensch käme! das
Kind macht sich nun ganz ordentlich wiewohl ihm die zärtliche Mama Mohn
genug eingibt. Eine brave Frau ist mir Orela, und wer die hat der klage
nicht wenn ihm ein Maierhof abbrennt, besonders wenn er doch noch einige
Bajocki übrig behält! –
Cramer13 lebt noch. Heute kam Zoll14
von C.R. an. Wagner15 sehe ich nicht, bat aber Eberhard16
ihm Ihr Gesuch zu melden, Steinkopf17 soll mehr hipockondrisch
seyn als lustig. – Alles waß Sie kennt empfiehlt sich, auch Staches18
mit dem ich, Huber und Dalle’armi19 öfters spielen, er verlohr
schon mehrere piaster –. Morgen gehe ich in die Gallerie Daria,20
um mich Raths zu erholen, ich bin mit meiner Elisabeth ziemlich vorgerükt.
Mein Vatter21 schrieb mir wie sich alle die Meinigen freuen Sie
und die F. v. G.22 in C.R. zu sehen, daß mir die böse Frau nicht
schreibt verzeih ich nicht, und ruhe auch nicht bis sie meinen Wunsch
erfüllt – Huber führt die Rechnung Ihres Geldes pünktlich. Leben Sie recht
wohl. – die lieben piferari ziehn bereits durch Rom, und erfreuen mein Herz,
könnten Sie nur auch diese mahlerischen Burschn sehn. Leben Sie recht wohl
und behalten lieb Ihre redliche Freundin
RS
1
Brief von Sophie Reinhard an:
„Monsieur
le Baron d’Ixkill
l’ainé
à
Stutgard
Wurtemberg“
aus dessen Nachlass in der
Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe.
2
Ferdinand
Fischer (1784-1860), Baumeister aus Stuttgart, lebte von 1808 bis 1812 in Rom.
3
Wechsel auf Giovanni Raimondo Torlonia (1754-1829), italienischer Bankier,
vom 26. November 1811 über 200 Scudi (vergl. Abrechnung zwischen Sophie
Reinhard und Freiherr von Uexküll vom 5. Februar 1812 und vom Jahre 1815).
4
Giuseppe Boschi, Bildhauer und Bronzegießer.
5
Abkürzung für Mark Aurel.
6
Alexander Day (1773-1841), englischer Maler und Kunsthändler.
7
Caretta = einspännige, offene Kutsche für zwei Personen. Day zahlte dafür 20 Scudi
(vergl. Abrechnung zwischen Sophie Reinhard und Freiherr von Uexküll im
Jahre 1815).
8
Bei G. Boschi hatte Freiherr von Uexküll im Januar 1811 für 60 Piaster ein
Modell der „Reiterstatue des Mark Aurel“ in Bronze bestellt, das Sophie
Reinhard am 30. Dezember 1811 in Empfang nahm (vergl. Abrechnung zwischen
Sophie Reinhard und Freiherr von Uexküll vom 5. Februar 1812 und vom Jahre 1815).
9
Jakob Wilhelm Huber (1787-1871), befreundeter Maler und Radierer aus Zürich.
10
Joseph Anton Koch (1768-1839), Landschaftsmaler aus Obergiblen in Tirol,
lebte seit 1795 in Rom. Er heiratete laut Friedrich Noack, Das Deutschtum
in Rom, seit dem Anfang des Mittelalters, Stuttgart 1927, Bd. 2, S. 322 am
1. September 1806 Cassandra Ranaldi. Er unterbrach seinen Romaufenthalt, um
von 1812 bis 1815 in Wien zu leben.
11
Aqua cetosa = Tiberlandschaft bei Acqua Acetosa (Lutterotti WV Koch Nr. 19)
für Franz Wilhelm Freiherr von Asbeck in München.
12
Koch hoffte die Landschaft mit dem Regenbogen II (Lutterotti WV Koch Nr. 30)
dem württembergischen König Friedrich I. in Stuttgart verkaufen zu können.
13
Franz Catel (1778-1856), Maler aus Berlin, lebte seit Ende 1811 mit seinem
Bruder Ludwig (1776-1819) in Rom.
14
Tjarko Meyer Cramer (1780-1812), Maler aus Ostfriesland, starb am 26. April
1812 in Rom.
15
Franz Joseph Zoll (1770-1833), Maler aus Möhringen/Baden, lebte von 1811 bis 1813
in Rom.
16
Johann Martin Wagner (1777-1858), Maler und Bildhauer aus Würzburg, lebte
seit 1804 in Rom.
17
Konrad Eberhard (1768-1859) und Franz Eberhard (1767-1836), beide Bildhauer
aus Hindelang, lebten in Rom von 1806 bis 1819 und von 1821 bis 1826.
18
Gottlieb Friedrich Steinkopf (1779-1860), Maler aus Stuttgart, lebte von
1808 bis 1814 in Rom.
19
Staches, nicht ermittelt.
20
Wohl
Andreas Dall’Armi (1788-1846),
Landschaftsmaler und Lithograph aus München. Laut R. Armin Winkler, Die
Frühzeit der deutschen Lithographie, S. 53, betrieb Dall’Armi
zusammen mit Raphael Wintter seit 1805 die erste lithographische Druckerei
in Rom.
21
Wohl Galleria Doria im Palazzo Doria, um Rat zu ihrem Gemälde
„Die
heilige Elisabeth“
einzuholen.
22
Maximilian Wilhelm Reinhard (1748-1812), Vater der Künstlerin.
23
Vielleicht Abkürzung für Friederike von Gaisberg geb. von Uexküll
(1759-1825), die man in C.R. (Abkürzung für Carlsruhe) erwartet.
|
|
14
[NL Uexküll,
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe]1
[Rom] d. 5. February
1812
Ich hätte Ihnen früher auf Ihren
Brief vom 4 Januar geandwortet, wenn ich
nicht durch allerley neue Studien worunter auch die Anatomie gehört wäre
abgehalten worden, ich muß jeden Morgen nach S. Vitale2 lauffen,
und dort sitze ich in Gesellschaft noch zweier Mahlerinnen (die eine von
Bologna3 die andere von Mailand4) 6 bis 7 Stund vor
einem Stück Fleisch das nicht immer ganz angenehm anzusehn ist, und zeichne
mir in kaltem Zimmer Finger und Füsse ganz starr, Sie können denken daß ich
dann Abends nicht fähig zum schreiben bin, waß Sie heute meinem Brief
anmerken werden. Von Müller5 erhielt ich schon vor 14 Tage
beiliegendes Blatt an Sie, verrathen Sie mich nicht daß ich es erst heute
schike. Poschi6 hat sein Pferd längst fertig, und jedermann
findet die Arbeit schön und sehr wohlfeil, zu einer andren Zeit würde dieses
Pferd 150 Scudi gelten, auch hat kürzlich ein Römer ein gleiches aber viel
kleiner und bei weitem nicht so gut an einen Fremden für 45 Zechinen7
verkauft. Mit Boschi sprach ich schon zweimal wegen das Fortschickens, er
versprach zu Desartio zu gehn die Kiste und alles zu besorgen (gepakt soll
es bey mir werden) durch Desartio, aber der Boschi ist so ein langsames
Thier den man immer treiben muß, und mit dem Geschäfte zu machen, nicht
immer angenehm ist, mit Roos8 ist gar nichts anzufangen denn der
hat zu viel eigne Geschäfte, Koch9 hat die Abdrüke von guin
todarti,10 ich sagte er solle sie Fischer11 bringen
der sie mitnehmen kann, bey Abruzzi12 war ich noch nicht, ich
will sehn daß Huber13 hin geht, weil ich schwer Zeit finde. Nun
will ich Ihnen denn auch Rechnung ablegen, und hören ob Sie zufrieden mit
meiner Verwaltung sind, ich wußte es nicht besser zu machen, das ist alles
waß ich sagen kann!
| |
Erhalten
Scudi.
B. |
|
|
Ausgegeben
Scudi
B |
|
bey Ihrer Abreise |
40 |
|
|
Huber für eine Platte |
22 |
|
|
als Abtrag von Keller |
2 |
40 |
|
Boschi |
18 |
|
|
durch Wechsel |
200 |
|
|
Huber für S. onofrio |
22 |
|
| |
242 |
40 |
|
porto carte de regiae |
|
|
| |
|
|
|
den 3. 8ber brief porto |
|
18 |
| |
|
|
|
den 19. 9ber detto |
|
18 |
| |
|
|
|
23. Xber detto |
|
35 |
| |
|
|
|
an Boschi |
42 |
|
| |
|
|
|
an Huber die Fragmente von Colonna |
22 |
|
| |
|
|
|
Brief porto |
|
19 |
| |
|
|
|
an Koch |
45 |
|
| |
|
|
|
dem alten Franceso |
|
50 |
| |
|
|
|
Briefporto |
|
18 |
| |
|
|
|
|
172 |
58 |
Also habe ich nun noch 69 Scudi und 72 Bajochi.
– Sie gaben mir zwar keinen bestimmten Auftrag Hubers fernere Arbeiten zu
bezahlen, da ich ihm aber bereits 40 Scudi geliehn, und er kein Geld hatte,
so konnte ich nicht anderst und indem meine Casse nicht so ist daß ich
mehreres hätte vorstreken können. Koch, hofft für sein Bild nach M.14
hinlängliches Reise Geld zu bekommen, und holt nun soviel als er bis zur
Zeit da er sein Geld bekommt, zum Unterhalt braucht, von Huber Boschi und
Koch habe ich Quittungen, die Ihnen zu Befehl stehn, – Schleichle15
hat das Gewehr gestrekt auf Ihren kräftigen Brief, er schrieb an Huber da
nun die Venus16 verkauft sey, und er in 14 Tag das Geld bekommen
werde er alles in Richtigkeit bringen, und wundere sich daß H v. I so
viel Aufhebens wegen einer Kleinigkeit mache die er nie anderst angesehn
habe, als daß er sie bezahle sobald die Venus verkauft sey – Kochs
Töchterlein macht sich recht hübsch, hat zwar rothe Haare, gleicht aber ganz
seinem ächten Vatter! – da gibt’s Geschichten die ich nicht schreiben
darf, und nachdem sie auch niemand fragen können, da nur ich Matrazzo17
und Reinhart18 sie wissen diesen mußte ich mein Ehrenwort geben
zu schweigen nur soviel daß Koch auf alle Art betrogen wird. Doch hat er
sich des Geldes bemächtigt, und hält gut Haus. Die Victoria ist Braut mit
einem Bauer von Olevano. Ihren freundschaftlichen Vorschlag, wegen meiner
Arbeiten habe ich überlegt, und sehe ein daß es in mehrere Rücksicht
Vortheil für mich haben könnte wenn in dem M. blatt19 meiner
erwähnt wird, aber wo finde ich jemand der einen ordentlichen Contur in
Kupfer bringt? und wird man mich am Ende nicht durchhecheln, und sagen ich
hätte alles selbst einrücken lassen? meine Elisabeth20 gefällt
und ist das beste was ich zustand brachte, aber Sie haben das Bild nicht
gesehn, und könnten doch nicht ganz nach einem Contur urtheilen, s
deswegen weiß ich nicht ob es nicht besser ist alles unterwegen zu lassen. –
Die K. v. Bayern21 schreibt mir oft und äusserst
freundschaftlich, Sie wissen hier passt alles auf, so weiß man auch dies,
und mehrere die mich früher links liegen liesen, sind nun sehr artig,
besonders die Ri – hausen,22 aber ich zeigte ihnen noch nichts
von meiner Arbeit, sondern sagte ihnen bey ihrem lezten Besuch der besonders
mein Bild zum Zweck hatte, gerade heraus, ich sey gewarnt worden vor ihrem
Spott, und sie sollten mir nichts übelnehmen, wenn ich daher ihnen nichts
zeigte, – Sie können denken welche Betheuerungen da gemacht wurden, – Wagner23
richtete erzehlte ich das Schiksal Ihres Bildes, das Sie von ihm
haben, bekam aber keine bestimmte Andwort. Was neues hier vorfiel ist wenig
und Fischer wird Ihnen alles sagen. Also genug für heute – .
Leben Sie theurer Freund recht wohl, und
behalten mich in gutem Andenken
SR
Die Platte von Colonna ist Huber
sehr gelungen, und ist sehr bewundert worden, es ist in jeder Rücksicht die
beste – was macht denn Wächter?24
Day25 schikt
kein Geld – er versprach zu Ende Januar zu bezahlen aber es kam nichts. Den
9ten heute
brachte uns Day 20 Scudi für die Carettella26
er sagte er habe 29 erhalten für die remise gehöre ihm 9 Scudi – also ein
Handel der doch noch Profit trug wenigstens für Day, dem ich gleich 15 Scudi
für sein Gewinst gebe, er wollte mir ein Billet an Sie schiken sah aber noch
nichts und dieser Brief muß auf die Post.
1
Brief von Sophie Reinhard an Karl Friedrich Freiherr von Uexküll (1755-1832)
aus dessen Nachlass in der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe.
2
San Vitale in der heutigen Via Nazionale.
3
Malerin aus Bologna, nicht ermittelt.
4
Bianca Milesi (1790-1849), befreundete Malerin aus Mailand.
5
Friedrich Müller (1749-1825), Maler und Dichter, lebte seit 1778 in Rom.
6
Giuseppe Boschi, Bildhauer und Bronzegießer, bei dem Freiherr von Uexküll im
Januar 1811 für 60 Piaster ein Modell der „Reiterstatue des Mark Aurel“ in
Bronze bestellt hatte, das Sophie Reinhard am 30. Dezember 1811 in Empfang
nahm (vergl. auch Abrechnung zwischen Sophie Reinhard und Freiherr von
Uexküll im Jahre 1815).
7
45 Zechinen = 45 Golddukaten entsprechen ungefähr 190 Scudi.
8
Karl Roos (1775-1837), Kunsttischler aus Ludwigsburg, lebte seit 1804 in
Rom.
9
Joseph Anton Koch (1768-1839), Landschaftsmaler aus Obergiblen in Tirol,
lebte seit 1795 in Rom.
10 Filippo Giuntotardi
(1768-1831), italienischer Landschaftsmaler, Kupferstecher und Radierer aus
Rom.
11
Ferdinand Fischer (1784-1860), Baumeister aus Stuttgart, lebte von 1808 bis 1812
in Rom.
12
Abruzzi, nicht ermittelt.
13
Jakob Wilhelm Huber (1787-1871), befreundeter Maler und Radierer aus Zürich.
14
Abkürzung für München.
15
Heinrich Keller, genannt Schleichle
(1771-1832), Bildhauer und Schriftsteller aus Zürich, lebte seit 1794 in
Rom.
16 Venus (vergl. Brief der
Künstlerin vom Juni 1811 an
Karl Friedrich Freiherr von
Uexküll).
17
José Madrazo (1781-1859), spanischer Maler und Radierer, lebte von 1803 bis
1819 in Rom.
18
Johann Christian Reinhart (1761-1847), Maler und Radierer aus Hof, lebte
seit 1789 in Rom.
19
Vergleiche den bereits zuvor im, Morgenblatt für gebildete Leser, 5.
Jg., Tübingen 1811, S. 664, erschienenen Artikel, der wohl aus der Feder von
Uexküll stammt.
20
Wohl das Gemälde „Die heilige Elisabeth mit dem Johannesknaben“.
21
Caroline Königin von Bayern, geb. Prinzessin von Baden (1776-1841).
22
Franz Riepenhausen (1786-1831), Maler aus Göttingen, lebte seit 1805 mit
seinem Bruder Johann (1788-1860) in Rom.
23
Johann Martin Wagner (1777-1858), Maler und Bildhauer aus Würzburg, lebte
seit 1804 in Rom.
24
Eberhard von Wächter (1762-1852), Historienmaler aus Balingen. War seit 1810
Kustos der Kupferstichsammlung in Stuttgart.
25
Alexander Day (1773-1841), englischer Maler und Kunsthändler in Rom.
26
Caretta = einspännige, offene Kutsche für zwei Personen. Day zahlte dafür 20
Scudi (vergl. auch die Abrechnung zwischen Sophie Reinhard und Freiherr von
Uexküll im Jahre 1815).
|
|
15
[GLA Karlsruhe 56 Nr.
382]1 [Karlsruhe, den 31. März 1812]
Durchlauchtigster Großherzog
gnädigster Großherzog und Herr
Meine älteste Tochter Sophie hat
schon in frühen Jahren Liebe und Geschik zur Malerey gezeigt. Da diese mit
reiferen Jahren zunahmen glaubte ich meine Pflicht als Vatter fordere von
mir meiner Tochter zur Ausbildung ihrer natürlichen Fähigkeiten behülflich
zu seyn. Sie erhielt deswegen an Eurer Königlichen Hoheit Gallerie Director
Beker2 allhier mehrjährigen Unterricht, hat darauf ihre
Kenntnisse durch fünfjähriges Fortsetzen ihrer Studien in München, Wien und
Rom, an welchem letzten Ort sie sich auch gegenwärtig befindet, zu erweitern
gesucht und, wenn ich dem Zeugnis der Kunstkenner die sich hierüber geäusert
haben Glauben beymessen darf, es so weit gebracht daß sie unter diejenige
Künstler gerechnet zu werden verdient die mit Nutzen zu Verbreitung ihrer
Kenntnisse und des guten Geschmaks wirken können.
Euer königliche Hoheit haben, wie
höchst dero ehrwürdigster Regierungsvorfahre, Hilfen aus den Mitteln des
Staats einen Theil zur Belohnung und Aufmunterung verschiedener Künstler
verwendet und nebst anderen dem kürzlich verstorbenen Hofmaler Schröder3
ein Gehalt von achthundert Gulden jährlich angewiesen.
Sollte Eure Königliche Hoheit
gesonnen seyn, auch bey den jetzigen freylich für starken Aufwand auf Reisen
nicht günstigen Zeiten, dieses erledigte Gehalt wider zu vergeben, sollten
Höchst dieselbe glauben, daß meine Tochter, wenn sie es erhielte, ihrem
Vatterland nutzen könne und sollte Höchst dieselbe niemand wissen der Ihrer
höchsten Gnade würdiger als meine Tochter wäre, so wage ich es, wiewohl ohne
meiner Tochter, verwissen, um obiges Gehalt und dabey um gnädigste Fristung
der Verbindlichkeit welche meine Tochter wenn sie es erhält zu übernehmen
hat, hiermit unterthänigst zu bitten.
Ich verharre in tiefster
Ehrerbietung
Karlsruhe den 31t. Merz 1812.
Eurer
Königlichen Hoheit
unterthängster
Staatsrath Reinhard.
1
Brief des Vaters von Sophie Reinhard Maximilian Wilhelm Reinhard (1748-1812)
an Karl Ludwig Großherzog von Baden mit der Nachschrift von anderer Hand:
Seine Königl. Hoheit
wollen hierauf Ihre höchste
Entschließung nach geschehner
Festsetzung des neuen Etats
fassen; wo Ihm hiernochmals
gegenwärtiges wieder
unterthänigst vorgelegt werden
soll. Karlsruhe, d 1. April 1812.
F. A. Reinhardt
Oben rechts der Vermerk: Pr den
1. April 1812.
bey der Audienz
2
Philipp Jakob Becker (1759-1829), seit 1784 Hofmaler und Galeriedirektor in
Karlsruhe.
3
Johann Heinrich Schroeder (1757-1812), wurde am 27. April 1811 zum
Großherzoglich Badischen Hofmaler ernannt (vergl. Carl Friedrich und
seine Zeit, Ausst.-Kat. Baden-Baden 1981, S. 175).
|
|
16
[NL Uexküll, Staatliche Kunsthalle
Karlsruhe]1
Rom den 10 Mai
1812
Diesmahl habe ich zimlich lange nicht
geandwortet auf Ihre freunschaftliche Briefe, aber ich bin so beschäftigt
wie noch nie, und Sie müssen verzeihn. Daß Sie mit dem Mark A.2
zufrieden sind freut mich, ein Arbeiter von Boschi war bey mir, und sagte
Sie hätten ein Trinkgeld versprochen, ich frage daher ob, und wie viel ich
geben soll? mit Desartio3 sprach ich der will kein Geld, er
sagte Sie hätten seinen Brief unrecht verstanden. Koch4
versprach schon oft die Sachen bey J Jentotardi5 zu
besorgen, hat aber kein Gedächtniß, er hat nun gerade 100 Piaster von
Ihnen wofür ich mir eine Quittung werde geben lassen, da für die
vielen die ich von ihm in Henden habe, die Cascade6 ist für 200
P. in die Schweiz verkauft, er hat bestellungen aller Art besonders von
Nott7 der ihn hierher brachte, das meiste ist schon gepakt
zur Abbreise, ich glaube er geht seinem Glück entgegen. Kramer8
ist todt, und wurde doch in den lezten Tagen seines Leidens von seinen
Bekehrer Werner9 verlassen der mit Schlosser10 nach
Florenz ging, nachdem er sich in der heiligen Woche in ein Kloster
eingesperrt hatte, wo er sich kasteite, seinem dürren Hintern fipte und beym
Herausgehn, den begeiferten schwarzen Fuß des Petrus waker küsste! – o
Heuchler! Schleichle11 kommt mir nicht zu Gesicht höre aber
Clementine sey abermahl in gesegneten Umständen. Pforr12 ist übel
an der Abzehrung, und wird bald sterben. Eberhard13 war in Neapel
mit Catel,14 und wird bis Spetjahr seine Arbeiten selbst nach
Münch. bringen. Ich habe mein Bild fertig, und zeichne nun fleißig nach
Model Weiblich und Männlich, ich finde die Anaotmie15 bekommt mir
wohl, und ich komme weiter, sogar R Koch lobt mich, der nie mit mir
zufrieden war. Niemand fühlt besser als ich wie Vortheilhaft ein längerer
Aufenthalt für mich hier wäre, aber ich habe bereits von meinem kleinen
Vermögen 6000 fl. verzehrt, ich habe Geschwister, und einen Vatter16
der oft kränkelt, meine Mutter17 hat wenn sie Witwe wird, nichts
als die kleine Einnahmen vom Vermögen die, wenn ich viel mehr noch brauche
nicht hinreichen würde, also ist es Pflicht zurück zu gehn, ich thue es mit
blutendem Herzen, denn ich glaube noch auf einen Punkt kommen zu können, wo
ich nicht unter die Pfuscher gerechnet würde, so kehre ich zurück, und
versaure – schreiben Sie mir aber noch ein einziges mahl von Gattin und
Mutter werden, so gehe ich ohne weiteres zu Torlonia,18 mit einer
von mir geschrieben Anweisung von Ihnen, auf 600 Piaster, und bleibe
dann noch ein Stükchen hier, Sie können dann darben mit dem bischen waß
Ihnen bleibt! – Waß Sie wegen Apruzzi19 schreiben verstehe ich
nicht, denn Sie bedienen sich eines mir fremden Ausdruks –. Bey uns spuken
die Erdbeben noch immerfort doch nur schwach, waß das große aber Schaden
that ist nicht zu beschreiben auch mein ganzes Logis sieht wie eine Laterne
aus. Grüssen Sie Fischer20 von mir, aber küssen Sie tausendmahl
die liebe Fr v. Ixküll für mich, wenn sie mir schon nicht schreibt ist sie
mir doch lieb. Herr und Fr v. Ramdohr21 besuchen
mich oefters, und laden mich sehr dringend ein zu ihnen zu kommen, aber ich
habe keine Zeit, richte ihm aber von Zeit zu Zeit viele Compl. von Ihnen
aus, die von denen Sie nichts wissen, er freut sich immer sehr, und gibt
alles erdenkliche schön zurück, er scheint ein guter Mann zu seyn, und hat
sich nun ganz aufs Mahlen gelegt, waß doch besser ist als über Kunst schreiben.
Noch einer hat sich ein an meinen Triumpfwagen neben Staches22
gespannt, nehmlich Graß23 der unter uns gesagt, mich versicherte
mit mir würde er sehr glücklich seyn – aber ich sehr unglücklich mit Ihnen, war
meine Andwort, sehn Sie welche Eroberungen! Miller24 erwartet mit
Sehnsucht einen Brief von Ihnen. Sagen Sie doch Fischer die Madalena sey am
Faulfieber gestorben, nehmlich die Tochter unserer Hausfrau, Dall`ar
Dall’armi25 mache der Cecilia die cour, und Catels hätten das
Logis in der strada del tritone verlassen wegen einem Prozeß den sie mit den
Hausleuten bekamen da der aufgerafte Luigi die Kinder mit dem Erbgrind26
angestekt hat, sie zogen alsdann in Fischers leztes Logis auf der Trinita.
Vieleicht kommen Catels nach Stutgard, wo ich mir die Freiheit nehme Ihnen
diese guten Leute zu empfehlen, ich glaube Sie werden gerne von Rom das
neuste hören, waß sich besser erzehlen als schreiben lässt, und es sind
artige gute Menschen.
Kirchner27 und die Gräfin Vay28
sind vor mehreren Wochen abgereist eine große Lüke, da es das einzige Hauß
war wo ich Abends ein paar Stunde vergnügt hinbrachte, nun habe ich auch
niemand doch fand ich ein Mädchen aus Mailand die mit 21 Jahren schön reich,
und voll Verstand sich mit seltenem Eifer der Mahlerei wiedmet, durch das
Studium der Anatomie, die ich mit ihr lernte, ich sehe sie täglich, und
arbeite mit ihr, und täglich wird sie mir lieber verständiger und besser
fand ich noch keine Freundin in Deutschland es ist ein vortreffliches
Geschöpf die mir auch recht gut zu seyn scheint sie heißt Bianca Milesi,29
ist gerade so lange hier wie ich doch kenne ich sie erst 5 Monate. Leben Sie
recht wohl und versuchen Sie nach dem Schreiben Ihren großen
Weinkeller, nicht vorher wie Sie zu thun sp pflegen, und dann glauben
Deutschl. sey eine Bären Grube auch hier blieb es kalt und regnete beständig
bis Ende Aprill nun ist es schon heiß, wir sind um den Frühling betrogen
Fankerl30
[der], wenn man ihn mit
nüchtern Augen ansieht immer der schöne gute Hund ist, meint dem Keucher
Mukle geschehe ein guter Tag wenn ihn einer aus diesem Leben befördert, da
er doch nichts thut als fressen schlafen, und die Leute in die Beine beißt.
– Leben Sie theurer Freund recht wohl
S.R
1 Brief von Sophie Reinhard:
„a Monsieur
le Baron d’Ixkill, l’ainé
à
Stutgardt
Wurtemberg“
aus dessen Nachlass in der Staatlichen
Kunsthalle Karlsruhe.
2 Freiherr von Uexküll hatte im
Januar 1811 für 60 Piaster bei Giuseppe Boschi, Bildhauer und Bronzegießer,
ein Modell der „Reiterstatue des Mark Aurel“ in Bronze bestellt, welcher von
Sophie Reinhard im Frühjahr 1812 nach Stuttgart gesandt wurde.
3 Desartio, römischer Spediteur.
4 Joseph Anton Koch (1768-1839),
Landschaftsmaler aus Obergiblen in Tirol, lebte seit 1795 in Rom. Er
unterbrach seinen Romaufenthalt, um von 1812 bis 1815 in Wien zu leben.
5
Filippo Giuntotardi (1768-1831),
italienischer Landschaftsmaler, Kupferstecher und Radierer aus Rom.
6 Cascade = Schmadribachfall I
(vergl. Lutterotti WV Koch Nr. 16, das Gemälde kaufte Herr Honneker aus
Bremgarten).
7 Dr. George Nott (1767-1841),
englischer Theologe aus Oxford. Großer Gönner und Freund von Anton Koch.
8 Tjarko Meyer Cramer (1780-1812),
Maler aus Ostfriesland, lebte seit 1804 in Rom. Er trat im Oktober 1811 zum
katholischen Glauben über, mit dem neuem Taufnamen Lukas. Cramer starb am
26. April 1812.
9 Zacharias Werner (1768-1823),
Dichter aus Königsberg, lebte in Rom seit 1809. Trat 1811 zum katholischen
Glauben über und wurde 1814 in Aschaffenburg zum Priester geweiht (die
Angabe bei Friedrich Noack, Das Deutschtum in Rom, seit dem Anfang des
Mittelalters, Stuttgart 1927, Bd. 2, S. 638, er sei bis 1813 in Rom
geblieben, müsste revidiert werden).
10 Christian Schlosser (1782-1829),
Arzt und Schulmann aus Frankfurt a. M. lebte in Rom vom Herbst 1808 bis zum
19.04.1812. Trat in Rom zum katholischen Glauben über (Friedrich Noack,
Das Deutschtum in Rom, seit dem Anfang des Mittelalters, Stuttgart 1927,
Bd. 2, S. 524)
11 Heinrich Keller, genannt
Schleichle (1771-1832), Bildhauer und Schriftsteller aus Zürich, lebte seit
1794 in Rom. Er war seit 1798 mit Clementina Tosetti verheiratet (Friedrich
Noack, Das Deutschtum in Rom, seit dem Anfang des Mittelalters,
Stuttgart 1927, Bd. 2, S. 307).
12 Franz Pforr (1788-1812), Maler
aus Frankfurt a. M., starb am 16. Juni 1812 in Albano.
13 Wohl Konrad Eberhard (1768-1859),
Bildhauer aus Hindelang, lebte mit seinem Bruder in Rom von 1806 bis 1819
und von 1821 bis 1826.
14 Franz Catel (1778-1856), Maler
aus Berlin, lebte seit Ende 1811 mit seinem Bruder Ludwig (1776-1819) in
Rom.
15 Soll wohl Anatomie lauten.
16 Maximilian Wilhelm
Reinhard (1748-1812), Vater der Künstlerin.
17 Jacobina Reinhard (1752-1826),
Mutter der Künstlerin.
18
Giovanni Raimondo Torlonia (1754-1829), italienischer Bankier.
19 Apruzzi, nicht ermittelt.
20 Ferdinand Fischer (1784-1860),
Baumeister aus Stuttgart, lebte von 1808 bis 1812 in Rom.
21 Friedrich Wilhelm von Ramdohr (um
1757-1822), Kunstschriftsteller und preußischer Gesandter.
22
Staches, nicht ermittelt.
23 Carl Gotthard Graß (1767-1814),
Maler und Dichter aus Serben in Livland, lebte seit 1805 in Rom (vergl.
Gerhard Bott und Heinz Spielmann, Künstlerleben in Rom, Bertel
Thorvaldsen (1770-1844), Ausst.-Kat. des Germanischen Nationalmuseums
Nürnberg, Nürnberg 1992, S. 724).
24 Johann Martin Miller (1750-1814),
deutscher Dichter und Prediger.
25
Wohl
Andreas Dall’Armi (1788-1846),
Landschaftsmaler und Lithograph aus München. Laut R. Armin Winkler, Die
Frühzeit der deutschen Lithographie, S. 53, betrieb Dall’Armi
zusammen mit Raphael Wintter seit 1805 die erste lithographische Druckerei
in Rom.
26 Erbgrind ist eine
Kinderkrankheit, bei der Geschwüre im Bereich des Kopfhaars entstehen.
27 Kirchner, nicht ermittelt.
28
Esther Gräfin von Vay (1774-1845). Chr. G. Körner schreibt am 24. September
1812 aus Dresden an Goethe „Überbringerin dieses Briefs ist Frau Gräfin von
Vay, geborne Gräfin von Wartensleben, eine sehr angenehme Frau, die ich in
Wien bey Herrn von Humboldt kennen gelernt habe. Nach dem Tode ihres
Gemahls, eines Ungarn, hat sie mehrere Jahre in Italien zugebracht, und sehr
für die Kunst gelebt. Sie werden über vieles mit ihr sprechen können. Jetzt
macht sie eine Reise nach Holland zu einer
Tante“
(GoetheJb, Bd. 8, 1887, S. 60).
29 Bianca Milesi (1790-1849),
befreundete Malerin aus Mailand.
30 Fankerl, Name des Hundes von
Sophie Reinhard.
|
|
17
[GLA Karlsruhe 56 Nr.
382]1 [Karlsruhe, den 27. Juni 1812]
Durchlauchtigster Großherzog;
Euere Königliche Hoheit haben die
unterthänigste Bitte meines seeligen Vaters,2
seiner in Rom befindlichen
Tochter die durch den Todt des Hofmalers Schröder3 erledigte
Besoldung gnädigst zu bewilligen,
so huldreich aufgenommen, daß er
darinn noch in seinen lezten Stunden Trost und Beruhigung fand.
Durch seinen Todt ist nun bey
meiner Schwester, deren Studien schon sehr bedeutende Kosten veranlaßt
haben, das wirkliche Bedürfniß einer Unterstützung eingetreten, wenn
sie anders die mit einigem Erfolg betretene Laufbahn nicht verlaßen soll.
Ich finde mich dafür gedungen,
und ich wage es in Vertrauen auf die meinem seeligen Vater zu erkennen
gegebene gnädigste Intention,
Euere Königliche um gnädigste
Gewährung des obgedachten von meinem seeligen Vater bereits unterthänigst
angebrachten Gesuchs nochmals devotest zu bitten.
Euerer Königlichen Hoheit
Karlsruhe
am 27. Juni 1812.
unterthänigster
W Reinhard.
1
Brief des Bruders von Sophie Reinhard Regierungsrat Wilhelm Reinhard
(1776-1858) an Karl Ludwig Großherzog von Baden mit der Nachschrift von
anderer Hand:
Eingereicht in der Audienz, 1812
d. 27. Juni
nach Festsetzung des neuen Etats
wieder vorzulegen.
Oben rechts der Vermerk P. den 27
Juny 1812. bey
der Audienz
2
Maximilian Wilhelm Reinhard (1748-1812), Vater der Künstlerin. Laut
Eintrag im Standesbuch der reformierten Gemeinde von Karlsruhe starb am 16.
Mai 1812 der großherzoglich badische Geheime Rat und Direktor der
Brandversicherungsanstalten im Alter von 63 Jahren 4 Monaten und 21 Tagen.
3
Johann Heinrich Schroeder (1757-1812), wurde am 27. April 1811 zum
großherzoglich badischen Hofmaler ernannt (vergl. Carl Friedrich und
seine Zeit, Ausst.-Kat. Baden-Baden 1981, S. 175).
|
|
18
[NL Uexküll,
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe]1 [Rom, November 1812]2
Beiliegenden Brief gab mir Madam
Döhler3
in Neapel vor 2 Monat, mit der Bitte ihn an Sie einzuschließen, verrathen Sie
mich nicht daß ich ihn so lange nicht abschikte, es geht Döhlers recht gut,
und beide empfehlen sich Ihnen und der F v. Ixküll,4
auch Hofmanns5
gehts gut, ich war aber nicht bey diesen, da meine Stimmung gar nicht
geeignet war um Gesellschaft zu sehen. Harkhofer6
empfiehlt sich auch, ich machte ihm Hoffnung Sie würden wieder nach Neapel
kommen; er bittet die Frau von Ixküll ihm eine gute schöne junge reiche
Hausfrau zu suchen, und mitzubringen; er will keine Italienerin; Herr v.
Huth7
wohnt noch in Fischers8
leztem Quartier, seine Frau ist in der Hoffnung, von wem? weiß man
nicht.
Ich grüße Keller,9
und Fischer, und küsse die liebe F. v Ixküll herzlich – andworten Sie mir
bald, und geben Sie mir ferner Ihre Aufträge, die wenn ich in der lezten
Zeit auch nicht ganz glüklich war, ferner besser sollen besorgt werden,
leben Sie recht wohl und bleiben mein Freund.
Sophie Reinhard
1
Brief von Sophie Reinhard an Karl Friedrich Freiherr von Uexküll (1755-1832)
aus dessen Nachlass in der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe.
2
Die Datierung kann aufgrund des Inhaltes der Mitteilungen erfolgen. Sophie
Reinhard unternahm 1812 zusammen mit Bianca Milesi eine Reise nach Neapel. Über den Verlauf der Reise
gibt ihr Brief vom 22. November 1812 an Karl Friedrich Freiherr von Uexküll
Auskunft. Von dieser Reise kehrte die Künstlerin Ende September nach Rom
zurück.
3
Frau Döhler verheiratet mit
Heinrich Döhler, Mutter des
Komponisten und Pianisten Theodor Döhler (1814-1856). Heinrich Döhler (gest. 1843) war bis
1827 Kapellmeister in Neapel.
4
Elisabeth Freifrau von Uexküll geb. Hardegg (1771-1814), Gemahlin des Karl
Friedrich von Uexküll.
5 Georg
Franz Hofmann (1765-1838), Pädagoge aus Burrweiler (Pfalz), gründete 1810 in Neapel eine
Privatschule nach der Methode von Johann Heinrich Pestalozzi
(vergl. Rebekka Horlacher und Daniel Tröhler (Hrsg.), Sämtliche Briefe an
Johann Heinrich Pestalozzi
: Kritische Ausgabe,
Band 2, 1805-1809, Zürich 2010, S. 141 und Rebekka Horlacher und Daniel Tröhler (Hrsg.), Sämtliche Briefe an
Johann Heinrich Pestalozzi
: Kritische Ausgabe,
Band 3, 1810-1813, Zürich 2011, S. 433 ff.). Georg Hofmann war verheiratet mit Charlotte
Hofmann (vergl. Rebekka Horlacher und Daniel Tröhler (Hrsg.), Sämtliche Briefe an
Johann Heinrich Pestalozzi
: Kritische Ausgabe,
Band 5, 1817-1820, Zürich 2013, S. 135).
6
Georg
Hackhofer, Gastwirt in Neapel in der Via Toledo bei dem die Uexkülls ein
Zimmer gemietet hatten (vergl. Horst Vey, Die Sammlung des Freiherrn von
Üxküll (1755-1832) und ihre späteren Geschicke, in: Jahrbuch der
Staatlichen Kunstsammlungen in Baden-Württemberg, Bd. 42, 2005, S. 94).
7
Carl Wilhelm von Huth (1778-1818), dänischer Hauptmann.
8
Ferdinand Fischer (1784-1860), Baumeister aus Stuttgart, lebte von 1808 bis 1812
in Rom.
9
Dr. Carl Urban Keller (1772-1844), Advokat und dilettierender Zeichner aus
Marbach bei Stuttgart.
|
|
19
[NL Uexküll,
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe]1
Rom d. 22. 9ber
1812
Ich mache Ihnen, theuerster
Freund keine Endschuldigungen mein langes Stillschweigen betreffend, denn
leider bin ich gewiß in Ihren Augen nur zu gut entschuldigt da Sie wissen
welchen Verlust ich erlitten habe, ach ich verlohr das liebste das beste waß
ich auf dieser Welt hatte,2
aus Verzweiflung entschloß ich mich mit meiner Freundin Milesi3
nach Neapel und Ischia (wo sie die Bäder braucht) zu reisen, in Neapel wurde
ich in den ersten Tagen ernstlich krank, litt viel, und ging noch krank nach
Ischia, wo ich 2 Monate mit meinem Schmerz ohne allen Genuß lebte, keine
Briefe konnte ich erhalten bis ich endlich nach Neapel ging mich dort an die
Gesandschaft wandte, und mit Mühe von sechs Briefen die dort für mich anlangt
waren 3 erhielt, unter diesen 3 Briefen war einer meines Bruders4
der mir erklärte ich solle bis künftiges Frühjahr in Rom bleiben, da mein
guter Vatter vor seinem Todte mich seegnend den Wunsch geäußert habe, er
wolle nicht daß sein Todt meine Abreise beschleunige, ich kehrte also nach 3
Monat Abwesenheit nach Rom, wo ich mein Quartier durch Zoll5
besezt fand, zog daher zur Schwiege von Koch,6
die nach wenige Tagen die paravecosa bekam, sich zum Erstaunen aller, wieder
erholte, doch bald wieder am nehmlichen Übel zum zweitenmal darnieder lag,
sich zwar auch wieder zimlich erholte, inzwischen hatte ich satt, an
zweimonatlicher Hunde Zeit die ich so verlebte, ohne Bedienung, in
beständigem Ekel, ich zog daher ehegestern von quatro fontane nach S.
Vitale, neben cavallier de Rossi,7 in das nehmliche Haus meiner Freundin
Milesi, wo ich zwar zimlich entfernt von allen Deutschen, aber bey meiner
lieben edlen Freundin lebe, die sich mit 22 Jahren, mit seltenem Eifer der
Kunst wiedmet, bey der ich Kost und Bedienung habe, allein für zimlich wenig
Geld – in Neapel, gefiel mir’s nicht, – und hier haben Sie en gros meine
qualvolle lezte 6 Monat! – Heugelin8
sah ich zweimal in seiner Villa, ein Glück daß der gute Mann nichts an der
Aussicht ändern kann, sonst wäre das einzige was seine kleinliche
Spielereien erträglich macht, gewiß auch verpfuscht, ich konnte an dem Manne
kein Behagen finden, er ist voll süsser Worte, hinter denen nichts stekt! –
Meier9
der sich meiner liebreich annahm als ich krank war, und mir sehr gefiel,
starb in den ersten Tagen des 7bers, Strehlin10
war täglich bey uns in Ischia und ist ein gar lieber junger Mann der
allgemeine Achtung verdient, und auch hatt. – Huber11
ist noch hier, war auch in Neapel wo er unendlich viel schöne Sachen
zeichnete die hier Beifall finden, er aquarellierd nun, unter andern die
veduta della Trinità, ist fertig und ausnehmend gut gelungen, ich glaube Sie
würden sie kaufen wenn Sie es sähen, – Poschi12
meldete sich nicht mehr wegen der maigia, ich gab daher jene 2 scudi welche
Sie hiezu bestimmt hatten dem armen Wintergerst,13
ohne Sie zu nennen dieser liegt elend am Fieber, und hat kein Geld, es ist
zu befürchten er habe das Übel seines Freundes Pforr,14
dem er bis an Todt abwartete, geerbt! ich weiß Sie haben nichts gegen dieses
meine
etwaß eigenmechtiges Verfahren mit Ihrem Geld, noch 22 scudi habe ich in
Verwahrung von Ihnen, von x Koch habe ich Quittungen, dieser ist nicht ganz
zufrieden in Wien wiewohl er Bestellungen hat, und Gott danken sollte daß er
von hier weg ist, seit seiner Abreise haben sich schändliche Dinge seine
Frau betreffend verbreitet, die 3 lezten Liebhaber, welche sie hegte, und
beschenkte, erzehlen nun alles, bis ins ekelhafte, – armer Koch! – ich
glaube auch die Frau wird wohl die größte Schuld haben, daß sich Koch nicht
in Wien gefällt, denn dieße schimpft ganz toll über die Wiener, wo ihr
wahrscheinlich noch kein Liebhaber zu Füssen, – oder im Bette liegt –.
Rohden15
ist wieder hier fand aber Rom ins Schlimme verändert, Ramdohr16
lebt mahlend mit seiner Frau (die auch mahlt) aber still und spricht vom
abreisen, er wollte hier als Kunstkenner eine Rolle spielen, und verfehlte
seinen Wunsch, denn er wird nur verlacht, sagt man, ich weiß nicht ob das
erste wahr ist, das zweite ist nur zu wahr, – Wagner17
sah ich in Neapel, er ist wie man sagt vom E  Prinzen v. B.18
nach Griechenland geschikt worden und will bis Frühjahr wieder in Rom seyn.
– Day19
hatte auch die perniciosa, und hat groß + mit seinem Sohn, der ihn oft
schlägt, Huber und Rebell20
wohnen dort. De Young21
ist todt, Wiedeman22
in München, wo er Unterricht in Sprachen gibt, Reinhardt23
mein mier guter Freund ist seit beinahe 2 Monat in Caricia, Matrazzo24
hat seine 2 grosse Bilder an den ehemaligen König von Spanien25
verkauft, mahlt diesen nebst der Frau, und Friedensfürsten, und ist in einer
guten Lage, Miller26
besucht mich zuweilen, und ist sehr bös daß Sie ihm nicht schrieben,
Schleichle27
sucht immer noch Sie und Huber in schlechtes Licht zu setzen, bey Leuten die
der Geschichte unkundig sind, Eberhard28
bleibt bis Spetjahr noch hier – nun eine Bitte, durch meinen Vorschlag
bestellte die Königin von Baiern29
ein Bild bey Overbek,30
welches Sie auf beyliegendem Blatt beschrieben finden, den Preiß sagte ich
zwar höher als Overbek verlangte, und wurde von der K. genehmigt, inzwischen
ist das Bild so ausnehmend schön daß 40 statt 20 Louisd`ors noch ein sehr
mäßige Summe wäre, ich werde den Vorschlag zwar der Königin machen, aber um
leichter zu meinem Zweck zu gelangen wünschte ich Sie hätten die Güte
beiliegendes ins Morgenblatt und wo möglich auch in ein ähnliches Blatt,
welches glaube ich in München heraus kommt, einrüken zu lassen, Sie
erleichtern mir mein Geschäft, nutzen einem Vortrefflichen Künstler sehr
viel, ich habe auch noch eine andere Absicht die ich vieleicht damit
erreiche, und welche Overbek ausnehmend ehrenvoll und lieb seyn würde, nur
Gelegenheit fehlt, er ist gewiß nach
Prinzen v. B.18
nach Griechenland geschikt worden und will bis Frühjahr wieder in Rom seyn.
– Day19
hatte auch die perniciosa, und hat groß + mit seinem Sohn, der ihn oft
schlägt, Huber und Rebell20
wohnen dort. De Young21
ist todt, Wiedeman22
in München, wo er Unterricht in Sprachen gibt, Reinhardt23
mein mier guter Freund ist seit beinahe 2 Monat in Caricia, Matrazzo24
hat seine 2 grosse Bilder an den ehemaligen König von Spanien25
verkauft, mahlt diesen nebst der Frau, und Friedensfürsten, und ist in einer
guten Lage, Miller26
besucht mich zuweilen, und ist sehr bös daß Sie ihm nicht schrieben,
Schleichle27
sucht immer noch Sie und Huber in schlechtes Licht zu setzen, bey Leuten die
der Geschichte unkundig sind, Eberhard28
bleibt bis Spetjahr noch hier – nun eine Bitte, durch meinen Vorschlag
bestellte die Königin von Baiern29
ein Bild bey Overbek,30
welches Sie auf beyliegendem Blatt beschrieben finden, den Preiß sagte ich
zwar höher als Overbek verlangte, und wurde von der K. genehmigt, inzwischen
ist das Bild so ausnehmend schön daß 40 statt 20 Louisd`ors noch ein sehr
mäßige Summe wäre, ich werde den Vorschlag zwar der Königin machen, aber um
leichter zu meinem Zweck zu gelangen wünschte ich Sie hätten die Güte
beiliegendes ins Morgenblatt und wo möglich auch in ein ähnliches Blatt,
welches glaube ich in München heraus kommt, einrüken zu lassen, Sie
erleichtern mir mein Geschäft, nutzen einem Vortrefflichen Künstler sehr
viel, ich habe auch noch eine andere Absicht die ich vieleicht damit
erreiche, und welche Overbek ausnehmend ehrenvoll und lieb seyn würde, nur
Gelegenheit fehlt, er ist gewiß nach
Rasp. Raphaele der größte Mahler und kann der Stolz Deutschlands werden,
Catel31 sagte nur dieses auch, das Sie aber nach gutfinden ändern
können, doch können Sie nie zu viel gutes von seinem Bilde sagen, und dürfen
die Re Königin nicht nennen, ich hoffe Sie schlagen mir diese
Bitte nicht ab, und beschleunigen die Sache so viel möglich.32 –
Ob ich nächstes Frühjahr abreise ist ungewiß, im engsten Vertrauen gesagt,
ich habe Hoffnung von Baden eine Pension zu bekommen, meine Elisabetha33
schikte ich daher vor einem Monat nach CR.34 Wenn Sie gelegenheit
haben, in CR irgend etwaß zu meinem besten zu würken so bin ich dankbahr,
wie es in mit meiner Sache in München steht weiß ich nicht, man
scheint dort nicht mehr den sonst so warmen Wunsch zu haben mich kommen zu
lassen, wiewohl die Briefe der K.gin häufig; und überaus freundschaftlich,
und für mich ehrenvoll sind, so schweigt Sie doch von dieser Sache, auch
wäre mir eine Pension, weit lieber, da ich dann doch ft frei bin, und
thun kann waß ich will – doch wie Gott will.
1
Brief von Sophie Reinhard an Karl Friedrich Freiherr von Uexküll (1755-1832)
aus dessen Nachlass in der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe.
2
Maximilian Wilhelm Reinhard (1748-1812), der Vater der Künstlerin
starb am 16. Mai 1812.
3
Die Reise mit Bianca Milesi (1790-1849), einer befreundeten Malerin aus
Mailand, trat sie am 21. Juni 1812 an.
4
Wilhelm Reinhard (1776-1858), Bruder der Künstlerin.
5
Franz Joseph Zoll (1770-1833), Maler aus Möhringen/Baden, lebte von 1811 bis 1813
in Rom.
6
Joseph Anton Koch (1768-1839), Landschaftsmaler aus Obergiblen in Tirol,
lebte seit 1795 in Rom. Er heiratete laut Friedrich Noack, Das Deutschtum
in Rom, seit dem Anfang des Mittelalters, Stuttgart 1927, Bd. 2, S. 322 am
1. September 1806 Cassandra Ranaldi. Er unterbrach seinen Romaufenthalt, um
von 1812 bis 1815 in Wien zu leben.
7
Giovanni Gherando de Rossi (1754-1827), italienischer Dichter (vergl.
Émile Souvestre,
Blanche Milesi-Mojon.
Notice biographique,
Angers 1854, Seite 30).
8
Christian Heigelin (1744-1820) aus Stuttgart, dänischer Generalkonsul in
Neapel.
9
Dr. Mayer (1777-1812), deutscher Arzt am Militärlazarett in Neapel (vergl. Carl August
Böttiger, Tagebuch einer Reise durch
einen Theil Deutschlands und durch Italien in den Jahren 1804 bis 1806 von
Elisa von der Recke,
Berlin 1815, 3. Bd. S. 37f.).
10
Dr. Straehlin, Reisebegleiter von Karl Friedrich Freiherr von Uexküll aus
Stuttgart (vergl. Horst Vey, Die Sammlung des Freiherrn von Üxküll
(1755-1832) und ihre späteren Geschicke, in: Jahrbuch der Staatlichen
Kunstsammlungen in Baden-Württemberg, Bd. 42, 2005, S. 87).
11
Jakob Wilhelm Huber (1787-1871), befreundeter Maler und Radierer aus Zürich.
12
Giuseppe Boschi, Bildhauer und Bronzegießer (vergl. Abrechnung zwischen
Sophie Reinhard und Freiherr von Uexküll vom 5. Februar 1812 und vom Jahre 1815)
13
Joseph Wintergerst (1783-1867), Maler aus Wallerstein, lebte von 1811 bis
Anfang 1813 in Rom.
14
Franz Pforr (1788-1812), Maler aus Frankfurt a. M., starb am 16. Juni 1812
in Albano.
15
Johann Martin von Rohden (1778-1868), Landschaftsmaler aus Kassel, lebte
seit 1795 in Rom.
16
Friedrich Wilhelm von Ramdohr (um 1757-1822), Kunstschriftsteller und
preußischer Gesandter.
17
Johann Martin Wagner (1777-1858), Maler und Bildhauer aus Würzburg, lebte
seit 1804 in Rom.
18
Ludwig Kronprinz von Bayern (1786-1868).
19
Alexander Day (1773-1841), englischer Maler und Kunsthändler in Rom.
20
Joseph Rebell (1787-1828), Landschaftsmaler und Radierer aus Wien.
21
De Young (? De Jonghe), nicht ermittelt.
22
Wiedemann, nicht ermittelt.
23
Johann Christian Reinhart (1761-1847), Maler und Radierer aus Hof, lebte
seit 1789 in Rom.
24
José Madrazo (1781-1859), spanischer Maler und Radierer, lebte von 1803 bis
1819 in Rom. 1811 bis 1815 Kammermaler des in Rom lebenden Exkönigs Karl IV.
von Spanien.
25
Karl IV. König von Spanien (1748-1819).
26
Johann Martin Miller (1750-1814), deutscher Dichter und Prediger.
27
Heinrich Keller, genannt Schleichle (1771-1832), Bildhauer und
Schriftsteller aus Zürich, lebte seit 1794 in Rom.
28
Konrad Eberhard (1768-1859) und Franz Eberhard (1767-1836), beide Bildhauer
aus Hindelang, lebten in Rom von 1806 bis 1819 und von 1821 bis 1826.
29
Caroline Königin von Bayern, geb. Prinzessin von Baden (1776-1841).
30
Johann Friedrich Overbeck (1789-1869), malte 1812/13 für die Königin von
Bayern das Gemälde „Die Anbetung der heiligen drei Könige“, das sich heute
im Besitz der Hamburger Kunsthalle befindet.
31
Franz Catel (1778-1856), Maler aus Berlin, lebte seit 1811 in Rom.
32 Im Morgenblatt vom 14.
Januar 1813 erschien dann auch unter der Rubrik Korrespondenz-Nachrichten
folgender Text: „Es wird Sie, mein werther Freund, gewiß freuen, daß ich
Sie mit dem Talent eines jungen Künstlers bekannt mache, dessen Name in
Deutschland noch wenig gekannt ist, von welchem aber, wenn er so
fortschreitet, zu erwarten steht, daß er dereinst der deutschen Kunst
unendliche Ehre und sich unsterblichen Ruhm erwerben wird; der junge
Overbeck aus Lübeck kam vor ungefähr zwey
Jahren nach Rom … Seine Eltern können ihren Sohn nur wenig unterstützen; es
stand also sehr zu befürchten, daß die geringen Vermögens-Umstände des
braven Overbeck seinem Fortschreiten in der
Kunst große Hindernisse in den Weg legen, und seinen so wünschenswerthen
Aufenthalt in Italien abkürzen würden. Wie erfreulich muß daher den Freunden
der Kunst die Nachricht seyn, daß eine deutsche Fürstinn, welche immer eine
großmüthige Beschützerinn der Kunst und alles Schönen und Guten war, sich
des jungen Overbeck angenommen, indem sie ihm
ein Bild für ihr Kabinet bestellt hat. Overbeck hat zum Gegenstand die
Anbetung der heiligen drey Könige gewählt; das
Bild ist seiner Vollendung nahe, und man kann sagen, daß es die hohe
Erwartung, wozu man durch Overbeck frühere
Arbeiten berechtigt war, noch übertrifft. Die edle Fürstinn, indem Sie,
durch die Unterstützung eines so hoffnungsvollen Künstlers sich ein Recht
auf die Dankbarkeit der Freunde der Kunst erwirbt, macht durch dieses Bild
zugleich auch eine unschätzbare Acquisition“ usw. (S.48). Die
Stadtbibliothek Lübeck besaß aus dem Nachlass Overbecks einen an ihn gerichteten Brief von Sophie Reinhard
aus dem Jahre 1813, der im Zusammenhang mit
der Fertigstellung des Gemäldes für die Königin Caroline gestanden haben
könnte (Paul Hagen, Friedrich Overbecks Handschriftlicher Nachlaß in der
Lübeckischen Stadtbibliothek, Veröffentlichungen der Stadtbibliothek der
freien und Hansestadt Lübeck, 2. Stück, Lübeck 1926, S. 9). Leider ist
dieser Brief nach dem 2. Weltkrieg in die Soviet Union verbracht worden und
bei der Rückführung von Teilen der Bibliothek im Jahre 1990 nicht mehr im Bestand aufgetaucht (Robert
Schweitzer, Die alten und wertvollen Bestände der Stadtbibliothek,
Der Wagen. Ein Lübeckisches Jahrbuch, 1992, S. 276).
33
Wohl „Die heilige Elisabeth mit dem Johannesknaben“.
34
Abkürzung für Carlsruhe.
|
|
20
[GLA Karlsruhe 56 Nr.
382]1 d. 12. Jänner 1813.
Euer Hochwohlgeboren
haben ich zu benachrichtigen die
Ehre, daß die Rahme zu dem Gemählde meiner Schwester2
trotz alles Treibens erst morgen oder übermorgen fertig wird, und daß Herr
Oberbaudirector Weinbrenner3 wegen der Zeit, da daßelbe in das
Schloß zu verbringen wäre, unterthänig nächsten Mittwoch bey denenelben
anfragen laßen wird.
Bey dieser Gelegenheit wollte
ich, wenn es zur Einreichung des Zwecks beitragen sollte, nicht unbemerkt
laßen, daß meine Schwester, in Übereinstimmung mit der von meinem seel:
Vater seiner Zeit übergebenen Vorstellung, sich die Bedingung, Unterricht im
Zeichnen zu geben, oder von Zeit zu Zeit eine Arbeit einzuliefern, gerne
gefallen laßen würde.
Erlauben Sie, daß ich, nebst
meinem wärmsten Dank, die Gesinnungen der aufrichtigsten Verehrung
ausdrücke, womit ich zu sagen die Ehre habe
Euer Hochwohlgeboren
ganz gehorsamster
W Reinhard.
1
Brief des Bruders von Sophie Reinhard Regierungsrat Wilhelm Reinhard
(1776-1858) an das Großherzogliche Geheime Kabinett
2
Bei diesem Gemälde handelt es sich wohl um die „Die heilige Elisabeth mit
dem Johannesknaben“, welche die Künstlerin in ihrem Schreiben vom 22.
November 1812 an Karl Friedrich Freiherr von Uexküll erwähnt und mitteilt „ich
habe Hoffnung von Baden eine Pension zu bekommen, meine Elisabetha schikte
ich daher vor einem Monat nach CR.“
3
Friedrich Weinbrenner (1766-1826), Architekt, Geheimer Rat und
großherzoglicher Oberbaudirektor in Karlsruhe.
|
|
21
[GLA Karlsruhe 56 Nr.
382]1
Großherzogl. Geheimes Kabinet.
Karlsruhe, den 15. Jänner
1813.
Seine Königliche Hoheit
haben der gegenwärtig in Rom sich
aufhaltenden Mahlerin Dlle. Sophie Reinhard, von hier, auf solange, als sie
sich mit ihrer Kunst ihrem Vaterlande widmen wird, den vorhin von dem
verstorbenen Hofmahler Schröder2 bezogenen Gehalt von jährlichen
Achthundert Gulden, an Geld,
vom 23. dieses Monaths anfangend,
mit der Verbindlichkeit zu verwilligen geruhet, daß sie von Zeit zu Zeit
eine Arbeit einzuliefern oder auch, auf deßfalls anderweit erhaltende
Weisung, Unterricht im Zeichnen zu ertheilen gehalten seyn solle.
Nach höchstem Befehl wird das Gr.
Finanz Ministerium zur weiters erforderlichen Verfügung hiervon in Kenntniß
gesetzt.
1
Abschrift der Antwort des Großherzoglichen Geheimen Kabinetts auf den Brief
des Bruders von Sophie Reinhard Regierungsrat Wilhelm Reinhard vom 12.
Januar 1813. Wilhelm Reinhard, geb. am 1. September 1776 wie seine Schwester
in Kirchberg, war seit 1806 Regierungsrat (vergl. Karl von Wechmar,
Handbuch für Baden und seine Diener, Heidelberg 1846, S. 119).
2
Johann Heinrich Schroeder (1757-1812), wurde am 27. April 1811 zum
großherzoglich badischen Hofmaler ernannt (vergl. Carl Friedrich und
seine Zeit, Ausst.-Kat. Baden-Baden 1981, S. 175).
|
|
22
[GLA Karlsruhe 56 Nr.
382]1 [Karlsruhe, den 19. Januar 1813]
Durchlauchtigster Großherzog;
Euer königliche Hoheit haben
unterm 15ten d. die Höchste Gnade gehabt, meiner zu Rom
befindlichen Schwester die durch den Todt des Hofmalers Schröder2
vacant gewordene Besoldung zu verwilligen.
Indem ich für dieße huldvolle
Entschließung meinen unterthänigsten Dank darbringe, glaube ich im Nahmen
meiner Schwester versichern und geloben zu dürfen, daß sie mit allem ihren −
durch Euere Königl. Hoheit neubelebten Kräften sich bestreben wird, einen
solchen Grad an Ausbildung zu erreichen, daß sie den höchsten Absichten
immer mehr und mehr entsprechen, und seiner Zeit auch das Ihrige zu
Erweckung vaterländischer Kunst beytragen möge.
Karlsruhe 19ten Jenner
1813. Euerer Königlichen Hoheit
unterthänigster
W Reinhard.
1
Brief des Bruders von Sophie Reinhard Geheimer Regierungsrat Wilhelm
Reinhard (1776-1858) an Karl Ludwig Großherzog von Baden.
2
Johann Heinrich Schroeder (1757-1812), wurde am 27. April 1811 zum
Großherzoglich Badischen Hofmaler ernannt (vergl. Carl Friedrich und
seine Zeit, Ausst.-Kat. Baden-Baden 1981, S. 175).
|
|
23
[NL Uexküll,
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe]1 Rom d. 21. März 1813
Theuerster Freund,
Daß Sie das Unglück hatten, und
sich dabey übel zu beschädigen, erfuhr ich durch einen Brief den Huber2
von Fischer3 erhielte, diesmal bedauere ich Sie recht von ganzem
Herzen! Weit mehr als Jemahls als Ihnen der Meierhof abbrannte, inzwischen
hoffe ich haben Sie nun das äergste überstanden, und werden bald wieder
hergestellt seyn. Beiliegendes Blatt brachte mir Müller,4 der wie
er selbst gesteht in der Hitze einen Brief an Sie schrieb den er nicht hätte
schreiben sollen, die ganze Sache kommt daher daß ihm Batt5
(der eine Gomara seyn muß,) einen Brief von Ihnen mittheilte worin Sie von
vergangenen Zeiten und dergleichen sprachen, wir wissen alle daß Müller
nebst großem Talent, die Schwachheit hat daß er nie alt seyn will,
inzwischen ist’s ja doch immer besser Friede zu machen und zu erhalten, wenn
man auch das Recht hätte Krieg zu führen, ich glaube daher Sie werden die
Sache großmüthig verzeihn und vergessen; Müller ist selbst aufgebracht über
Batt, der ihn durch die Übersendung Ihres Briefes zu einem dummen
Streich Gelegenheit gab; – ich sehe Müller öefters und finde ihn würklich
nicht so übel von Caracter als man ihn schildert, im Gegentheil, er ist will
man seiner Eitelkeit schmeicheln sanft wie ein Lamm, und sehr leicht zu
mißbrauchen. – Daß ich eine Pension von unserm Großherzog erhielt werden Sie
gehört haben, ich schätze mich sehr glücklich, und hoffe noch in Italien
bleiben zu können, auch darf ich Ihnen sagen ohne dabey zu fürchten der
Eitelkeit oder so etwaß beschuldigt zu werden, daß ich in Jahr und Tag
Fortschritte gemacht habe, die mich hoffen lassen dieser Pension nicht ganz
unwürdig zu seyn; die Königin v. B.6 hatt mir geschrieben sie
erwarte mich diesen Frühling in München, freue sich auf den Zeitpunkt und
hoffe sie werde alles zu meiner Zufriedenheit ordern können, ich solle
nicht glauben daß sie je diesen Wunsch aufgegeben habe. Neues kann ich
Ihnen wenig schreiben, Matrazzo7 verlohr sein einziges Kind an
den Roeteln, Koch8 schreibt nicht, Rohden9 sah ich
wenig, die Rippenhausen10 sind nach Neapel auf einige Wochen,
Surland11 ist auch in Neapel, Strehlin12 soll nächstens
hier her kommen. Maier13 in Neapel ist todt, ich wohne dort bey St.
Vitale wie Sie ganz recht vermutheten; sagen Sie Fischer nebst meinem Compl.
daß Vetter14 meine Stütze im Ungewitter die Auszehrung hatt. –
Nun eine Bitte die wäre mir doch womöglich auf besseres Papier zu schreiben,
Ihre Briefe sind so schwer zu lesen weil die Worte zusammengeflossen sind.
Der heurige Carnevale war ausnehmend schön, und zahlreich. Daß sich Graß15
heiratete werden Sie wissen? eine Witwe mit der er schon 3 Jahre das
Mittagessen theilte, sie scheint eine recht brave Frau von 35 Jahren zu
seyn. Graß sagte mir als er mir seine Heirath ankündigte, ich heirathe keine
Frau, sondern eine Freundin, werde auch wie bisher allein schlafen; nun höre
ich aber daß er Hoffnung zu einem Erben habe, Glück zu! Frau und Kinder,
scheinen mir bey jetzigen Zeiten das aller überflüssigste für einen
Künstler. – Ich erwarte mit Ungedult Nachricht von Ihnen, und hoffe wenn Sie
auch nicht selbst schreiben können, so werden Sie mir durch einen 3ten
etwaß schreiben lassen Ihre Gesundheit betreffend, die arme F. v. I.16
wird recht erschroken seyn! Sie aber auch gut verpflegen, – ich möchte
wünschte heute mehr als je Stoff zu einen unterhaltenden Brief für Sie zu
haben, aber che serve non so niente; als daß ich noch heute auf den Monte
Mario17 gehe wo ich Ihrer der guten Freundin, und auch der guten
Pfankuchen gedenken werde, könnten Sie doch bey uns seyn! kommen Sie denn
nicht bald? ich möchte gerne mit Ihnen zurück reissen hoffentlich sind Sie
etwaß besser geworden und als Reisegesellschaffter etwaß annehmbarer? Leben
Sie wohl und bleiben mein Freund
S. Reinhard
1
Brief von Sophie Reinhard an Karl Friedrich Freiherr von Uexküll (1755-1832)
aus dessen Nachlass in der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe.
2
Jakob Wilhelm Huber (1787-1871), befreundeter Maler und Radierer aus Zürich.
3
Ferdinand Fischer (1784-1860), Baumeister aus Stuttgart, lebte von 1808 bis 1812
in Rom.
4
Friedrich Müller (1749-1825), Maler und Dichter, lebte seit 1778 in Rom.
5
Dr. Georg Anton Batt (1775-1839), Privatgelehrter und Müllers Mannheimer
Agent.
6
Caroline Königin von Bayern, geb. Prinzessin von Baden (1776-1841).
7
José Madrazo (1781-1859), spanischer Maler und Radierer, lebte von 1803 bis
1819 in Rom.
8
Joseph Anton Koch (1768-1839), Landschaftsmaler aus Obergiblen in Tirol,
lebte seit 1795 in Rom. Unterbrach seinen Romaufenthalt, um von 1812 bis
1815 in Wien zu leben.
9
Johann Martin von Rohden (1778-1868), Landschaftsmaler aus Kassel, lebte
seit 1795 in Rom.
10
Franz Riepenhausen (1786-1831), Maler aus Göttingen, lebte seit 1805 mit
seinem Bruder Johann (1788-1860) in Rom.
11
Wohl
Rudolph Suhrlandt
(1781-1862),
Maler aus Ludwigslust, lebte von 1808 bis 1816 in Rom, unterbrochen von
einem Aufenthalt in Neapel, der von Mitte 1812 bis
Anfang 1816 dauerte. Laut
Hela Baudis, Rudolph Suhrlandt (1781-1862) Grenzgänger zwischen
Klassizismus und Biedermeier, Inauguraldissertation zur Erlangung des
akademischen Grades eines Doktors der Philosophie der Philosophischen
Fakultät der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, 2007, S. 101 zählte
Rudolph Suhrlandt zu der Reisegruppe von Bianca Milesi, Sophie Reinhard,
Jakob Wilhelm Huber und Joseph Rebell, die im Juni 1812 nach Neapel reiste.
Weil Suhrlandt während der Reise erkrankte, musste er in Velletri
zurückbleiben und konnte erst zwei Wochen später nach Neapel weiterreisen.
12
Dr. Straehlin, Reisebegleiter von Karl Friedrich Freiherr von Uexküll aus
Stuttgart.
13
Dr. Mayer (1777-1812), deutscher Arzt am Militärlazarett in Neapel,
gestorben im Alter von 35 Jahren an Lungenschwindsucht (vergl. Carl August
Böttiger, Tagebuch einer Reise durch einen Theil Deutschlands und durch
Italien in den Jahren 1804 bis 1806 von Elisa von der Recke, Berlin
1815, 3. Bd. S. 37f.). Dr. Mayer, geboren in Rastatt, starb am 4. September
1812 in Neapel (vergl. Süd-Deutsche Miscellen für Leben, Literatur und
Kunst, 2. Jg., Nro. 86, Karlsruhe, 24. Oktober 1812, herausgegeben von
Philipp Joseph von Rehfues).
14
Vetter, nicht ermittelt.
15
Carl Gotthard Graß (1767-1814), Maler und Dichter aus Serben in Livland.
Lebte seit 1805 in Rom (vergl. Gerhard Bott und Heinz Spielmann,
Künstlerleben in Rom, Bertel Thorvaldsen (1770-1844), Ausst.-Kat. des
Germanischen Nationalmuseums Nürnberg, Nürnberg 1992, S. 724).
16
Elisabeth Freifrau von Uexküll geb. Hardegg (1771-1814), Gemahlin des Karl
Friedrich von Uexküll.
17
Hügel im Nordwesten von Rom.
|
|
24
[NL Uexküll, Staatliche
Kunsthalle Karlsruhe]1
Rom d. 3 July
1813
Dießmal haben Sie auch ein
Recht mich zu zanken, denn es ist schändlich daß ich Sie so lange ohne
Andwort ließ, aber (für jedes Übel giebts ein Pflästerle) ich war ohne
äussere Ursache dazu zu haben einige Monathe so melankolisch daß ich keinen
Brief noch sonst etwaß zusammen bringen konnte, der böse Scirocco drückt
ungemein auf mich, deshalb gehe ich in 14 Tagen mit der Milesi nach Orvietto2
um dort frische Luft und die Kunstwerke des Duomos zu genießen, und Ihre
Gesundheit soll bey dieser Gelegenheit in ächtem Orvietto getrunken werden;
machen Sie die Adresse statt caffe greco, al Banco de Rossi so
erhalte ich die Briefe geschwinder. – Müller3 war hochst erfreut
sich in gutem Vernehmen mit Ihnen zu wissen und grüßt Sie, herzlich dankend
für Ihren Brief. Roos4 sehe ich gar nicht mehr, ich wurde als ich
das lezte mahl, das heißt im lezten Oktober dort war, beinahe unhöflich von
der dummen Frau behandelt, waß mich nicht abgehalten hätte ferner hin zu
gehn, da meine Besuche mehr Hr. Roos galten, aber auch er nimmt eine gewisse
Art an, die zu oft nach pax veru riecht, ein Gestank der mir mehr zu wieder
ist als jeder andere. – Überhaupt kann ich Ihnen nur wenig vol von
den alten Bekannten sagen, ich wohne entfernt, und zudem wissen Sie, daß die
Herrn lieber in der Borgese5 sitzen, als in meiner trokenen
Gesellschaft, Rohden6 Reinhart,7 Eberhard8
Steinkopf9 Leipold,10 und Matrazzo11 sehe
ich selten, dagegen oefter Cornelius,12 Overbeck,13
Catel,14 Zoll,15 und Huber16 alle Tage,
dieser empfiehlt sich bestens, er hat ein Bild geendigt, eine Gegend bey
Mare-morto,17 in der Ferne Ischia und Procida, das ungemein gut
ausfiel, alle Reinhard und Müller loben es besonders, 100 Scudi sind ihm
darauf gebothen, nun gearbeitet er an dem von Neapel, und der Gegend, die
colorierd, und recht schön werden, die conture sind radiert, das Blatt wird
auf 4 Scudi, oder 1 Louisd’ors kommen, 6 Blätter gibts in allem, doch kann
sich jeder wählen waß und soviel er will, zwei sind fertig das eine der
Posilipo das andere Neapel von der Villa des Heugelins18 aus
genommen, könnten Sie nicht einiges anbringen? Trinita de monti19
wird auch eins dieser 6 Blätter seyn, von dem Standpunkt aus genommen den
Sie selbst Huber angaben, und der jedermann gefällt.
Auf der französchen Accademie
sind viele Bilder ausgestellt vom Director,20 und von einem
gewissen Enger,21 dieser hat unter andern auf einem großen Stük
Leinewand Osian dargestellt, wie ihm schlafend die Helden die er besiegt
erscheinen, una porckeria tale non é mai stata fatta! – könnten Sie das
Basrelief von Thorwalsten22 sehn welches nach Monte Cavallo
kommt, da würden Sie eine Freude haben, übrigens gibt’s wenig erhebliches,
Eberlein23 hat die Abzehrung, und kein Geld, Vogel24
Wintergest25 sind abgereist ersterer ist noch in Florenz,
letzterer wird nun in Wallerstein seyn, neue Künstler sind mehrere
angekommen, unter andern, Qualiot aus München,26 Hetsch27
sah ich einmal, da ihn Strehlin28 zu mir brachte, dieser Strehlin
ist doch von jedermann geschäzt und geliebt, so gut bescheiden, und gebildet
findet man selten einen jungen Mann von seinen Jahren, ewig schade daß er
wie es scheint nie gesund werden kann! – Von Koch29 erhielt ich
kürzlich einen Brief vom 23 Januar, worin er mit seiner Lage zimmlich
zufrieden ist, doch Rom nicht vergessen kann, das ist natürlich für den
Künstler gibt’s nur ein Künstlerleben, das ausser Rom niergends zu
finden ist, ich bin nun bald 3 Jahre hier, und jeden Tag sehe ich etwas
neues, das unterrichtend ist, wie ich einst in meiner lieben Vatterstadt
leben werde weiß ich auch nicht, und denke mit Schrecken daran, ! ! ! – daß
Sie wieder auf dem Lande sind habe ich gehört, also sind Sie auch wieder
hergestellt? und sind wahrscheinlich wieder so böszungig wie vorher! was
macht Wächter?30 tausend grüsse an meine Freundin, Ihre consorta
infelice, leben Sie wohl und schreiben Sie bald Ihrer aufrichtigen Freundin
S. R.
1
Brief von Sophie Reinhard an:
„Monsieur
le Baron d’Ixkill
l’ainé
à
Stutgart“
aus dessen Nachlass in der
Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe.
2
An der Reise nach Orvieto nahmen auch Bianca Milesi, Jakob Huber und Peter
von Cornelius teil. Vergl. zum Verlauf der Reise die Ausführungen von Carl
Brun, Kreuz- und Querzüge eines Schweizer Malers, Neujahrsblatt der
Künstlergesellschaft in Zürich für 1885, N. F. XLV, S. 10.
3
Friedrich Müller (1749-1825), Maler und Dichter, lebte seit 1778 in Rom.
4
Karl Roos (1775-1837), Kunsttischler aus Ludwigsburg, lebte seit 1804 in
Rom.
5
Laut Friedrich Noack, Das Deutschtum in Rom, seit dem Anfang des
Mittelalters, Stuttgart 1927, Bd. 1, S. 497 besuchten die deutschen
Künstler am Anfang des 19. Jahrhunderts gerne die im Vorbau des Palazzo Borghese gelegene Osteria Sabina.
6
Johann Martin von Rohden (1778-1868), Landschaftsmaler aus Kassel, lebte
seit 1795 in Rom.
7
Johann Christian Reinhart (1761-1847), Maler und Radierer aus Hof, lebte
seit 1789 in Rom.
8
Konrad Eberhard (1768-1859) und Franz Eberhard (1767-1836), beide Bildhauer
aus Hindelang, lebten in Rom von 1806 bis 1819 und von 1821 bis 1826.
9
Gottlieb Friedrich Steinkopf (1779-1860), Maler aus Stuttgart, lebte von
1808 bis 1814 in Rom.
10
Karl Jakob Leybold (1786-1844), Maler aus Stuttgart, lebte wie Steinkopf von
1808 bis 1814 in Rom.
11
José Madrazo (1781-1859), spanischer Maler und Radierer, lebte von 1803 bis
1819 in Rom.
12
Peter von Cornelius (1783-1867), Maler aus Düsseldorf, lebte von 1811 bis
1819 in Rom, anschließend Direktor an die Kunstakademie in München.
13
Johann Friedrich Overbeck (1789-1869), Maler aus Lübeck, lebte seit 1810 in
Rom.
14
Franz Catel (1778-1856), Maler aus Berlin, lebte seit 1811 in Rom.
15
Franz Joseph Zoll (1770-1833), Maler aus dem badischen Möhringen an der
Donau, lebte von 1811 bis 1813 in Rom. 1828 wurde er Galerieinspektor und 1831
Galeriedirektor in Mannheim (vergl. GLA Karlsruhe Bestand 56 Nr. 447).
16
Jakob Wilhelm Huber (1787-1871), befreundeter Maler und Radierer aus Zürich.
17
Mare Morto bei Neapel.
18
Christian Heigelin (1744-1820) aus Stuttgart, dänischer Generalkonsul in
Neapel.
19
Kloster Trinità dei Monti in Rom.
20
Guillaume Lethière (1760-1832), von 1807 bis 1817 Direktor der französischen
Akademie in Rom.
21
Wohl „Ossians Traum“ von Jean Auguste Dominique Ingres (1780-1867), Maler
aus dem französischen Montauban, der von 1806 bis 1820 in Rom lebte. Ingres war bei den
Deutschrömern nicht besonders gelitten, weil sein Gemälde von Raphael, auf
dessen Schoß die Fornarina als Muse, Modell und Geliebte Platz nimmt, nicht
in deren Weltbild passte. Sie sahen darin eine Verunglimpfung des
göttlichen Raphael (vergl. Michael Thimann, Raffael als Idee. Ein
Künstlerphantasma der Romantik, Vortrag bei Fichter Kunsthandel,
Frankfurt 2014, S. 4).
22
Gemeint ist wohl der Alexanderfries im Quirinalpalast in
Rom von Bertel Thorvaldsen.
23
Johann Christian Eberlein (1778-1814), Maler aus Göttingen, lebte seit 1805
in Rom.
24
Ludwig Vogel (1788-1879), Maler aus Zürich, lebte von 1810 bis 1812 in Rom.
25
Joseph Wintergerst (1783-1867), Maler aus Wallerstein, lebte von 1811 bis
Anfang 1813 in Rom.
26
Bei Qualiot handelt es sich um ein Mitglied der Münchner Künstlerfamilie
Quaglio. Katrin Seibert, Rom besuchen – Italienreisen deutscher
Künstlerinnen zwischen 1750 und 1850, München 2009, Bd. I, S. 84
identifiziert Angelo Quaglio (1778-1815).
27
Wohl Gustav Friedrich Hetsch (1788-1864), Maler aus Stuttgart, Sohn des
Philipp Friedrich von Hetsch (1788-1864), Maler aus Stuttgart, seit 1798
Direktor der herzoglichen Gemäldegalerie in Ludwigsburg.
28
Dr. Straehlin, Reisebegleiter von Karl Friedrich Freiherr von Uexküll aus
Stuttgart.
29
Joseph Anton Koch (1768-1839), Landschaftsmaler aus Obergiblen in Tirol,
lebte seit 1795 in Rom. Unterbrach seinen Romaufenthalt, um von 1812 bis
1815 in Wien zu leben.
30
Eberhard von Wächter (1762-1852), Historienmaler aus Balingen. Wächter war
seit 1810 Kustos der Kupferstichsammlung in Stuttgart.
|
|
25
[NL Adam, StA München Nr.
104]1 Rom d. 20. 7ber
1813
Theurer Freund,
Wie tausend, und tausend mahl
habe ich an Sie gedacht, mit Rebell2 und Huber3 von
Ihnen gesprochen! wir hörten Sie sitzen Gefangen, wie hätte ich dann denken
können daß Sie in Mailand sind? zwar oft sagte ich zu Rebell mich soll`s
wundern ob der Fuchs nicht Lunten roch, und sich bey Zeiten aus dem Staub
gemacht hat; – gut daß ich Sie wieder einmal recht beurtheilte, daß Sie noch
Leben, und daß Sie woran ich nie zweifelte noch mein liebes gutes Adämle
sind! unsere Freundschaft ist ja nicht nur für dieses Leben, auch dort wo
das liebste ist waß ich auf dieser Erde hatte, auch dort wird sie
fortdauern. Ja lieber Adam, ich verlohr meinen Vatter, mit ihm den
ehrwürdigen frommen Freund starb auch meine schönste Freude! wenig bleibt
mir übrig, ach Gott, daß kann ich Ihnen nicht schreiben, das muß ich Ihnen
mündlich sagen! o könnte ich es doch recht bald, Sie sahn ihn sein sanftes
liebes Gesicht mit den grauen Haaren, Ihr Herz wird mit mir fühlen, 16 monat
sinds daß er starb, und noch fand ich niemand der meinen Verlust
recht theilte niemand der mich recht versteht – waß ein Jahr verlebte ich!
alles Unglück kam über mich! doch scheint auch nun wieder die Sonne heiter
für mich, meines Vatters Seegen ruht reich auf mir! – Ihre Briefe erhielt
ich alle, habe aber auch alle bis auf den lezten beandwortet, weil mir es
unmöglich schien daß Sie ihn erhalten könnten, erwarte nun mit Sehnsucht
einen recht langen Brief von Ihnen und vor allem die Gewißheit daß ich Sie
hier sehe, werde ich Sie denn nicht vor Freude erdrüken? so Gott will finden
Sie mich noch hier ich habe mir vorgenommen so lange als möglich zu bleiben,
waß ich wohl ausführen kann, wenn ich nicht besonderes Unglück erlebe, ich
habe 800 fl. Pension von meinem Großherzog,4 mit der ich wohl
werde leben können wo ich will, wenn ich nur von Zeit zu Zeit ein Bild nach
Hause schike, meine Heimath hat nun da ich meinen Vatter nicht mehr dort
finde, wenig Anziehendes für mich und Italien, besonders Rom, gefällt mir
täglich besser, ich bin der Sprache ziemlich mächtig, habe unter den
deutschen Künstlern Freunde gefunden die mich achten, habe einige
Fortschritte gemacht, und meine Ansichten über Kunst sind nun berichtigt und
fest, könnte ich`s nur machen wie ich wollte, aber spät kam ich zur Kunst,
noch später auf dem rechten Weg! Sonst hätte wohl waß rechtes aus mir werden
können – doch wie Gott will, ich mache wenigstens das wenige mit Gefühl; die
Anatomie habe ich ganz nach der Natur durchgemalt und zeichne viel auch
Modell weiblich und männlich, das hat mir etwaß geholfen. Ich wohne seit
Jahr und Tag im Hause einer jungen schönen Mailänderin nahmens Milesi5
dies Mädchen wiedmet sich mit seltenem Eifer der Kunst, ist reich geachtet
gut, und meine Freundin, ich gehe zu ihr in die Kost, im Sommer machen wir
kleine Reisen zusammen, kurz ich habe würklich hierin viel Glück sie gefunden
zu haben, und nie hätte ich gedacht daß in Italien eine Freundin für mich zu
finden wäre, ich fand sie, aber das deutsche Herz meiner Geiger6
– fand ich nicht – wie ist es möglich, wir deutsche sind durch Clima
Erziehung, und 1000 Dinge so verschieden von den Italienern! - Huber ist
immer noch mein Freund der mich täglich besucht, Sie tausendmahl grüßt, er
ist etwaß gesetzter, und vernünftiger geworden, und hat ein Bild gemahlt daß
ihm Ehre macht. Rebell ist seit 4 Monat in Neapel, auch er, der bey Huber
wohnte, besuchte mich täglich, er ist ein guter Kerl, nur störte mich oft
sein verschlossenes Wesen! – Im Grunde kann ich nicht über die Italiener
klagen, ich mache wenig Forderungen an sie, denn Herzlichkeit, ist bey denen
unbekannt, schöne Worte tausend Versicherungen, die mir zu einem Ohr hinein,
zum andern hinaus gehen! und dann die verfluchten Pfiffe, und Umwege!
betrogen werde ich seit 2 Jahr nicht mehr, denn ich kenne das Wesen der
Itali so gut, daß ich auch auf der Stelle merke wohin es will, hielte mich
meine Ehrlichkeit nicht ab, ich wollte wohl 10fach heimgeben waß mir
geschah, im Anfang meines Hierseyns! aber das Land, die herrlichen
Kunstsachen, und die himmlische Freiheit in der, der Künstler hier lebt,
machen den Auffenthalt höchst angenehm und manchmal geht mir der Gedanke
durch den Kopf, mich auf immer hier festzusetzen, wer weiß waß geschieht! Ob
ich nicht einst ein Häußchen kauffe, und mein altjungfern Leben da Ende! für
Deutschland bin ich nicht mehr recht tauglich, unter uns gesagt; − ich würde
es besonders in meiner Vatterstadt nicht lange aushalten, doch sagen Sie
hiervon beileibe nichts, sonst richten die Meinigen die Sachen dahien, daß
ich heim kommen muß. Daß Sie sich in manchem Wollen geändert haben, waß mir
nicht an Ihnen gefiel, ist mir räthselhaft, nur eins weiß ich, (worüber wir
in Wien oefters lebhaft disputierten) waß ich nun weniger als zu verzeihn
könnte, wenn Sie sich hierin bekehrt haben so weiß ich nichts, gar nichts
waß ich an Ihnen anderst wünschen möchte! alle menschliche Schwachheiten,
auch jene Beichten und kleine Sünden welche Sie in Schönbrunn und
andernwärts mit gutmüthigen Schönen begingen, verzeihe ich gerne, nur das
eine nicht! – x x.
Ich hoffe Sie schreiben mir nun
oefters als bisher geschah, und lernen auch einmal meine Adresse schreiben,
denn dazu wären Sie lange genug in Italien, waß Teufels setzen Sie denn
statt Pittrice, Pittura, alles lachte im griechischen Caffé7
darüber, daß ich ein Gemälde genannt werde, alla Signora Sofia
Reinhard, Pittrice
a Roma
Caffe Greco
Schreib Er sichs Buchstäblich ab,
Er Dotsch!9
Mein gewöhnliches Fach in der
Kunst wird Ihnen wahrscheinlich nicht behagen, ich gebe mich beynahe immer
mit Legenden ab, die besonders anziehend für mich sind, ohne daß ich wünsche
selbst eine Heilige zu werden.
Daß Sie sich des Esels Berit so
gut annehmen, schrieb ich meinem Vatter, er segnete Sie in einem Brief an
mich, für Ihr gutes Herz, Sehn Sie, der Seegen eines Gerechten hatten Sie
ohne es zu wissen! kein Wunder daß es Ihnen gut geht! kommen Sie nun bald,
und schreiben Sie inzwischen oft und viel, ich zehle darauf daß ich in 3
Wochen von jezt an gerechnet einen Brief von Ihnen habe, adieu leben Sie
wohl küssen Sie ihr junge Adämle8 für mich, ich habe es lieb, es
ist ja ein Sprößlein meines alten Füchsles!
Adieu ewig
Ihre wahre Freundin Sophie
Reinhard.
1
Brief von Sophie Reinhard an Albrecht Adam aus dem Nachlass des Malers im
Stadtarchiv München.
2
Joseph Rebell (1787-1828), Landschaftsmaler und Radierer aus Wien.
3
Jakob Wilhelm Huber (1787-1871), befreundeter Maler aus Zürich.
4
Mitteilung des Geheimen Kabinetts vom 15. Januar 1813.
5
Bianca Milesi (1790-1849), befreundete Malerin und Schriftstellerin aus
Mailand.
6
Margarete Geiger (1783-1809), befreundete Malerin aus Schweinfurt, mit der
Sophie Reinhard gemeinsam in Wien studierte.
7
Caffè Greco in der Via Condotti nahe der spanischen Treppe.
Treffpunkt der deutschen Künstler
in Rom.
8
Albrecht Adam heiratete 1812 Magdalena Sander, die Tochter eines Mailänder
Kaufmanns. 1813 brachte sie Amalie das zweite Kind Albrechts zur Welt.
9 Laut
Ernst Ochs,
Badisches Wörterbuch, Bd. 1, S. 518f., ein ungeschickter, einfältiger
Mensch.
|
|
26
[NL Adam, StA München Nr.
104]1 R. d 5. Jenner 1814
Theurer Freund,
Erst gestern erhielte ich die
paar Zeilen von Ihren, welche Sie in Zolls2 Brief schrieben; wie
leid es mir thut daß Sie so geplagt wurden wegen dem Gelde kann ich Ihnen
nicht sagen, die Milesi3 hat deswegen schon nach Mailand
geschrieben und sich beklagt, Sie können ausser Sorgen seyn, Zoll kann
bezahlen wenn er will (waß ich ihm schon geschrieben habe) und Sie
werden nie in Anspruch genommen werden, verzeihn Sie daß ich Ihnen schon
wieder durch eine Empfehlung plagte, aber ich konnte nicht anderst handeln,
wenn ich dem festen Vorhaben nachleben will die Tugenden meines Vatters
womöglich nachzuahmen, so mußte ich Z. mehr behülflich seyn als ich dem
liebsten Freunde hätte seyn können, denn – er ist mehr mein Feind als
Freund, denn die man liebt gefällig zu seyn ist kein Verdienst, aber denen
die uns hassen böses mit gutem zu vergelten, darin liegt ein hohes Gefühl,
ich that das lieber Adam mit Z. der immer mich hier drükte wo er konnte, und
vornehmlich wegen meiner Pension Neid und Haß gegen mich trägt, er ist ein
roher verstellerischer Mensch der überhaupt viel wiederliches für mich hat,
inzwischen trug ich 2 Jahre alles gedultig, und mit Hülfe Ihrer Gefälligkeit
konnte ich meinen immer dienstfertigen Betragen gegen ihn, noch die Krone
aufsetzen; Genug sagen Sie wie Ihnen der Hr. gefiel? und wie er von mir
sprach? mit Ihnen gewiß als wäre ich ihm sehr lieb? übrigens lassen Sie sich
dadurch nicht mißtrauisch machen, und erweißen Sie allen die ich Ihnen
empfehle Gefälligkeit doch merken Sie sich wohl, daß es dann hauptsächlich
gilt wenn ich schreibe, ich werde alles waß Sie meinem Freunde thun
ansehn als hätten Sie es mir selbst gethan. Auf Ihren mir so sehr
interessanten langen Brief kann ich heute wieder nicht andworden ich muß in
ruhiger Stimmung seyn, nur auf Ihre Fragen und Bemerkungen mit Überlegung
andworten zu können, aber aus allem leuchtet der schöne Mensch sich zu
vervollkommen, bravo lieber Adam das ist das schönste Streben, und das
einzige waß uns hier, und dort Früchte trägt! der Mensch ist doch immer das
erste dann der Künstler, doch kann man das eine thun ohne das andere zu
vernachlässigen. Ich fürchte Sie sind in keiner guten Lage? beruhigen Sie
mich hierüber, ich hoffe dieser Brief welchen ich durch die Milesi schike
kommt in Ihre Hände, wenn Sie mir schreiben geben Sie Ihren Brief in das
Milesische Hauß, so bekomme ich ihn sicher. Gestern erhielte ich Nachricht
von Hause, stellen Sie sich vor der Gegenstand meiner ersten und einzig
wahren Liebe ist nun in der Nähe von C. R.4 vor 16 Jahren musste
ich dem Wunsche entsagen ihn zu besitzen, weil er Leutnant, und ohne
Vermögen war, seit dem hörte ich oft durch die 3te Hand er habe
den Schwur, den er mir schriftlich gab, mich oder keine zu heirathen nicht
gebrochen, und hänge noch immer liebend an mir, nun kommt er zu meiner
Mutter alle paar Tage, da er nur 2 Stund von C. R. im Quartier liegt,
spricht nur von mir, sucht das Zimmer auf wo mein Portrait hängt ist nicht
da wegzubringen, und hat sogar die gemahlten Hände schon verküßet, meiner
Mutter erklärt daß er nie heirathen werde, wenn er nicht noch so glücklich
sey, mich zu besitzen, nun als Oberstleutnant5 könne er mir ein
besseres Glück mit seiner Hand anbiethen, haben Sie eine solche Treue schon
erlebt? ach Adam ich habe niemand mit dem ich hierüber sprechen könnte, aber
die ganze Jugendliche Liebe lebt wieder in meinem alten Herzen auf! ich
konnte nicht wiederstehn ihm sogleich zu schreiben, daß es mich herzlich
freut sichere Nachricht seines Wohlergehens zu haben, und zu wissen daß ich
noch in seinem Andenken lebe, daß ich gewünscht hätte sein Schiksal hätte
ihn in meine Nähe geführt, damit der innige Wunsch ihn in diesem Leben noch
einmahl zu sehn erfüllt wäre, gerne und oft erinnerte ich mich der ersten
einzigen Liebe, an deren Stelle nun hohes Wohlwollen und Freundschaft
getreten sey, ich hoffte auch er belohne in treuem Herzen diese Gesinnungen
seiner wahren Freundin S. – die Meinigen sind alle gerührt durch diese
seltene Anhänglichkeit, glauben aber nicht daß er durch alle Zärtlichkeit,
mich von meiner angetrettenen Bahn abbringen könnte, ach nur zu leicht wäre
dies, ein Glück daß uns viele Meilen trennen! aber meine Ruhe ist wieder auf
lange dahin! Adam mit Ihnen könnte ich darüber sprechen, und auch Sie sind
entfernt – O schöne edle treue Liebe ruffe ich wohl 100mahl aus! ach wäre
ich doch zu Hause! oder ist`s besser so? ich weiß nicht waß ich wünschen
soll!! –
Schreiben Sie gleich, lieber
Freund, und ob Sie in guten Verhältnissen sind, wenn ich dienen kann, auch
das Hemde theile ich mit Ihnen, adieu 1000 Dank für alles waß Sie für Zoll
thaten der Himmel wird Sie segnen. S. R. Qualiot6 sagte ich von
Ihrer Adresse er lässt sich aber nicht sehn, ich höre er sey auch einer wie
Z. nehmen Sie sich in Acht.
1
Brief von Sophie Reinhard:
„Al Signore
Alberto Adam Pittore
viccolo di S’Martino No 554
a
Milano”
aus dem Nachlass des Malers im
Stadtarchiv München.
2
Franz Joseph Zoll (1770-1833) Maler aus Möhringen/Baden. 1821 bis 1825
Zeichenlehrer an der Universität Freiburg, dann Lehrer an Weinbrenners
Bauschule in Karlsruhe.
3
Bianca Milesi (1790-1849), befreundete Malerin aus Mailand.
4
Abkürzung für Carlsruhe.
5
Oberstleutnant Wenzel Freiherr von Kapaun von Swogkow, geb. am 4. September
1768 im böhmischen Jungbunzlau (vergl. Johann Svoboda,
Die Theresianische Militärakademie zu
Wiener-Neustadt und ihre Zöglinge von der Gründung der Anstalt bis auf
unsere Tage, Bd. 1,
Wien 1894, S. 191), gest. am 8. Juni 1816 (vergl. Militär-Schematismus des
österreichischen Kaiserthums, Wien 1816, S. 571).
Andere
Schreibweisen für Swogkow:
Swojkow,
Swoykow,
Svojkow, Svojkov.
Kapaun wird auch Kapoun geschrieben.
6
Bei
Qualiot handelt es sich um ein Mitglied der Münchner Künstlerfamilie Quaglio.
Katrin Seibert,
Rom besuchen –
Italienreisen deutscher Künstlerinnen zwischen 1750 und 1850,
München 2009, Bd. I, S. 84 identifiziert Angelo Quaglio (1778-1815).
|
|
27
[BSB München, Autogr.
Overbeck, Friedrich]1
Roma li 16 febrajo 1814.
Stimatissima Signora
Bianca.
Senza sapere se lei si
ricordera ancora di me, ardisco di incommodarla con questa lettera,
concernente l’affare d’un mio amico molto caro, domiciliato presentemente a
Firenze; nella quale città non avendo nessun altro conoscente a cui mi
potessi indirizzare, ricorro a lei, seguendo il consiglio della Sigra
Sofia,2 e rapportandomi alli suoi assicuramenti, che lei non
piglerebbe in male la mia importunità. Consiste dunque la mia domanda nel
pagamento di dieci otto Scudi, che la prego di fare al Sigre
Giovanni Colombo,3 la quale somma avrà rimborsata dalla Sigra
Sofia, come lo leggera accertato nella sua lettera. Chi ricordo con sommo
piacere del onore che ebbi diverse volte della sua visita, accompagnata
dalla Sigra Sofia, cosa, della quale lei difficilmente si
ricorderà; ma per rammentarle l’autore importuno di queste righe, basterà di
dire, che ricevetti gli ultimi saluti suoi alla Signora Sofia, la matina
della partenza sua di Roma, quando accompagnai Zoll4 alla
vettura, anzi, ricevetti io stesso un servizio da lei nel ultimo momento,
scrivendomi l’indirizzo d’un amico a Firenze per Zoll.
È a questa medesima
gentilezza che ricorro adesso, e al suo buon cuore, aggiungendo solamente,
che fara un servizio doppio, a me ed al mio amico Colombo, uomo
rispettabilissimo in qualunque rapporto, il quale trovandosi improvisamente
nel sommo imbarrazzo, lo sarà sempre obbligatissimo.
Finalmente avrà
pazienza ancora che questa lettera è scritta cosi malamente; che le darà da
fare per capire gli tanti propositi che forse avrà detto, essendo poco
capace ancora della lingua italiana. Gradira ancora gli miei umili ossequi
di venerazione e d’una stima particolare, assieme colli sinceri
assicuramenti della mia gratitudine colla quale sono e saro sempre il suo
ubbidientissimo
Frederigo Overbeck.
1
Brief von Friedrich Overbeck:
„All’ ornatissima Sigra Bianca Milesi
pittrice
Firenze.“
in der Bayerischen
Staatsbibliothek München.
2
Bei der genannten Signora Sofia kann es sich nur um Sophie Reinhard handeln.
3
Giovanni Colombo (1782-1853), Maler aus Palazzolo, der in Wien bei Füger
studierte und sich in Rom seit 1810 den Nazarenern um Franz Pforr und
Friedrich Overbeck anschloss.
4
Franz Joseph Zoll (1770-1833), Maler aus Möhringen/Baden, lebte von 1811 bis
Dezember 1813 in Rom.
|
|
28
[NL Uexküll,
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe]1
Rom d. 20. Juny [1814]2
Unser Briefwechsel ist schon
lange unterbrochen jedoch nicht durch [meine]3
Schuld, denn ich schrieb Ihnen im Januar einen Brief, welche Sie spät w[ahrschein]lich spet oder gar nicht erhielten? nachher erfuhr ich durch
meine M[utter, daß] unsere Freundin4
diese Welt verließ, ich weiß daß Sie v[erzeifelt sind,] ich weiß daß Ihr
Verlust unersezlich ist! – daß bey [ ] damahl nicht schreiben, noch
jezt errinnere ich Sie [an das große] Unglück, und doch wünschte ich die
näheren Umst[ände zu kennen, wie] war es möglich daß die starke gesunde Frau
[ starb,] ich verlohr in ihr eine liebe redliche Freundin, daß [ ist]
gewiß. Wie leben Sie, haben Sie kein Project [das ] hier her Ihren
Kummer zu lenken? – Ihre Freunde fragen [immer nach] Ihnen, und nehmen
aufrichtigen Antheil an Ihrem Schik[sal ] – Noch wollen sich die
gehofften wohlthätigen Folgen des Fri[edens] nicht zeigen, auf die der
Künstler in Rom, so sehnlich hofft, alles arbeitet, aber wenige haben
Bestellungen, und der größte Theil [hat Er]nehrungs Sorgen, doch das wird
Ihnen Steinkopf5
alles mündlich erzeh[len.] Der aelteste Riepenhausen,6
machte eine Brustkrankheit, die wohl ei[ne] Abzehrung zurücklassen könnte,
Matrazzo7
ist reich geworden. Müller8
schmachtet in tiefem Elend, da er schon über 2 Jahre seine Pension nicht
mehr erhielt, er stirbt im eigentlichen Sinne des Worts, beynahe Hungers,
wie wehe es mir thut den verdienstvollen alten Mann darben zu sehn, kann ich
Ihnen nicht beschreiben, er hat alle Munterkeit alles Leben verlohren, ist
an Kleider auch ganz aufgerissen, kurz Sie würden ihn ohne Mitleiden nicht
ansehn können. – Huber9
ist in Castel gandolfo, wo er Freunde hat die sich seiner annehmen, er hat
große Fortschritte in der Kunst gemacht, und mahlt eine würklich schöne
Landschafft, ist aber auch immer in Geldnöthen, Sie werden daher verzeihn
daß ich ihm die lezten 20 Scudi welche ich von dem Ihrigen noch in Händen
hatte gegen Quittung vorgeschossen habe, er versichert Sie hätten ihm noch
einiges bestellt, wo es also nur voraus gegebenes Geld wäre. Ich habe die
Rechnung von dem Gelde waß Sie mir hier ließen, und von allem was ich von
Ihnen erhielte, in ordnung, und würde sie Ihnen [dan]n, wenn ich die
Quittungen welche dazu gehören der Post anvertrauen [kann], ich warte daher
lieber, (wenn Sie es zufrieden sind?) meine [Abreise], die doch bald
erfolgen muß, und an die ich nicht mehr [ohne] Wiederwillen denke, oft wird
mir doch auch das Einsie[dlerle]ben lästig, noch lästiger das Elend so mancher
verdienstvoller [Künstler zu sehn], ohne helfen zu können. Der alte
Francesco10
[ ], es wurde auch eine Collecte für ihn [ ] der Fr v. Ixkul 5
Paul gab, ich [ ] nach oder nicht, ganz der Alte sergante [ ]
Tischler Roos11
hat dann seine Rolle schlecht [gespielt, er wurde ganz] ausgestossen und
verachtet, am meisten [von den Deut]schen, an denen er schändlich handelte,
er war der [Verräter, der Ra]uch,12
Riepenhausen, Hopfgärtner,13
und Roschwei,14
soll als [Täter], bey dem fr. Governo angegeben haben; nun werden [ ]fige
Zettel an das Haus geheftet, unter andern war dieser [in dem] Roos
versichert seine Landsleute möchten ruhig seyn er fände [es nu]n überflüssig
noch ferner den Spion zu machen X X. –
[Vom] Feste bey der Ankunft des
Papstes15
wird Ihnen auch Steinkopf [be]schreiben; übrigens herrscht noch immer das
alte Elend hier, denn der heilige Vatter, ist ganz ohne Geld, und kann nicht
helfen wie er will. – Hr. Hetsch16
sehe ich alle Jahre einmahl, er lebt abgesondert und beynahe sieht er nur
einige Dänen worunter Hr. von Huth,17
welcher wie man sagt nun mit allen Zeremonien, und öffentlich zur allein
seeligmachenden Kirche übergehn wird.
Ich wohne nun seit 7 Monat, im
Pallast des Cardinal Albani,18
neben Müller,19 der Bruder meiner Freundin20
wohnt auch bey uns, dadurch hat das stille Künstlerleben eine andere Wendung
genommen, wir haben Kutschen und Pferde, X X. ich freue mich aber über diese
Veränderung gar nicht, und gedenke des stillen kleinen Häußchens alle monti!
wo mehr gearbeitet wurde, mit Wehmuth! – Wahrscheinlich gehe ich auch bald
nach Castelgandolfo, wo sich schon seit 14 Tag die Milesi [befindet].21
1
Brief von Sophie Reinhard an Karl Friedrich Freiherr von Uexküll (1755-1832)
aus dessen Nachlass in der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe.
2
Die Datierung kann aufgrund des Inhaltes der Mitteilungen erfolgen.
3
Der Brief ist stark beschädigt, weshalb Lücken oder Ergänzungen mit einer
eckigen Klammer gekennzeichnet sind.
4
Gemeint ist Elisabeth Freifrau von Uexküll geb. Hardegg (1771-1814),
Gemahlin des Karl Friedrich von Uexküll, die am 11. Februar 1814 starb.
5
Gottlieb Friedrich Steinkopf (1779-1860), Maler aus Stuttgart, lebte von
1808 bis 1814 in Rom.
6
Franz Riepenhausen (1786-1831), Maler aus Göttingen, lebte und arbeitete
gemeinsam mit seinem Bruder Johann seit 1805 in Rom.
7
José Madrazo (1781-1859), spanischer Maler und Radierer, lebte von 1803 bis
1819 in Rom. 1811 bis 1815 Kammermaler des in Rom lebenden Exkönigs Karl IV.
von Spanien.
8
Friedrich Müller (1749-1825), Maler und Dichter, lebte seit 1778 in Rom.
9
Jakob Wilhelm Huber (1787-1871), befreundeter Maler und Radierer aus Zürich.
10
Francesco, vielleicht ein ehemaliger Bediensteter.
11
Karl Roos (1775-1837), Kunsttischler aus Ludwigsburg, lebte seit 1804 in
Rom.
12
Christian Rauch (1777-1857), Bildhauer aus Arolsen, weilte ab 1805 mehrfach
in Rom (vergl. den Brief der Künstlerin vom 4. Mai 1815 an Karl Friedrich
Freiherr von Uexküll).
13
Wilhelm Hopfgarten (1779-1860), Bronzegießer aus Berlin, lebte seit 1805 in
Rom.
14
Ferdinand Ruscheweyh (1785-1845), Zeichner und Kupferstecher aus
Neustrelitz, lebte von 1808 bis 1832 in Rom.
15
Papst Pius VII. – seit 1812 in Frankreich interniert – konnte am 3. Juni
1814 wieder in Rom Einzug halten.
16
Wohl Gustav Friedrich Hetsch (1788-1864), Maler aus Stuttgart, Sohn des
Philipp Friedrich von Hetsch (1788-1864), Maler aus Stuttgart, seit 1798
Direktor der herzoglichen Gemäldegalerie in Ludwigsburg.
17
Carl Wilhelm von Huth (1778-1818), dänischer Hauptmann.
18
Palazzo Albani del Drago, Via delle Quattro Fontane.
Hier hatte schon Winkelmann von
1760 bis zu seinem Tod 1768 als Bibliothekar des Kardinals Albani gewohnt
(vergl. Friedrich Noack, Das Deutschtum in Rom, seit dem Anfang des
Mittelalters, Stuttgart 1927, Bd. 2, S. 649).
19
Friedrich Müller wohnte in der Via delle Quattro Fontane 109 (vergl.
Friedrich Noack, Das Deutschtum in Rom, seit dem Anfang des Mittelalters,
Stuttgart 1927, Bd. 2, S. 412).
20
Carlo Milesi (1795-1829), Bruder von Bianca Milesi.
21
Der Brief endet an dieser Stelle. Die nächste Seite ist abgetrennt. Es ist
aber zu erkennen, dass der Brief nach vier weiteren Zeilen endete.
|
|
29
[Freies Deutsches
Hochstift, Nr. 9364]1 [August/September 1814]2
Verehrteste Freundin!
Den herzlichsten Danck statte ich
Ihnen ab für die Nachricht womit Sie mich durch den Einschluß an Herrn
Eberhart3 erfreuet und muntre Sie auf da Sie doch einmahl sich
meiner so weit freundschaftlich angenommen das gute Werck weiter aus zu
führen und dem Herrn Hoffprediger von Schmidt4 nebst meinem Danck
für dessen gütige Bemühung zugleich meine fernere Bitte vor zu tragen in
gegen wertiger Lage mich nicht zu verlassen, sondern deßen edlem versprechen
so bald als möglich Kraft zu ertheilen. Mir bleibt es ein Räthsel was
Dalarmi5 und Rath Öertel6 versichern nehmlich daß
meine Pension7 ausbezahlt sey, an wen? auf welche Weiße? ich
wenigstens weis hievon nichts, künftigen October sind drey Jahre verfloßen
daß ich nichts von München aus erhalten habe. Ich verlasse mich in diesem
meinem Anliegen auf Sie verehrteste Freundin und auf ihr wohlwollendes,
menschenfreundliches Herz Sie können sich selbst vorstellen in welcher Lage
ich mich befinde, und habe die Ehre mit volkomenster Hochachte mich zu
unterzeichnen, Ihr ergebenster freund und Diener Frid. Müller.
1
Entwurf eines Briefes von Friedrich Müller gen. Maler Müller (1749-1825) aus
Rom vom August/September 1814 an Sophie Reinhard (Quelle: Rolf Paulus und
Gerhard Sauder (Hrsg.), Friedrich
Müller genannt Maler Müller, Werke und Briefe, Briefwechsel, Kritische
Ausgabe, Teil 2: Briefwechsel 1812-1825,
Heidelberg 1998, S. 704).
2
Die Angaben im Brief weisen auf das Jahr 1814. Sophie Reinhard reiste am 26.
Juni in Rom ab, um Mitte Juli 1814 nach Karlsruhe zurückzukehren.
3
Wohl Konrad Eberhard (1768-1859), Bildhauer aus Hindelang, lebte mit seinem
Bruder in Rom von 1806 bis 1819 und von 1821 bis 1826.
4
Dr. Ludwig Friedrich von Schmidt (1764-1857), Hofprediger und Berater von
Caroline Königin von Bayern geb. Prinzessin von Baden.
5
Andreas Michael von Dall’Armi (1765-1842), Kaufmann und Bankier in Rom.
6
Hofrat Oertel, bayerischer Hofbeamter.
7
Friedrich Müller bezog eine Pension, zunächst vom Hofe in Mannheim, dann vom
Hofe in München. Aus dem Briefverkehr zwischen Sophie Reinhard und Karl
Friedrich Freiherr von Uexküll wird deutlich, dass sich Müller ständig in
Geldnot befand, weil seine Pension unregelmäßig oder jahrelang gar nicht
ausbezahlt wurde. Davon spricht Müller auch in seinem Brief an Sophie
Reinhard. Sie und ihre Familie hatten schon einmal im Jahre 1811 ihre
Beziehungen zum bayerischen und badischen Hof geltend gemacht (vergl. Rolf
Paulus und Gerhard Sauder (Hrsg.),
Friedrich Müller genannt Maler Müller, Werke und Briefe, Briefwechsel,
Kritische Ausgabe, Teil 1: Briefwechsel 1773-1811,
Heidelberg 1998, S. 593f.), und
konnten 1812 die Auszahlung eines Pensionsrückstandes aus der Mannheimer
Liquidationskasse bewirken (vergl. Rolf Paulus und Gerhard Sauder (Hrsg.),
Friedrich Müller genannt Maler
Müller, Werke und Briefe, Briefwechsel, Kritische Ausgabe, Teil 2:
Briefwechsel 1812-1825,
Heidelberg 1998, S. 694).
|
|
30
[NL Uexküll,
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe]1 Carlsruhe d. 15 Jenner 1815.
Theurer Freund,
Ich zehlte ganz sicher darauf Sie
hier zu sehn, und beandwortete deswegen bisher Ihren Brief nicht, ich sehe
aber leider wohl daß Sie gar kein Verlangen haben mündliche Nachrichten von
Rom und Ihren dortigen Freunden zu hören denn Sie waren in Heidelberg und
wollten nicht einmahl die kleine Streke Weg bis hier her machen? das ärgert
auch recht, − unsere Abrechnungen würde ich auch viel lieber mündlich als
schriftlich abgethan haben, wollen Sie daß ich Ihnen Quittungen und
Rechnungen schike? etwaß weniger muß ich Ihnen noch heraus bezahlen.
Ihre contulazion und gratulazion
nehme ich an, ich kann es nicht bereuen auf einige Zeit das schöne Rom
verlassen zu haben, weil mir meine Rükkehr ins Vatterland Freude und
Vortheil brachte, und ich dabey immer die Gewißheit habe wieder nach Rom
gehn zu können sobald mein Beutel sich von der lezten Reiße erholt hat,
welches längstens bis künftiges Spetjahr geschehn wird, wo ich inzwischen
fürs erste nur nach Mailand gehn werde, weil schon künftigen Frühling meine
Freundin2
dort hin geht.
Von Rom hätte ich Ihnen viel zu
sagen, waß sich ohnmöglich schreiben läßt. Dem armen Müller3
möchte sehr die 20 Scudi gönnen welche Sie ihm großmüthig bestimmen, aber
ich kann Ihnen würklich nicht sagen wie Sie es machen sollen, das beste
glaube ich wäre durch Roos,4
dem Sie schreiben könnten für den Ertrag einiger Exemplare von Müllers
Werke? so viel ich weiß hat er noch keine Besoldung, und muß in tiefem Elend
steken!
Daß Rohden5
kürzlich die Tochter des Sibillen Wirth in Tivoli heirathete werden Sie
wissen, Graß6
ist todt, Wagner7
will auch heirathen, Catel8
ist geheirathet, das Monument welches Rauch9
für die Königin von Peusen10
verfertigte, wurde auf dem Meer gekappert. Huber11
ist seit 2 Monath in Neapel wo er bessere Aussichten hat Geld zu verdienen
als in Rom, wo zwar schon eine Menge Engländer sind, welche aber noch für
keinen Heller kaufften. Von Koch12
bekam ich kürzlich einen Brief, der will auch wieder nach Rom, glaubt dort
goldene Berge zu finden, wird sich irren. Ich glaube immer er that wohl nach
Wien zu gehn, und würde in R. die Zeit über großen Mangel gelitten haben.
Seine Frau beschenkte ihn mit einem Knäblein. Warum lassen Sie sich nicht
für das Geld waß er Ihnen noch schuldig ist ein Bild machen? er ist nun auf
seiner
der höchsten Stuffe seiner Kunst, Sie werden bezahlt, und Koch wälzen Sie
einen Stein vom Herzen der ihn sehr drükt. In Piazza di Spagna wird gerädert
und geköpft, von la storda13 bis Rom ist die Straße mit Köpfen ärmen und
Füssen geziert, auf dem corsso alle Pontifici ist die Corda errichtet und
wird häuffig gebraucht. – Besinnen Sie sich eines besseren und kommen –
schreiben Sie wenigstens bald
Ihrer
Sie verehrende
Freundin Sophie
R
1 Brief von Sophie
Reinhard an Karl Friedrich Freiherr von Uexküll (1755-1832).
2
Bianca Milesi (1790-1849), befreundete Malerin aus Mailand. Laut Émile
Souvestre, Blanche Milesi-Mojon. Notice biographique, Angers 1854,
Seite 36, reiste Bianca Milesi am 16. April 1815 in Rom ab.
3
Friedrich Müller (1749-1825), Maler und Dichter, lebte seit 1778 in Rom.
4
Karl Roos (1775-1837), Kunsttischler aus Ludwigsburg, lebte seit 1804 in
Rom.
5
Johann Martin von Rohden (1778-1868), Landschaftsmaler aus Kassel, lebte
seit 1795 in Rom.
6
Carl
Gotthard Graß (1767-1814), Maler und Dichter aus Serben in Livland. Lebte seit 1805 in
Rom (vergl. Gerhard Bott und Heinz Spielmann,
Künstlerleben in Rom,
Bertel Thorvaldsen (1770-1844),
Ausst.-Kat. des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg, Nürnberg 1992, S.
724).
7
Johann Martin Wagner (1777-1858), Maler und Bildhauer aus Würzburg, lebte
seit 1804 in Rom.
8
Franz Catel (1778-1856), Maler aus Berlin, lebte seit 1811 in Rom.
9
Christian Rauch (1777-1857), Bildhauer aus Arolsen, weilte ab 1805 mehrfach
in Rom.
10
Grabdenkmal für Luise Königin von Preußen (1776-1810).
11
Jakob Wilhelm Huber (1787-1871), befreundeter Maler aus Zürich.
12
Joseph Anton Koch (1768-1839), Landschaftsmaler aus Obergiblen in Tirol,
lebte seit 1795 in Rom.
13
Vielleicht ist unter La Storta ein Ort nordwestlich von Rom zu verstehen.
|
|
31
[NL Uexküll,
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe]1
[Karlsruhe Januar 1815]2
|
Von Herrn Ixküll aus
Stutgart erhielte ich Sofia Reinhard |
|
|
| |
S |
B |
|
den 14 Juni 1811 Scudi |
40 |
|
|
von Bildhauer Keller
Scudi |
2 |
40 |
|
den 26 8ber 1811 ein
Wechsel auf Torlonia |
200 |
|
|
Von Day für die Caretta |
20 |
|
|
Summa 262 |
––– |
40 |
|
für
Herrn von Ixküll bezahlte
ich
Sofia Reinhard |
|
|
| |
S. |
B |
|
Julli 1811 Hr. Huber für
eine Platte |
22 |
|
|
dem Bronzarbeiter Poschi laut Quit. |
60 |
|
|
den 15 August 1811 Briefporto |
|
18 |
|
den 23 7ber Hr. Huber für eine
Platte |
22 |
|
|
den 3 8.ber 1811 Briefporto |
|
18 |
|
den 19. 9br 1811 dito |
|
18 |
|
den 11 Xber 1811 dito |
|
35 |
|
den 28. 8.ber Hr. Huber für eine
Platte |
22 |
|
|
Briefporto |
|
19 |
|
laut Quittung an Koch |
110 |
|
|
dem alten Francesco |
|
50 |
|
im Januar 1812 B.porto |
|
18 |
|
im Merz dito |
|
18 |
|
im Aprill dito |
|
18 |
|
den 14 Juny dito |
|
18 |
|
im Februar 1813 dito |
|
19 |
|
an Wintergerst |
2 |
|
|
im Aprill 1813 Briefp. |
|
19 |
|
im August dito |
|
20 |
|
Hr. Huber vorgestrekt |
20 |
|
|
dem alten Francesco |
|
50 |
|
Summa 261 |
––– |
38 |
1
Abrechnung über Einnahmen und Ausgaben, welche Sophie Reinhard namens Karl
Friedrich Freiherr von Uexküll in Rom vorgenommen hat. Aus dessen Nachlass
in der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe.
2
Zur Datierung vergleiche Brief der Künstlerin vom 15. Januar 1815 mit der
Bemerkung „unsere Abrechnungen würde ich auch viel lieber mündlich als
schriftlich abgethan haben, wollen Sie daß ich Ihnen Quittungen und
Rechnungen schike? etwaß weniger muß ich Ihnen noch heraus bezahlen.“
|
|
32
[NL Uexküll,
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe]1 Carlsr. 4 Mai 1815.
Verzeihn Sie, theurer Freund, daß
ich Ihnen so lange nicht schrieb, aber meistens verstimmt, dann war meine
Mutter 14 Tage krank, das machte mir Sorgen, und nachher, bekam ich ein
Catharrfieber welches mich 4 Wochen meistens im Bette hielt, und zu jeder
Arbeit untüchtig machte, seit wenigen Tagen geht es besser, und ich benütze
den ersten erträglichen Tag, und schreibe an Sie. Vielen Dank für das kleine
Buch über Rom, ich laas es mit großem Vergnügen. Wann, und ob ich die Sachen
an Müller2 mitnehmen werde das ist im weiten Felde, denn wer kann
sich heut zu Tage etwaß vornehmen? Künftiges Spetjahr wollte ich wieder nach
Italien gehn, aber – nun muß man fest sitzen bleiben wo man ist, bis das
Gewitter, uns den Garaus gemacht, oder vorüber ist! – Ihren Freund B.3
sah ich seit mehreren Monathen nicht, konnte ihm also Ihren Gruß nicht
ausrichten, ich suche mir alles unangenehme wo ich kann vom Hals zu
schaffen, und dahin gehören auch B. Besuche, die mir kein Vergnügen gewähren
können, weil ich allen boßhaften Spott, und das Bestreben alle die, so etwaß
gelert (folglich mehr sind als er) herunterzusetzen, an niemand, aber am
wenigsten an einem Menschen leiden kann, der so sehr Nachsicht bedarf –
meine Arbeiten lobte er zwar über den Scherbenkönig wie man zu sagen pflegt,
aber das macht mich nicht blind für seinen bösen Willen. – Weinbrenner4
und Haldenwang5 sind die einzigen mit denen ich über Kunst sprach
– und ich fand noch niemand, der so viel ächten Sinn für Kunst hatt als der
Ehrliche Wbrenner.
Huber6 ist seit 5-6
Monat in Neapel wo er sich gut fortbringt, er hatt Bestellungen, und giebt
auch Unterricht – Waagner7 war im Begriff sich zu heirathen, hatt
aber die Gedanken fürs erste aufgegeben, weil die Engländer für keinen
Heller kauffen, ausser einigen aquarell von Kaisermann8 und eine
Statue von Canova,9 wurde auch gar nichts gekauft, wiewohl eine
Menge sehr reicher Engl. Rom überschwemmt hatt; daher kommt es dann daß die
meisten Künstler noch am Hungertuch nagen.
Rohden10 wird
nächstens Papa werden.
Roos11 spielte eine
schlechte Rolle, und ist allgemein verachtet. Übrigens hatt er sich schnell
bereichert. Am Gambaro12 wurden auch einmahl die Fenster, durch
trasteberiner13 eingeworffen, die ledige Schwester von dem Roos
seiner Frau, hatt den Sohn von Lethier,14 dem Directeur der fr.
Accademie geheirathet, Roos und Lethier bekamen Verdruß, wegen der Dota,
oder Aussteuer, und nachher bey Gelegenheit als die 5 deutsche Rauch,15
Rippenhausen,16 Ruschway,17 und Hopfengartner18
nach chalon19 sollten gebracht werden, verrieth Lethier daß Roos
seine Landsl. selbst bey der Pollizei angegeben habe, – er mußte vieles,
aber alles verdient leiden. – Wächter20 war bey mir, aber ich
fand nicht mehr den Mann an ihm, wie vor 6 Jahren, er lag die meiste Zeit
seines Hierseins in der Kirche, weßwegen ihm Wbrenner bey dem er 8 Tag
logierte die Wahrheit derb sagte, aber waß hilfts? W. ist bey all seiner
schönen Kunst eben ein Narr! – Ich bin sehr begierig auf bessere Nachrichten
von Ihrer Gesundheit und Stimmung betreffend, Sie haben eine Freundin
verlohren, die Ihnen nie ersetzt werden kann daß ist gewiß, aber Sie haben
Sinn für Vieles, Geld und Zeit sich Genuß zu verschaffen, und ich glaube Sie
sollten so bald Ihre Gesundheit besser ist, wo nicht nach Rom, doch irgend
eine andere Reise machen, auf Ihrem einsamen Eschenau21 müssen
Sie ja ganz melancholisch werden! Hätte ich mich nicht durch meine Reise in
Schulden gestürzt, ich wäre schon lange zu Ihnen gekommen, aber ich muß
spahren, damit ich bezahlen kann. Aber unendlich soll michs freuen wenn Sie
endlich einmahl hierher kommen, – ach mein Gott, es wird mir seyn als wäre
ich wieder in Rom. – Leben Sie wohl, und verzeihn Sie, daß ich erst jetzo
schreibe, aber ich versichere Sie, ich bin auch in einer Stimmung, wo man
sich zu allem zwingen muß!
Mich Ihnen empfehlend,
S. R
1
Brief von Sophie Reinhard an Karl Friedrich Freiherr von Uexküll (1755-1832)
aus dessen Nachlass in der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe.
2
Friedrich Müller (1749-1825), Maler und Dichter, lebte seit 1778 in Rom.
3
Unter dem Namenskürzel B. dürfte sich Becker verbergen. Der Karlsruher
Galeriedirektor war ein alter Freund Uexkülls.
4
Friedrich Weinbrenner (1766-1826), Architekt, Geheimer Rat und
Großherzoglicher Oberbaudirektor in Karlsruhe.
5
Christian Haldenwang (1770-1831), aus Durlach, seit 1805 Hofkupferstecher in
Karlsruhe.
6
Jakob Wilhelm Huber (1787-1871), befreundeter Maler aus Zürich.
7
Johann Martin Wagner (1777-1858), Maler und Bildhauer aus Würzburg, lebte
seit 1804 in Rom.
8
Franz Kaisermann (1765-1833), Maler aus Yverdon in der französischen
Schweiz, lebte seit 1789 in Rom.
9
Antonio Canova (1757-1822),
Bildhauer aus
Possagno, lebte seit
1779 in Rom.
10
Johann Martin von Rohden (1778-1868), Landschaftsmaler aus Kassel, lebte
seit 1795 in Rom. Er war seit 1815 mit Caterina Coccanari, einer Tochter des
Sibyllenwirtes in Tivoli, verheiratet.
11
Karl Roos (1775-1837), Kunsttischler aus Ludwigsburg, lebte seit 1804 in
Rom.
12
Gambaro,
vielleicht ist die Via del Gambaro oder das gleichnamige Gasthaus in dieser
Straße gemeint.
13
Einwohner des römischen Stadtteiles Trastevere.
14
Guillaume Lethière (1760-1832), von 1807 bis 1817 Direktor der französischen
Akademie in Rom.
15
Christian Rauch (1777-1857), Bildhauer aus Arolsen, weilte ab 1805 mehrfach
in Rom.
16
Franz Riepenhausen (1786-1831), Maler aus Göttingen, lebte und arbeitete
gemeinsam mit seinem Bruder Johann seit 1805 in Rom.
17
Ferdinand Ruscheweyh (1785-1845), Zeichner und Kupferstecher aus
Neustrelitz, lebte von 1808 bis 1832 in Rom.
18
Wilhelm Hopfgarten (1779-1860), Bronzegießer aus Berlin, lebte seit 1805 in
Rom.
19
Die Deportation in das Gefängnis von Chalon-sur-Saône konnte durch die
Fürsprache von Antonio Canova und Guillaume Lethière verhindert werden
(vergl. Max Kunze (Hrsg.), Antike zwischen Klassizismus und Romantik. Die
Künstlerfamilie Riepenhausen, Ausst.-Kat. Winckelmann-Gesellschaft
Stendal, 2001, S. 35).
20
Eberhard von Wächter (1762-1852), Historienmaler aus Balingen. Er weilte
laut Paul Köster, Eberhard Wächter (1762-1852), Ein Maler des deutschen
Klassizismus, Diss. Bonn, 1968, S. 45 von 1792 bis 1798 in Rom. Seit
1810 war er Kustos der Kupferstichsammlung in Stuttgart.
21
Schloss Eschenau in der Gemeinde Obersulm im Landkreis Heilbronn.
|
|

Brustbild des
Großherzoglich Badischen Oberbaudirektors
Friedrich Weinbrenner (1766-1826).
Den Freunden und Verehrern desselben gewidmet von G. Moller 1822. Gezeichnet und
radiert von Carl Sandhaas
(Bildnachweis: E. Fecker)
|
|
33
[GLA Karlsruhe 56 Nr. 382]1
Großherzogl. Geheimes Cabinet. Carlsruhe, den 22ten Julius 1815.
Seine Königliche Hoheit
haben der Mahlerin Dlle. Sophie
Reinhard von hier die Erlaubniß zur Verehelichung mit dem KK.
Oesterreichischen Oberst-Lieutenant von Kappaun, im Chevauxlegers-Regiment
von Vincent, unter unabgekürzter Belassung ihres jährlichen Gehalts von
Achthundert Gulden, auch im Ausland, jedoch mit der ihr p AndNo. 67 den 15
Jenner 1813. auferlegten Verbindlichkeit, daß sie von Zeit zu Zeit eine
Arbeit einzuliefern habe, zu ertheilen geruhet;
und
soll noch auf höchsten Befehl,
dem Finanz Ministerium und der Sophie Reinhard hiervon Nachricht gegeben
werden.
1 Abschrift der Antwort des
Großherzoglichen Geheimen Kabinetts auf eine Anfrage von Sophie Reinhard den
Oberstleutnant von Kapaun heiraten zu dürfen.
|
|
34
[GLA Karlsruhe 56 Nr. 382]1 [Karlsruhe, den 28. Oktober 1816]
Durchlauchtigster Großherzog,
Allergnädigster Herr;
Meine dermalen zu Heidelberg
befindliche Schwester hat mich beauftragt, Eurer Königlichen Hoheit ein
kleines auf Holz gearbeitetes Oehlgemälde2 mit der
unterthänigsten Bitte zu überreichen,
„daß Allerhöchst dieselbe solches
als einen ersten unvollkommenen Versuch,
irgend einen interessanten Act
der vaterländischen Geschichte bildlich
darzustellen, eines
nachsichtsvollen Blicks würdigen möchten, indem Sie
in Bezug auf die allergnädigst
bewilligte Pension die ihr angenehme
Pflicht durch eine größere und
vollendetere Arbeit erfüllen werde.“
Füglich soll ich wegen einer
allenfallsigen Erinnerung, daß Markgrav Karl Wilhelm sich nicht ähnlich
sehe, die unterthänigste Bemerkung beyfügen, daß sie zum Behuf dieser
Ähnlichkeit einen alten Ducaten als einzigen Leitstern gehabt habe.
Der ich in tiefster Devotion verbleibe
Euerer
Königlichen Hoheit
Karlsruhe 28. Oct: 1816.
allerunterthänigster
W Reinhard.
1
Brief des Bruders von Sophie Reinhard Geheimer Referendär Wilhelm Reinhard
(1776-1858) an Karl Ludwig Großherzog von Baden.
2
Vergleiche das Manuskript des Antwortschreibens des Großherzogs vom 28.
Oktober 1816.
3
Carl Wilhelm Markgraf von Baden-Durlach (1679-1739), Gründer der Stadt
Karlsruhe, ließ einen Golddukaten mit seinem Portrait auf der Schauseite
prägen (vergl. die Abbildung bei Hans Merkle,
Carl Wilhelm Markgraf
von Baden-Durlach und Gründer der Stadt Karlsruhe (1679-1738),
Heidelberg 2012, S. 122)
|
|
35
[GLA Karlsruhe 56 Nr. 382]1 [Karlsruhe, den 28. Oktober 1816]
An
Mademoiselle Sophie Reinhard
Heidelberg
Nahmens Sr Königlichen
Hoheit des Großherzogs
Ich danke Ihnen verbindlich für
das schöne Gemählde Meines Ahnherrn, des Markgrafen Carl Wilhelm,2
das Sie Mir übersandt haben, und dessen Gegenstand Mir äusserst interessant
seyn muß.
Ich werde mit ausgezeichnetem
Vergnügen fernerhin dergleichen Darstellungen aus der Geschichte Meines
Hauses von Ihnen bearbeitet sehen und verbleibe mit besonderer Achtung
/eigenhändig/ dero ergebener
Carl
Karlsruhe
Den 28. Oktbr
1816.
1
Abschrift der Antwort von Karl Ludwig Großherzog von Baden auf das Schreiben
von Wilhelm Reinhard vom 28. Oktober 1816.
2
Wohl das bei Gerda Kircher, Zähringer Bildnissammlung im neuen Schloss zu
Baden-Baden, S. 189 erwähnte Gemälde „Traum des Markgrafen Karl Wilhelm“
mit der Inventar-Nr. K 232. Dort als Pflichtbild bezeichnet.
|
|
36
[GNM Nürnberg, Nachlässe
Böttiger]1 Baden bey Rastad2
16 Julii 1818
Sie werden mich für eine
undankbare halten, weil ich so späht ihnen den versprochene Pseudo-Deutsche
Brief, schreibe. Wenn ich in meine Mutter Sprache ihnen Schreibe dürfte, so
hätte ich mich schon lang dazu entschloßen, aber ich hätte auf diese Art,
mein heiliges Versprechen, nur halb gehalten, und es wäre nicht richtig
gewesen.
Unsere Reise war glücklich; und
durch ihre Freundschaftliche Sorge, war sie sehr angenehm. Überall ihre
emphelung haben uns viel Freude verschaffen. Die Artigkeit von den Herrn
Brock[h]aus3 hat sich nicht nur in Leippzig geaußert, sondern
habe ich hier ein neue Beweiß dasselbe gehabt. Er hat mir ein Buch
geschickt, das ich so gern haben wollte, und nicht damals in Leipzig zu
haben war.
Die Frau von Reichenbach4
war sehr freundlich, und wird mich, nach kurze Zeit, in Mayland besuchen.
Die Gräfin Edling5 war abgereist, und wir haben den Brief in
Weimar, bey ihre Bedienter abgegeben, weil wir von Leipzig, gerade nach
Weimar gereist sind: die Straße durch Jena war nicht zu machen, als mit vier
Pferden. Nach Jena sind wir von Weimar gegangen. Dort war der Major Knebel6
sehr gefällig; aber Göthe, wegen die schlechten umstände seiner Gesundheit,
war lieder nicht sichtbar. Auch die intereßante bekantschaft von
Legationsraths Bertuch7 war uns von Schicksal beraubt, aber seyn
Schwiegersohn Dr Frioriep,8 der sowohl als seyne Frau,9
uns sehr gefallen hat, hat uns von Bertuchs abwesenheits vergelten.
In Gotha waren wir mit eine
unausprächliche Artigkeit von dem Herzog10 empfangen. Er hat uns
so viel Beweiß von seiner güte gegeben, daß ich nicht im stand bin ihnen zu
beschreiben. Ich bitte ihnen wenn Sie ihm schreiben, so laßen Sie eine Spur
von unsere Dankbarkeit durchfahren, so wohl auch an die andere die oben
genannt sind. Der vortrefflicher Madelung,11 und der Kriegsrath
Reichard,12 sollen auch nicht vergeßen seyn.
Jetzt muß ich eine frage
anzubitten, wegen der Maas ihre Stambuch. Ist es so groß wie der ganze
ausgebreite Blat, wo sie mir den Winter für meine Reise geschrieben haben,
oder nur die [H]elfte deßelben. Sein Sie so gut, schreiben Sie mir die
Antwort nach Mayland, wo ich in Anfang August seyn wird. Meine empfelung an
der C. Hartmann13 und Winspear.14 Meine Freundin
Sophie bitte Sie um ihre erinnerung sowohl als ihre ergebene
Bianca Milesi
1
Brief von Bianca Milesi:
„An Herrn
Hofrath
Carl August
Böttiger
Dresden“
aus
dessen Nachlass im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg, Signatur: Nachlässe Böttiger
Carl August, K 18, Milesi Mojon Bianca. Auf der Adressseite ist ein
zweizeiliger Kastenstempel „LEIPZIG 22. Jul.18.“ als Aufgabestempel
abgeschlagen, was vermuten lässt, dass der Brief nach Leipzig mitgenommen
und dort zur Post nach Dresden aufgegeben wurde.
2
i. e.
Baden-Baden bei Rastatt.
3
Friedrich Arnold Brockhaus (1772-1823),
Gründer des Verlagshauses F. A. Brockhaus in Leipzig.
4
Wohl Wilhelmine von Reichenbach, Leipzig (vergl. Brief von Wilhelmine
Reichenbach an Carl August Böttiger vom 22.08.1817 aus Leipzig im
Germanischen Nationalmuseum Nürnberg, Historisches Archiv, Nachlässe
Böttiger).
5
Roxandra Sturdza (1786-1844), Philanthropin, heiratete 1815 den weimarschen
Minister Albert Cajetan Graf von Edling. In Weimar lebte sie bis 1819.
6
Major Karl Ludwig von Knebel (1744-1832), Lyriker und Übersetzer, Freund
Goethes in Jena.
7
Friedrich Johann Justin Bertuch
(1747-1822), Schriftsteller und Verleger in Weimar.
8
Dr. Ludwig Friedrich von Froriep (1779-1847), Professor für Chirurgie,
Verleger und Leiter des Geographischen
Instituts in Weimar.
9
Charlotte von Froriep (1779-1839), Ehefrau des Ludwig Friedrich von Froriep.
10
Herzog August von Sachsen-Gotha und Altenburg (1772-1822).
11
Karl Ernst August Wilhelm Madelung (1776-1849), Geheimer Hofrat am Hofe des
Herzogs August in Gotha.
12
Heinrich August Ottokar Reichard (1751-1828),
Kriegsrat,
Schriftsteller, Bibliothekar in Gotha.
13
Wohl Christian Ferdinand Hartmann (1774-1842), Historienmaler, seit 1810
Professor an der Kunstakademie zu Dresden.
14
Baron David Winspear (1775-1847), Jurist, Anwalt und Philosoph, stand in
Diensten von König Ferdinand I. von Neapel (vergl. auch Brief von Winspear
an Carl August Böttiger vom 25.07.1819 aus Neapel im Germanischen
Nationalmuseum Nürnberg, Historisches Archiv, Nachlässe Böttiger).
|
|
37
[GLA Karlsruhe 56 Nr. 382]1 [Karlsruhe, den 4. Januar 1819]
Durchlauchtigster Grosherzog,
Gnädigster Fürst und Herr,
S. K. Hoheit der hochseelige
Grosherzog Karl,2 haben bey Bewilligung meiner Pension, von Zeit
zu Zeit die Einlieferung einer Arbeit zur Bedingung gemacht, und ich habe
sie immer pflichtmäßig und mit inniger Dankbarkeit erfüllt.
Wenn ich dieselbe Pflicht nun
gegen Euer Königliche Hoheit erfülle, und Höchstdieselbe um gnädigste
Annahme, und nachsichtsvolle Beurteilung, beifolgenden Gemäldes bitte,3
so geschieht es nicht ohne jenes unbegränzte Vertrauen, das jeden
Landesbewohner zu dem edeln Sohn Karl Friedrichs durchdringt; und nicht,
ohne von dem Gedanken bewegt zu seyn, daß es die vieljährige Treue Dienste
meines redlichen Vaters sind, welche S. K. Hoheit der hochseelige Grosherzog
durch Unterstützung meines geringen Talents zu ehren und zu belohnen
geruhten.
Ich verbleibe in tiefstem Respect,
Euer Königliche Hoheit
Karlsruhe den 4 Jenner
1819.
unterthänigste
Sophie
Reinhard,
Malerin.
1
Brief von Sophie Reinhard an Ludwig Großherzog von Baden (1763-1830), Regent
seit dem 8. Dezember 1818.
2
Karl Ludwig Großherzog von Baden (1786-1818), Regent seit dem 10. Juni 1811.
3
Pflichtbild für den Hof mit landesgeschichtlichem Bezug.
|
|
38
[GLA Karlsruhe 56 Nr. 382]1 [Karlsruhe, den 5. Januar 1819]
An
Mademoiselle Sophie Reinhard
in
Carlsruhe
Mit wahrem Vergnügen habe Ich das
von Ihrem schätzbaren Schreiben vom 4. d. M. begleitete Mir sehr
interessante Gemählde erhalten, wodurch Sie zugleich Ihre rühmliche
Vorliebe für die vaterländische Geschichte Ihr starkes Fortschreiten in
der Kunst bewähren und Mich zugleich zum verbindlichen Danke verpflichten.
Ich verbleibe mit besonderer
Achtung
Ihr
/eigenhändig/dienstwilliger
Carlsruhe
den 5. Jenner
1819.
1
Abschrift der Antwort von Ludwig Großherzog von Baden auf das Schreiben von
Sophie Reinhard vom 4. Januar 1819.
|
|
39
[Privatbesitz]1 Karlsr. d.
7 Merz
1820.
Verehrtester Herr Brönner,2
Sie haben mir zwar kein Wort,
Hebels Vorrede betreffend geschrieben,3 inzwischen muß ich
glauben, dass Sie Ihrem frühern Plan, welchen Sie in einem Brief vom 17 Mai
1819 Hr. Haldenwang4 mittheilten, getreu bleiben, zu den zehn
radierten Blätter, die 7 Gedichte druken, aus denen die Darstellungen
genommen sind, dazu die Vorrede, und ein schöner Umschlag, für den Preiß von
12 fl. geben werden. – Hier im Badischen befinden sich die Gedichte fast in
allen Händen, viele würden daher ungern noch Geld ausgeben, für diese 7
Gedichte, zu dem giebt es gar viele Menschen welche nur dann Freude an
Kunstwerken haben, wenn sie solche als Zimmer Verziehrung anwenden können,
also auch für dieße wären die 10 Blätter, ohne Zubehör annehmbarer, wie hoch
werden Sie das Exemplar ohne Druk und Umschlag verkauffen? Das Papier gab
Magdalener5 zu den Abdrüken, ich verlangte zwar meine Rechnung,
habe sie aber noch nicht erhalten, die hiesigen Künstler lassen sich auch
immer das Papier von Magdalener lieffern, und nennen ihn billig.
Gewiß bedurften Sie meines
zweiten Briefes nicht zu um zu sehn, dass ich weder (wie es Kaufleute
nennen) Geschäfte machen, noch Geschäftsbriefe schreiben kann! ich nehme Sie
daher dankbar beym Wort, und hoffe Sie werden sich meines Vortheils stets
erinnern. Leben Sie wohl, und andworten gefälligst
Ihrer
ergebenen Dienerin
Sophie Reinhard
Malerin.
1
Brief von Sophie Reinhard
„An Herrn
Buchhändler
Brönner,
in
Frankfurt“
2
Carl Heinrich Brönner (1789-1857), Buchhändler, Drucker und Verleger in
Frankfurt a. M.
3
Die Ausgabe der „Zehn Blätter nach Hebels Alemannischen Gedichten“, welche
1820 beim Verlag Mohr und Winter in Heidelberg erschien, enthielt als
Beilage ein Blatt mit dem Vorwort von Johann Peter Hebel (vergl. Adrian Braunbehrens (Hrsg.),
Sophie Reinhard, Zehn Blätter zu Hebels Alemannischen Gedichten,
Neuauflage, Heidelberg 1996).
4 Christian Haldenwang (1770-1831),
Kupferstecher aus Durlach, seit 1804 Hofkupferstecher in Karlsruhe.
5 Dabei dürfte es sich um den
Kupferdrucker Ignaz Magdalener (1761-1820) handeln, der 1808 Bürger von
Mannheim wurde (vergl. Helmut Tenner,
Mannheimer Kunstsammler und
Kunsthändler bis zur Mitte des neunzehnten Jahrhunderts,
Heidelberg 1966, S. 165). Ignaz Magdalener ist für Carl Ludwig Frommel,
Christian Haldenwang, Ferdinand Kobell, Carl Kuntz u. a. als Drucker ihrer
Werke nachweisbar.
|
|
40
[NL Uexküll,
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe]1 Karlsr. d. 2. August
1820.
Verehrter Freund,
Hierbey folgt ein Exemplar meines
Hebelschen Werks2
welches Sie zu freundschaftlichem Angedenken von mir annehmen werden. Sechs
weitere Exemplare kommen als Gefolge, ich hoffe Sie nehmen mirs nicht übel,
wenn ich Sie bitte dieße nach und nach abzusetzen, der Preiß ist so nieder
daß er wie ich hoffe von keiner grossen Unbequemlichkeit für Sie seyn wird,
ihnen Unterkunft zu verschaffen, sollte Ihnen aber dennoch der Auftrag zu
schwer werden, so denken Sie nur daß Sie eigentlich noch nie von mir geplagt
wurden, und es doch so oft verdient hätten.
Daß Sie sich gar nicht mehr sehn
lassen thut mir leid! Doch vergeht kein Tag wo ich nicht an die frohen Tage
in Rom dächte, und dabey erscheint auch immer der redliche geistreiche
Freund, und die Verewigte3
die ich nie vergessen werde!
Schreiben Sie mir ich bitte, wie
Sie leben, und auch etwaß aus der Künstler Welt, ich lebe auf einer
Sandbank, und wenn ich nicht gelernt hätte, auch ohne alle Aufmunterung zu
arbeiten so müsste ich vergehn! Dieß Jahr komme ich wieder nicht nach
Italien, nun hält mich das Merkantilische meines Werks fest, aber über Jahr
so Gott will ist Ihre Freundin jenseits der Alpen. – Leben Sie wohl, ich
verbleibe achtungsvoll
Ihre
ergebene
Sophie Reinhard.
1
Brief von Sophie Reinhard an Karl Friedrich Freiherr von Uexküll
(1755-1832).
2
Zehn Blätter nach Hebels Alemannischen Gedichten, Heidelberg Mohr und Winter
1820.
3
Elisabeth Freifrau von Uexküll geb. Hardegg (1771-1814), Gemahlin des Karl
Friedrich von Uexküll.
|
|
41
[GSA 28/88 Bl. 381f.,
Klassik Stiftung Weimar]1
[Karlsruhe,
14. August 1820]
Herr Geheimerath,
Indem ich eine Arbeit deren mangelhaftes ich
zum Theil wohl selbst kenne, dem ersten Kenner überreiche, gebe ich sie auch dem
wärmsten Freund der Kunst, welcher das gute Streben, und einiges nicht mißlungene zu würdigen weiß; dieser Glaube giebt mir Muth einen Wunsch in
Erfüllung zu bringen den ich schon lange lebhaft fühlte! Dem Manne auf den
ganz Deutschland stoltz ist, dessen Schriften über Kunst mir so weßentlich
nützten, einen Beweiß meiner hohen Achtung und meines Dankes geben zu
können.
Hebel ist mit meiner Arbeit zufrieden, findet
seine Oberländer, und sagt ich hätte ihn verstanden. Neun Jahre meiner Jugend
die ich unter diesem einfachen Volk verlebte machtens mir möglich eine
Arbeit zu unternehmen, die sehr viel reizendes für mich hatte, weil sie mich
beständig an frohe Tage erinnerte;2 die radier Nadel welche ich
bey dieser Gelegenheit zum erstelmahl in die Hand nahm erschwerte mir jedoch
Vieles, und um den Ausdruk meiner Köpfe nicht zu verliehren, verzichtete ich
auf weitere Ausführung.
Möchten Sie Herr Geheimerath, meine Arbeit, und
die Versicherung meiner unbegränzten Verehrung gütig aufnehmen.
Karlsruhe d. 14 August
1820
Sophie Reinhard.
1
Brief von Sophie Reinhard an Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) im
Goethe- und Schiller-Archiv, Weimar (abgedruckt in:
Katharina
Mommsen (Hrsg.), Die Entstehung von Goethes Werken in Dokumenten,
Band VII, Hackert - Indische Dichtungen, Berlin 2015, S. 117).
2 Den Dichter Johann
Peter Hebel (1760-1826) kannte die Künstlerin, seitdem sie mit ihren Eltern
und Geschwistern
1783 ins badische Oberland gezogen war, wo ihr Vater Maximilian
Reinhard in Lörrach bis 1792 Landschreiber und Hofrat am Oberamt Rötteln
war.
|
|
42
[NL Uexküll,
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe]1
Karlsr. d. 2. Jenner
1821
Geehrter Freund,
Ihre Lüster werden Sie nun haben,
das Kistchen war bereits gepakt als ich Ihr Billet an Weiß abschikte. Warum
Sie nichts von Beker2
hörten weiß ich nicht, ich spreche ihn nicht, man sieht ihn aber in allen
Gassen, die wohlbekannte Trägheit wird wohl die Ursache allein seyn warum er
nicht schreibt, der junge Beker3
wird gelobt, auch seine Predigten gefallen; die Tochter ist Braut, mit einem
gewissen Amtmann Eckstein, in Rastadt,4
zwar ein Wittwer, mit einem Kind, ein braver Mann, nicht ohne Vermögen.
H Frommel5
schikte ich Ihren Aufsaz6
bevor ich denselben geleßen, und erhielt beiliegende Antwort.7
Ich begreife wie man nach 6
Wöchentlichen Leiden, und in Ludwigsburg, von einem schönen Blatt wie dieses
ist, ergriffen wird, und mit völliger Überzeugung in ein vieleicht zu warmes
Lob gerathen kann, im ganzen ist diese Arbeit über Erwarten gelungen, doch
werden Sie wohl bey kälterem Beschauen sehn, daß mehr Duft, wie Luft, oder
Lust im Bild scher
herrscht, daß die Bäume, oder die Partien von den Aesten kleben, und daß
besonders der Hiert im Hintergrund sehr langer Gestalt also die Bäume
herunter drükt, Frommel kann keine Figuren machen; Bey dießem Gegenstand
konnte er auch wegen den Gebäuden ohnmöglich seine Bäume höher (vieleicht
sind sie kleiner) als sie in der Natur sind annehmen, wenigstens hätte er
dann seinen Horizont viel höher nehmen müssen. Dieß sey nur als Eingang
gesagt, − ich kann es gar wohl ertragen daß der Künstler, dessen gutes
Streben am Tage liegt, mehr gelobt wird als er erwarten darf, aber mir thut
es leid wenn ein alter verdienter Künstler wie Gmehlin8
erst ungerecht herab gesezt wird, um den lebenden um eine Stufe höher setzen
zu können, Sie verzeihn, aber ich halte es für meine Pflicht Sie hierauf
aufmerksam zu machen, wiewohl mein Gutachten kein von Ihnen verlangtes ist.
Damit Sie sehn daß mein Gefühl nicht bestochen sey, sondern nur die Liebe
zur Kunst mein Urtheil leite, muß ich Ihnen sagen, daß ich Frommel seit 16
Jahr kenne, und als Freund verehre, und in der Hinsicht würde Gmehlin by
mir, weit gegen Frommel zurükstehn, ich war 4 Jahr in Rom, durch den Bruder,
und Gmehlins besten Freunden auf das Wärmste empfohlen, Freunde, alle
deutsche kann ich sagen gaben mir die schönsten Beweiße von Freundschaft und
Wohlwollen, während ich auch nicht den kleinsten Dienst von Gmehlin anführen
konnte, als ich Abschied bey ihm nahm sagte er, „Sie wollen schon fort?“ ich
bin 4 Jahre hier – „waß 4 Jahre, und ich habe noch nichts für Sie gethan“ –
von der Seite sehn Sie bin ich nicht bestochen, Frommel könnte es seyn, denn
für ihn hatte G. manches gethan. Sie werfen unserm G. die Wasserfälle vor,
aber wenn Sie alle seine Blätter (Hauptblätter) zählen werden Sie nicht
läugnen, daß die wenigsten Wasserfälle enthalten, ich stimme Ihnen ganz bey,
und bin auch nicht für Gegenstände der Art, aber solange die Landschaft als
ein eigener Theil der Kunst angesehn wird, waß sie in den goldenen Zeiten
nie war, so lange werden Wasserfälle mit und ohne Pinsel erscheinen, wissen
wir ob Fr. nicht auch einen ähnlichen Gegenstand gewählt hätte, wenn er wie
G. der Sache gewachsen wäre? sehn Sie G.lins Mare Morto9
an, wie frisch wie
die Conture da ist nichts heraus geschliffen, wie luftig die Bäume, da ist
keine andere als seine eigene Kunst, nicht die des Deutens, und nachhelfens
mit schwächerer oder stärkerer Farbe zu finden! – Vieleicht könnte F. einst
G. ersetzen, vieleicht werden einst keine Veduten mehr gemacht, gewiß nicht
so bald die Reichen lieber so viel Louisd’ors
für ein Kunstwerk geben, als nun Bajochi, G. hat dießes Unweßen unserer Zeit
nicht unterstüzt, und alle ausser Kaisermann10
sind unschuldig daran, viele drängt nur die Noth sich nach einem reichen
Plebs zu richten. Lassen wir also unserem G. gebührende Ehre wiederfahrn, er
hat seinem Vaterland Ehre gemacht, und an uns sey es nicht, ihn der kaum
kalt ist11
um wohlverdienten Nachruhm zu bringen; lebte er noch ich würde schweigen,
aber nun hielt ich es für meine Pflicht den alten verehrten Freund
aufmerksam zu machen, ich darf mein Urtheil vor jedes Kunst Tribunal
bringen, man wird mir beistimmen, − Sie werden es auch nicht verwerfen,
Wächter12
gewiß nicht, und dieser ist in meinen Augen der erste deutsche Künstler, ich
bin einmahl am zanken, also muß ich Ihnen auch sagen, daß ich es schwer
ertragen kann wenn Sie Hetsch13
und Wächter so nahe beisammen nennen, jeder könnte sich mit Recht
beschweren, Thowalsen14
hat sich nicht geringen Schaden gethan, dadurch daß er W. nicht besuchte,
Raphael und M.angelo, hätten bey ihm eingekehrt, doch muß man wissen waß
vieleicht dahinter stekt, ob der Jesuit S.15
nicht gesagt habe, man könne W. nicht sprechen? denn sein Christus (den ich
zwar nicht sah) könnte wohl doch neben W. tief gefühlten Compo. verlohren
haben, – aber wer so denkt, der kann so wenig einen Kristus machen, als eine
Gans ein Straußen Ey ausbrüthen!
Ich bin bösmauligt, werden Sie
sagen, wir sind es beyde – jedoch wünsche ich Ihnen ein gutes neues Jahr,
und daß Sie immer muthig manches harte ertragen, da Sie doch in Ihrem
Schiksal für alles Entschädigung finden, wenn Sie auch hierin gerecht
urtheilen wollen.
Auch ich müste wissen wo die
Winterschen Bilder16
herstammen, ob sie nicht by Liesching17
waren? Das Portrait von Merian,18
der uns die Topographie gab, werden Sie vieleicht etwaß erkennen? auch ein
schönes Bild die Jefta19
vorstellend ißt dabey.
Leben Sie wohl und schreiben bald
S.
1
Brief von Sophie Reinhard an Karl Friedrich Freiherr von Uexküll (1755-1832)
aus dessen Nachlass in der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe.
2
Philipp Jakob Becker (1759-1829), seit 1784 Hofmaler und Galeriedirektor in
Karlsruhe.
3
Franz Becker (1798-1857), Sohn des Philipp Jakob Becker, seit 1821
Hofprediger in Donaueschingen.
4
Amtmann Eckstein in Rastatt heiratete Beckers Tochter Marie (laut Karl
Obser, Galeriedirektor Philipp Jakob Becker und sein künstlerischer
Nachlaß, in: Oberrheinische Kunst, Bd. 8, 1939, S. 171, starb sie am 7.
Juli 1832).
5
Carl Ludwig Frommel (1789-1863),
von 1805 bis
1809 Schüler von Philipp Becker und Hofkupferstecher Christian Haldenwang,
weilte von 1813 bis 1817 in Italien (Gerda Kircher, Vedute und
Ideallandschaft in Baden und der Schweiz : 1750-1850, Heidelberger
Kunstgeschichtliche Abhandlungen, 8, 1928, S. 22).
6
Im Nachlass Uexküll befindet sich unter Abt. D, Nr. 6 ein Text Uexkülls über
„C. Frommels Blatt Lariccia in ein Schreiben eingekleidet“, am Schluss 12.
Dezember 1820 datiert. Dabei handelt es sich wohl um den erwähnten Aufsatz
über Frommels Radierung „Ariccia“, über den Sophie Reinhard nachfolgend
schreibt (vergl. Rudolf Theilmann,
Carl Ludwig Frommel 1789-1863. Zum 200. Geburtstag,
Ausst.-Kat. Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, Karlsruhe 1989, Kat.-Nr. 77).
Die Entwurfszeichnung für Frommels Radierung war schon auf der
Kunstausstellung 1818 in Karlsruhe zu sehen und einen aquarellierten Stich
zeigte Frommel auf der Karlsruher Ausstellung von 1821.
7
Frommels Antwort liegt nicht bei.
8
Wilhelm Friedrich Gmelin (1760-1820), Kupferstecher aus Badenweiler, lebte
seit 1787 mit Unterbrechungen in Rom.
9
Mare Morto bei Neapel, 1798 (vergl.
Stefan Borchardt,
Wilhelm Friedrich Gmelin, Veduten und
Ideallandschaften der Goethezeit,
Ausst.-Kat. Kunstmuseum Hohenkarpfen 2010, Kat.-Nr. 122 und Abb. S. 65).
10
Franz Kaisermann (1765-1833), Maler aus Yverdon in der französischen
Schweiz, lebte seit 1789 in Rom.
11
Wilhelm Friedrich Gmelin war am 22. September 1820 in Rom gestorben.
12
Aus Briefen von Joseph Anton Koch, der 1795 nach Rom gekommen und dort mit
Wächter zusammengetroffen war, an Uexküll spricht ebenfalls eine hohe
Begeisterung für Werk und Persönlichkeit Wächters (vergl. Paul Köster,
Eberhard Wächter (1762-1852), Ein
Maler des deutschen Klassizismus,
Diss. Bonn, 1968, S. 57). Eberhard von Wächter war seit 1810 Kustos der
Kupferstichsammlung in Stuttgart.
13
Philipp Friedrich von Hetsch (1788-1864), Maler aus Stuttgart, seit 1798
Direktor der herzoglichen Gemäldegalerie in Ludwigsburg.
14
Bertel Thorvaldsen (1770-1844), Bildhauer aus Kopenhagen, lebte seit 1797 in
Rom.
15
Jesuit S., nicht ermittelt.
16
Bei den
Winter’schen Bildern könnte es sich um Arbeiten des Nürnberger
Kupferstechers und Zeichners Johann Wilhelm Windter (um 1696-1765) handeln.
17
Wohl Samuel Gottlieb Liesching (1786-1864), Verleger und Buchhändler in
Stuttgart.
18
Portrait des Matthäus Merian d. Ä. (1593-1650).
19
Bei dem
Bild der Jefta könnte es sich um die Tochter des Heerführers Jephta aus dem
Alten Testament handeln. Jephta
gelobte Jahwe, im Falle eines Sieges über die Ammoniter, das erste Lebewesen
zu opfern, das über seine Schwelle treten würde. Es war seine einzige
Tochter Iphis. Diesen tragischen Stoff vertonte Georg Friedrich Händel in
einem Oratorium und
der Dichter Aloys Schreiber (1761-1841), mit dem Sophie Reinhard bekannt
war, hat den Text zur Oper „Jephtas Gelübde“ gedichtet, die von Giacomo
Meyerbeer vertont wurde.
|
|

„ARICCIA bey ROM/Seiner Königlichen Hoheit dem Grossherzog Ludwig zu Baden“,
Radierung von Carl Ludwig Frommel, um 1820 (Bildnachweis: E. Fecker). Die Vorzeichnung zeigte Carl Ludwig
Frommel auf der ersten Ausstellung des Badischen Kunstvereins in Karlsruhe im
Jahre 1818 (GLA 69 Badischer Kunstverein/1: Ariccia, Eigentum des Künstlers)
|
|
43
[NL Uexküll,
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe]1 Kr. d. 3. Februar
1821
Verehrter Freund,
Wenn ich Sie recht verstehe, so
haben Sie alles oeffentliche Lob wegen F.2
Blatt aufgegeben, das thut mir leyd! denn ich sehe mich auch ungern als die
Ursache eines unterlassenen Lobs meiner Freunde an. F–l kann zwar (dieß sei
zu seiner Ehre gesagt) belen er wußte daß Sie Ihren Aufsatz zurük genommen
hatten, zu mir, und sprach von dieser Schrift, als einer Sache die, weil sie
ihn zu hoch erhebe, wohl unangenehme Folgen für ihn haben könnte, und
wünschte daß wenigstens Vergleichungen unterbleiben möchten. Mir scheint es
auffallend, daß Gmelin3
Haldenwang4
und Frommel im Badischen geboren, und zwar alle drei das Licht der Welt
erblikten in einem Bezirk der kaum 25 Stund mißt, kaum entgeht der erste der
Kunst, so erscheint das erste Werk deß jüngsten der vieleicht G. ersetzen
wird, könnten Sie, dem alles so fließend von der Zunge rießelt nicht hievon
Anlaß nehmen etwaß neues zu sagen an waß vieleicht noch wenige dachten dabey
Frommels Blatt ehrenvoll zu schildern, Ihre Ansichten über Kunst überhaupt
beifügen und witzig sägen ohne zu stechen? versuchen Sie es, Sie können auch
anführen daß Haldenwang demnächstens große Arbeiten nach Claude5
anfangen werde etc. etc. – daß Gmehlin aus dem Mare morto6
ein schöneres Bild liefferte als es in der Natur zu sehn ist, gereicht ihm
zur Ehre, Sie müssen wissen daß der Punkt den Frommel bey Arriccia
angenommen hat,
−
nirgends existiert, daß sagte er mir ohne von unseren Discusionen etwaß zu
ahnden! Könnte ich nur Wächters7
jüngste Arbeiten sehn! gerne überlasse ich Ihnen die Kupferstiche; schon
lange gehe ich mit dem Plan um, auf 8 Tage nach Stutgard zu reisen
hauptsächlich wegen Wächter aber es ist weit, und für ein Frauenzimmer
gleich mit Umständen, und Kosten verbunden.
Ihre Lüster Geschäfte besorgte
ich gleich, und da Sie auch gerne etwaß neues hören sage ich Ihnen daß die
hei
Heirath mit Bekers Tochter,8
wieder rükgängig wurde, warum, weiß ich nicht, wills auch nicht gesagt
haben.
Nun kommt bald der Frühling, und
mit ihm das Mädchen aus der Fremde (das sind Sie) worauf ich mich recht
freue. Müllers Augenkrankheit9
hat mich erschrekt, denn auf einem Aug ist er, wie Sie wissen längst blind
mit dem andern sieht er so wenig, daß er zweimahl bey mir, als ich im Palast
Albano wohnte, wo er die Thürme wie im Karlsr. Hofthor sind, zum Fenster
hinaus wollte, dabey hat er die Schwachheit daß er die beste Augen haben
will, ich konnte aber doch mit dem besten Willen nicht anderst als die
Flügel oeffnen waß ihn in grosse Verlegenheit brachte, er sollte Ihr
Hausgenosse seyn, mit niemand unterhielten Sie sich so gut als mit Müller,
und nach 4 Jahren in welchen ich Müller oft sah, lange seine Nachbarin war,
habe ich nie finden können, daß seyn Herz bös sey, er ist wie die Biene
die nur sticht, wenn sie beleidigt wird, oder auch aus Angst, sie könnten
Ihre, und seine Tage verschönern, wie gerne hörte ich in Rom dem oft bös
mauligten, aber immer geistreichen Gespräch von Ihnen, und Müller zu! – ich
bin fruchtbar an Vorschlägen, werden Sie sagen, aber alles kommt aus gutem
Herzen*
*Darum werden Sie verzeihn Ihrer
ergebensten S. Reinhard
1
Brief von Sophie Reinhard
„An
Herrn Baron
von Ixkill
den Aelteren
in
Ludwigsburg“
aus dessen Nachlass in der
Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe.
2
Carl Ludwig Frommel (1789-1863), Maler und Kupferstecher aus dem
linksrheinischen, ehemals badischen Birkenfeld. Vergleiche den Brief von
Sophie Reinhard an Freiherr von Uexküll vom 2. Januar 1821 mit der Kritik an
Frommels Radierung „Ariccia“.
3
Wilhelm Friedrich Gmelin (1760-1820), Kupferstecher aus Badenweiler, lebte
seit 1787 mit Unterbrechungen in Rom.
4
Christian Haldenwang (1770-1831), Kupferstecher aus Durlach, seit 1804
Hofkupferstecher in Karlsruhe.
5
Claude Lorrain
(1600-1682), französischer Landschaftsmaler, der etwa ab 1630 bis zu seinem
Tode in Rom lebte.
6
Mare Morto bei Neapel, 1798 (vergl.
Stefan Borchardt,
Wilhelm Friedrich Gmelin, Veduten und
Ideallandschaften der Goethezeit,
Ausst.-Kat. Kunstmuseum Hohenkarpfen 2010, Kat.-Nr. 122 und Abb. S. 65).
7
In jener Zeit malte Eberhard von Wächter (1762-1852) das Gemälde „Kahn des
Lebens“, welches im Juni 1820 im Kunstblatt eingehend gewürdigt wurde
(vergl. Paul Köster, Eberhard Wächter
(1762-1852), Ein Maler des deutschen Klassizismus,
Diss. Bonn, 1968, S. 165ff.).
8
Betrifft die Heirat der Marie Becker, Tochter des Galeriedirektors Philipp
Jakob Becker, mit dem Amtmann Eckstein in Rastatt.
9
Friedrich Müller (1749-1825), Maler und Dichter, lebte seit 1778 in Rom.
|
|
44
[NL Uexküll,
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe]1 [Karlsruhe] d. 10. Merz.
1821
Diesesmahl ließ ich Sie lange
warten, aber ich werde so oft von der Arbeit geruffen, und damit sich die
verlohrene Zeit wieder ausgleiche nehme ich die zum Schreiben bestimmte oft
dazu. Wächters2
Brief hebe ich auf biß Sie ihn abholen. Frommel3
kann Ihnen vor einigen Monat keinen probe Druck geben. Von der Gräfin Berboldingen4
bin ich wiederholt auf einige Wochen eingeladen also wegen einer Unterkunft
der Art
hätten Sie nicht zu sorgen, inzwischen läuft es gegen meine Grundsätze
anderstwo als im Gasthof zu bleiben, ich achte die Berolding sehr aber nur
selten findet sich ein Quartier bey Freunden wo man nicht auf mancherlei Art
gebunden wäre, bey Ihnen wäre mirs angenehm, aber Sie sind so heilos
verschriehn daß ich selbst jezt, wo ich alt bin nicht Ihr Gast seyn dürfte!!
doch unter Gottes freiem Himmel wage ich es mit dem schuldlos verschrienen
Freund eine Reise von Pf. nach St.5
zu unternehmen kommt Zeit kommt Rath.
Ein Freund sendete mir ein Buch
mit folgendem Titel, Ansichten über die bildenden Künste, und Darstellung
des ganzen derselben in Toscanax
X. X. Heidelberg bey Oswald.
x von einem deutschen Künstler in
Rom.
Wenn Sie dieses Buch nicht gelesen haben so
empfehle ich es Ihnen, einen wahren (den ersten Genuß) gewährte es mir,
unter allen mir bekannten Kunstbücher! seine Verbreitung und beherzigung
könnte den schönsten Nutzen bringen, wenigstens das überhand nehmende
Kunstgespräch in Deutschland ordnen, und zum vernünftigen umschaffen, hiebey
darf ich mich abermahl auf Meister Wächter beruffen der diesem Werk gewiß
Beifall giebt. Sollten Sie zu geizig seyn sichs anzuschaffen, so erbiethe
mich Ihnen dasselbe durch die Post, aber non francato, auf 8 Tage zu
senden? Vieleicht können Sie den Verfasser ausfindig machen,6 den
ich gar zu gerne kennen möchte, altro che Göthex!
Leben Sie recht wohl und
schreiben Ihrer Sie Verehrenden
S. Reinhard
x
über Kunst, N. B.
1
Brief von Sophie Reinhard an Karl Friedrich Freiherr von Uexküll (1755-1832)
aus dessen Nachlass in der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe.
2
Eberhard von Wächter (1762-1852), Historienmaler aus Balingen. War seit 1810
Kustos der Kupferstichsammlung in Stuttgart.
3
Carl Ludwig Frommel (1789-1863), Maler und Kupferstecher aus dem
linksrheinischen ehemals badischen Birkenfeld, Schüler von Philipp Becker
und Hofkupferstecher Christian Haldenwang, weilte von 1813 bis 1817 in
Italien.
4
In Stuttgart waren die Familien der Grafen von Beroldingen für ihre
Gastfreundschaft und Kunstbeflissenheit bekannt. Ihre Schwester Isabella
Gräfin von Beroldingen, hatte Sophie Reinhard 1809 in Wien kennengelernt.
Ein Besuch bei den Beroldingen könnte 1840 stattgefunden haben, denn der
Kunstsammler Sulpiz Boisserée vermerkt in seinem Tagebuch am Mittwoch den
30. September einen Besuch bei Beroldingen und trifft an diesem Tag auch
Sophie Reinhard in Berg, einem Stadtteil von Stuttgart (vergl. Hans-Joachim
Weitz, Sulpiz Boisserée,
Tagebücher 1808-1854,
Bd. 3, Darmstadt 1983, S. 649).
5
Könnte die Abkürzung für Pforzheim nach Stuttgart sein.
6
Ansichten über die bildenden Künste
und Darstellung des Ganges derselben in Toscana; zur Bestimmung des
Gesichtspunctes, aus welchem die neudeutsche Malerschule zu betrachten ist.
Von einem deutschen Künstler in Rom
[i.e. Johann David Passavant], Heidelberg & Speier, Oswald, 1820.
|
|
45
[NL Uexküll,
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe]1 K. d. 24. Merz
1821
Erst den 22. dieses erhielte ich
Ihr schreiben durch Hr. F.2
sonst hätten Sie bereits das angebothene Buch3
schon erhalten. Ich weiß wohl daß er nicht immer geizig, wohl aber
vernünftig darf genannt werden wenn man nicht auf jede Empfehlung hin, ein
Buch kauft, doch glaube ich ohne Eigenliebe von mir auch sagen zu können
daß, waß Bildende Kunst ist, ich nicht ganz für die Hunde bin! – genug Sie
werden lesen, und wenn Sie wollen so geben Sie es auch M. Wächter,4
Sie können 14 und mehr Tag es behalten, hier liest doch ausser mir niemand
so etwaß mit Interresse, eine Abhandlung über einen Morast, oder Ochsenhorn
würde hier weit mehr Leser finden. – Wegen des Briefwechsels über Kunst
werde mit F. sprechen. – Ich angle schon lange nach Müllers5
Tiber Fischerei; konnte aber bisher dieß Blatt nicht bekommen!
Fahren Sie ferner fort, und
bereun in Dehmuth Ihre Sünden, so werden sich die Engelein im Himmel freun,
nebst Ihrer Freundin
S.R.
1
Brief von Sophie Reinhard an Karl Friedrich Freiherr von Uexküll (1755-1832)
aus dessen Nachlass in der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe.
2
Vielleicht Abkürzung für Frommel.
3
Vergleiche Brief der Künstlerin vom 10. März 1821 an Karl Friedrich Freiherr
von Uexküll.
4
Eberhard von Wächter (1762-1852), Historienmaler aus Balingen. Wächter war seit 1810
Kustos der Kupferstichsammlung in Stuttgart.
5
Friedrich Müller (1749-1825), Maler, Radierer und Dichter, lebte seit 1778
in Rom.
|
|
46
[GLA Karlsruhe 56 Nr.
1570]1
[Karlsruhe, den 24. Juni 1823]
Großherzogliches Hochpreißliches
Ober Marschallamt,
Auf die verehrliche Verfügung vom
12ten dießes, habe ich die Ehre, gehorsamst zu erwiedern,
daß ich zu Erfüllung jener alternativen Verbindlichkeit, die mir bey der
gnädigsten Bewilligung einer Besoldung auferlegt worden, irgend eine
Aufforderung durchaus nicht abgewartet, sondern vom ersten Augenblik an, und
meines Wissens beynahe ausnahmweise, solcher bestens nachzukommen, mich
aufrichtig bestrebt habe; das Gegentheil wäre mit meiner Pflicht ebenso
unvereinbar gewesen, als mit meinem Dankgefühl, gegen den Höchsten Verleiher
dießer Unterstützung, und Aufmunterung meines Kunsttalents.
In dessen Gemäßheit habe ich
unterthänigst überreicht,
des Großherzogs Karl Königliche
Hoheit2
Elisabeth und Johannes,
die sterbende Catharina von
Siena,
der Traum von Margraf Karl
Wilhelm, oder die Erbauung von Karlsruhe.
Des regierenden Großherzogs
Königliche Hoheit3
die heilige Cecilie,
zehn radirte, von mir componierte
Blätter zu Hebels Allemannischen Gedichten,
das Fest bey Aufhebung der
Leibeigenschaft,
und die Margräfin Anna, wie sie
Gaaben unter Arme und Kranke spendet, wartet zu gleicher Bestimmung
lediglich auf gehörige Empfänglichkeit für den Oelfirniß.
Die Huldreiche Handschreiben,
welche ich zu besitzen das Glück habe, verschaffen mir die Beruhigung daß
ich den Höchsten Intentionen, und Erwartungen nicht entgegen gehandelt habe,
ich wurde in Sonderheit von des Großherzo[g]s Karl Königl Hoheit, auf die
fernere Bearbeitung vaterländischer Geschichte aufmerksam gemacht, Ihro
Königliche Hoheit der Grosherzog Ludwig nehmen ebenfalls besonderes Interresse an Gegenständen, welche aus der Geschichte Ihres hohen Hauses
genommen sind, dieße Aufgabe jedoch, so wie überhaupt die Historienmahlerey
erfordert längeres Nachforschen, und anhaltendes Studium der zerstreuten
Nachrichten welche man aus gar verschiedenen Quellen schöpfen muß, auch
bedarf der Künstler schon deswegen einiger Nachsicht, weil er nur durch
wiederholte Bearbeitung seines Stoffs zur Hervorbringung eines würdigen
Kunstwerks gelangen kann.
So lange mir Gott die Kräfte
verleiht werde ich mir auch ferner die genaue Erfüllung meiner Pflicht zur
ernstlichen und freudigen Angelegenheit machen
Karlsruhe den 24 Juny
1823
Sophie Reinhard
1
Brief von Sophie Reinhard:
„An
Ein
Hochlöblich OberHof Marschall=
Amt
Dahier“
2
Karl Ludwig Großherzog von Baden (1786-1818), Regent seit dem 10. Juni 1811.
3
Ludwig Großherzog von Baden (1763-1830), Regent seit dem 8. Dezember 1818.
|
|
47
[NL Adam, StA München Nr.
104]1 Karlsr. d. 28. Merz
1827.
Lieber Adam,
Innig freute ich mich wieder
einmahl einen Brief von Ihnen zu erhalten. Ihren Freund Hermann2
frug ich über alles waß Sie betrieft, und glaube nun so zimlich zu wissen,
daß es Ihnen wie allen geht, nehmlich man wandelt nicht immer auf Rosen, die
Dornen sind jedem auch zugegeben. Herr v. Hermann der den eigentlichen Zweck
seiner Reise lebhaft verfolgt sah ich nicht so oft, als die liebe Familie,
die mir dann das mangelnde ergänzte, ein liebes gescheites Mädchen, die mir
ausnehmend wohl gefiel. – Vor 4 Monat verlohr ich meine gute unvergeßliche
Mutter,3 und dadurch wurde meine Gesundheit die 2 ½ Jahr schlecht
war, aber wieder besser ging, abermahl erschüttert, doch befinde ich mich
nun so ziemlich. Im Grunde geht es mir gut, das heißt ich habe hinlängliches
Einkommen, meine bescheidenen Wünsche zu befriedigen, habe einige gute
Freunde, und mein bischen Kunst, dies alles wäre genug um glücklich zu seyn,
aber so vieles von aussen waß trübt, daß meine große Dosis Frohsinn sehr
schnell zugeschnitten hat! nun kommen die Jahre die schon dem weisen Salamon
nicht gefallen wollten, und oft bemerke ich, /waß Jahre nicht der Fall war/
nehmlich daß ich allein stehe, es ist aus und vorbey, nur auf dem May
den uns die Natur vorgezeichnet hat ist wahres Glück zu finden, nehmlich in
den Kindern, wer die hat, der wird nie ohne Genuß seyn, und ließe man mir
die Wahl, ob ich, Michel Angelo an Geschiklichkeit, oder Mutter einiger
Kinder seyn wollte, so würde ich das lezte wählen, doch eines ist so
unmöglich wie das andere, und somit sterbe ich als alte Jungfer!
Das Heft welches Hermann von
Ihrem russischen Feldzug bey sich hatte, gefiel mir sehr, ich glaube es wird
gut abgehn, Ihr Freund giebt sich viel Mühe, doch glaube ich die meisten
Subscribenten werden sich in Frankr. finden.4
Die Bianca Milesi5 ist
in Genua glücklich geheirathet seit 2 Jahr, und Mutter eines Sohns. Vor 2 ½
Jahr war sie auch bey mir hier, und zwar 4 Wochen, nebst ihrer Mutter.
Ich hoffe lieber Freund, Sie
werden mir wieder schreiben und da sagen Sie mir doch auch ob Cornelius
glücklich ist? ich hörte verschiedenes, auch soll seine Frau sehr krank
gewesen seyn, Herrmann, wusste wenig von Cornelius.6
Frommel ist seit einem Jahr
wieder geheirathet, und recht glücklich.7 Huber8 war
vor 2 Jahr auch hier mit seiner gar lieben anspruchlosen reichen Frau. Wenn
Sie mir andworten sollten /gewiß verlasse ich mich nicht darauf/ so
schreiben Sie mir wie es der guten Emilie geht? sie scheint etwaß
schwächlich. Nun leben Sie wohl mit Ihren 9 Trabanten9 das
heilige Sacrament der Taufe wünschte ich aus Ihrer Haus Tafel gestrichen zu
wissen. Adieu, Mangnifique und Sulima10 hängen immer in meinem
Arbeitszimmer neben Michel Angelo. Adämle Adämle wie glücklich waren wir,
als Sie zu der Geiger11 und mir kamen, tempi passati
unverändert
die Ihrige Sophie Reinhard
wohnt im grossen Zirkel12
1
Brief von Sophie Reinhard an
„Herrn
Albrecht Adam, berühmten
Mahler
München
abzugeben mit Brief
von Herrmann u Barth.“
aus dem Nachlass des Malers im
Stadtarchiv München.
2
Inhaber und Geschäftsführer des Münchner Verlages Hermann & Barth.
3
Laut Eintrag im Standesbuch der evangelischen Gemeinde von Karlsruhe starb
die Witwe Jacobina Margaretha Reinhard geb. Pasterts am 27. Oktober 1826 im
Alter von vierundsiebzig Jahren drei Monaten und vierzehn Tagen.
4
Voyage pittoresque et militaire de Willenberg en Prusse jusqu`à Moscou fait
en 1812 pris sur le terrain même, lithographié par Albert Adam.
Verlag Hermann & Barth, München
1827 (vergl. Albrecht Adam und seine Familie. Zur Geschichte einer Münchner
Künstlerdynastie im 19. u. 20. Jh., Ausst.-Kat. Münchner Stadtmuseum 1981,
hrsg. Ulrike von Hase-Schmundt, München 1981, Katalog Nr. 411, S. 371).
5
Bianca Milesi (1790-1849), befreundete Malerin und Schriftstellerin aus Mailand.
Laut Émile
Souvestre, Blanche Milesi-Mojon. Notice biographique, Angers 1854,
Seite 60, heiratete sie am 24. Januar 1825 den Arzt Benedetto Mojon
(1781-1849). Als Geburtsjahr von Benedetto Mojon wird vielfach 1784 angegeben
(vergl. F. de Lansac (Hrsg.),
Encyclopédie
biographique
du XIXe siècle, Médecins célèbres, Paris 1845, S.241),
was laut Pietro Berri (Il
dottor Benedetto Mojon, Giornale storico e letterario della Liguria,
Anno XVIII, 1942, S. 104) nicht zutreffend ist.
Nach seinen Ausführungen wurde er am 16.
Mai
1801 mit einer „Dissertazione sull’utilità della musica tanto nello stato
di sanità che in quello di malattia.“ promoviert.
Wäre Mojon 1784 geboren, wäre er schon mit 17 Jahren zur Promotion
zugelassen worden. In den
folgenden Jahren machte Benedetto Mojon mit weiteren außergewöhnlichen
Untersuchungen auf sich aufmerksam, u. a. mit „Mémoire
sur les effets de la castration dans le corps humain“
(1804) und einem Buch mit dem Titel „Leggi fisiologiche“ (1806),
welches nach der 1821 erschienenen Ausgabe von Papst Pius VII. auf den
Index librorum prohibitorum gesetzt wurde.
6
Peter von Cornelius (1783-1867), arbeitete zu dieser Zeit an den Fresken in
der Glyptothek in München.
7
Carl Ludwig Frommel (1789-1863), war wie Sophie Reinhard Schüler von
Galeriedirektor Philipp Jakob Becker. Er war seit 1826 in zweiter Ehe mit
Johanna Henriette Gambs verheiratet (vergl. Carl Ludwig Frommel
1789-1863, Zum 200. Geburtstag, Ausst.-Kat. Staatliche Kunsthalle
Karlsruhe 1989, S. 17).
8
Jakob Wilhelm Huber (1787-1871), befreundeter Maler aus Zürich.
9
Albrecht Adam heiratete 1811 Magdalena Sander mit der er bis dahin neun
Kinder hatte.
10
Magnifique und Sulima, wohl eine Zeichnung oder ein Gemälde von Albrecht
Adam.
11
Margarete Geiger (1783-1809), befreundete Malerin aus Schweinfurt.
12
Großer Zirkel = kreisförmiger Weg bzw. Straße mit dem Karlsruher Schloss als
Mittelpunkt.
|
|
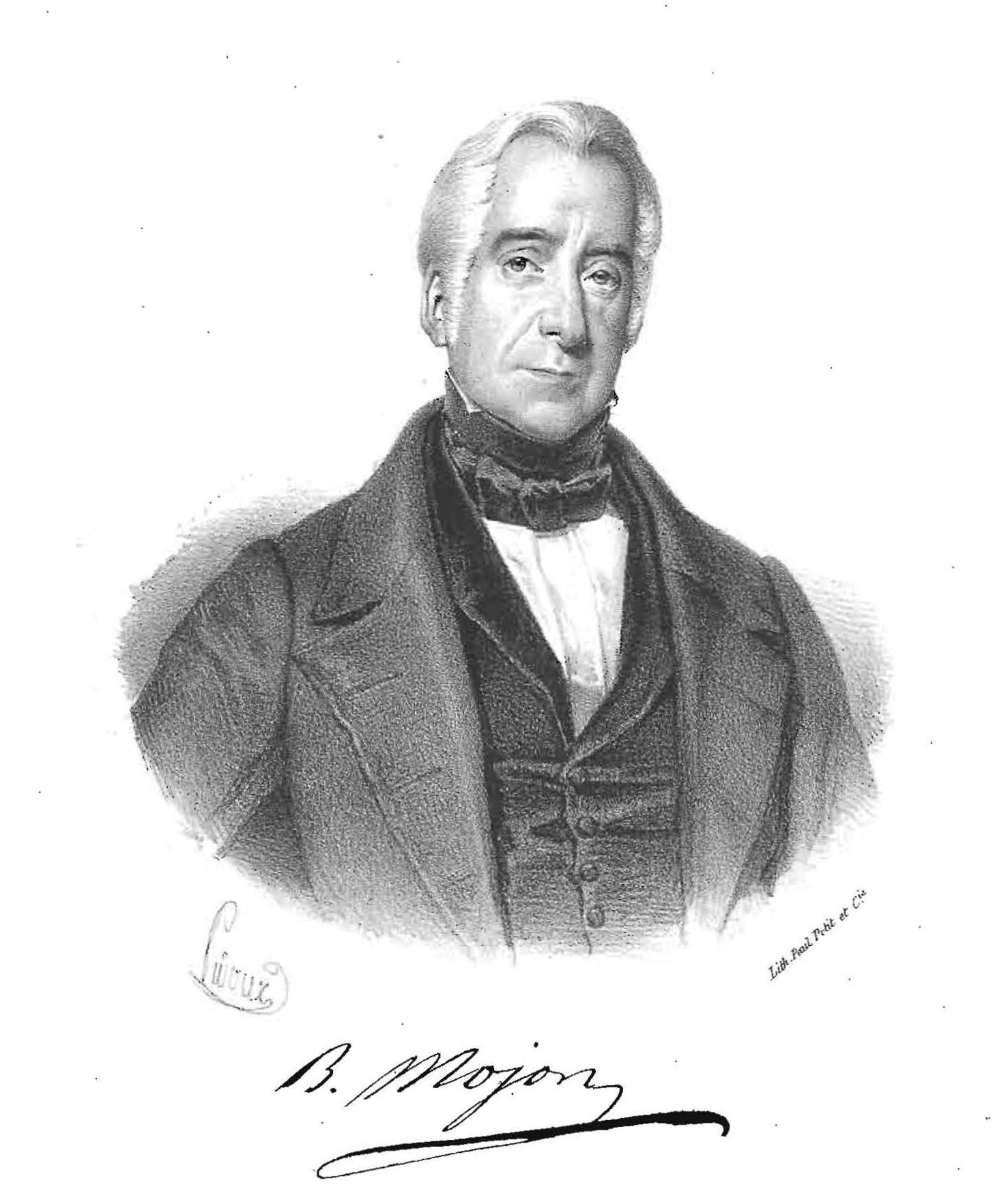
Brustbild des
Arztes Benedetto Mojon (1781-1849), Ehemann der Malerin und Schriftstellerin
Bianca Milesi.
Gezeichnet von
Auguste Pidoux und
lithographiert bei Paul Petit et Cie.
Aus: Encyclopédie biographique
du XIXe siècle, Médecins célèbres, Paris 1845
(Bildnachweis: E. Fecker)
|
|
48
[GLA Karlsruhe 390 Nr. 1945]1
[Karlsruhe, den 17. Dezember 1844]
Nr. 364. Den siebenzehenten
Dezember Nachts neun Uhr starb und wurde den zwanzigsten früh neun Uhr
beerdigt Sophie Karoline Friederike Petronella Reinhard, Malerin, ledige
Tochter des weil. Staatsraths Reinhard2 u. der Jacobina geb.
Pasterts,3 gebürtig von Kirchberg, alt neun und sechzig Jahre
sechs Monate. Zeugen Karl Manz,4 Stallmeister; Gottlieb Eisenlohr5
Kassier
T. Deimling
1
Eintrag im Standesbuch der evangelischen Kirchengemeinde Karlsruhe 1844
2
Maximilian Wilhelm Reinhard (1748-1812), Vater der Künstlerin.
3
Der Familienname der Mutter, hier Pasterts geschrieben, kommt auch als
Pastertin vor und würde heute wohl Pastert geschrieben.
4
Karl Manz, Stallmeister.
5
Engelhard Gottlieb Eisenlohr (1780-1862), war seit 1815 Generalkassier der
Witwen- und Brandkasse in Karlsruhe (vergl. Karl von Wechmar, Handbuch
für Baden und seine Diener, Heidelberg 1846, S. 198). Sein Bruder, der
Hofgerichtspräsident Christoph Jakob Eisenlohr (1775-1852), war seit dem 18.
Juni 1804 mit Caroline Reinhard, der Schwester von Sophie Reinhard,
verheiratet. Aus dieser Ehe gingen die Kinder Otto und Max hervor (vergl.
Bernd Breitkopf, Die alten Landkreise und ihre Amtsvorsteher,
Beiträge zur Geschichte des Landkreises Karlsruhe, Bd. 1, Ubstadt-Weiher,
1997, S. 110f.).
|
|
49 [BLB
Karlsruhe, Sig. Ze 005 00]1
Karlsruhe, den 23. Juli 1846
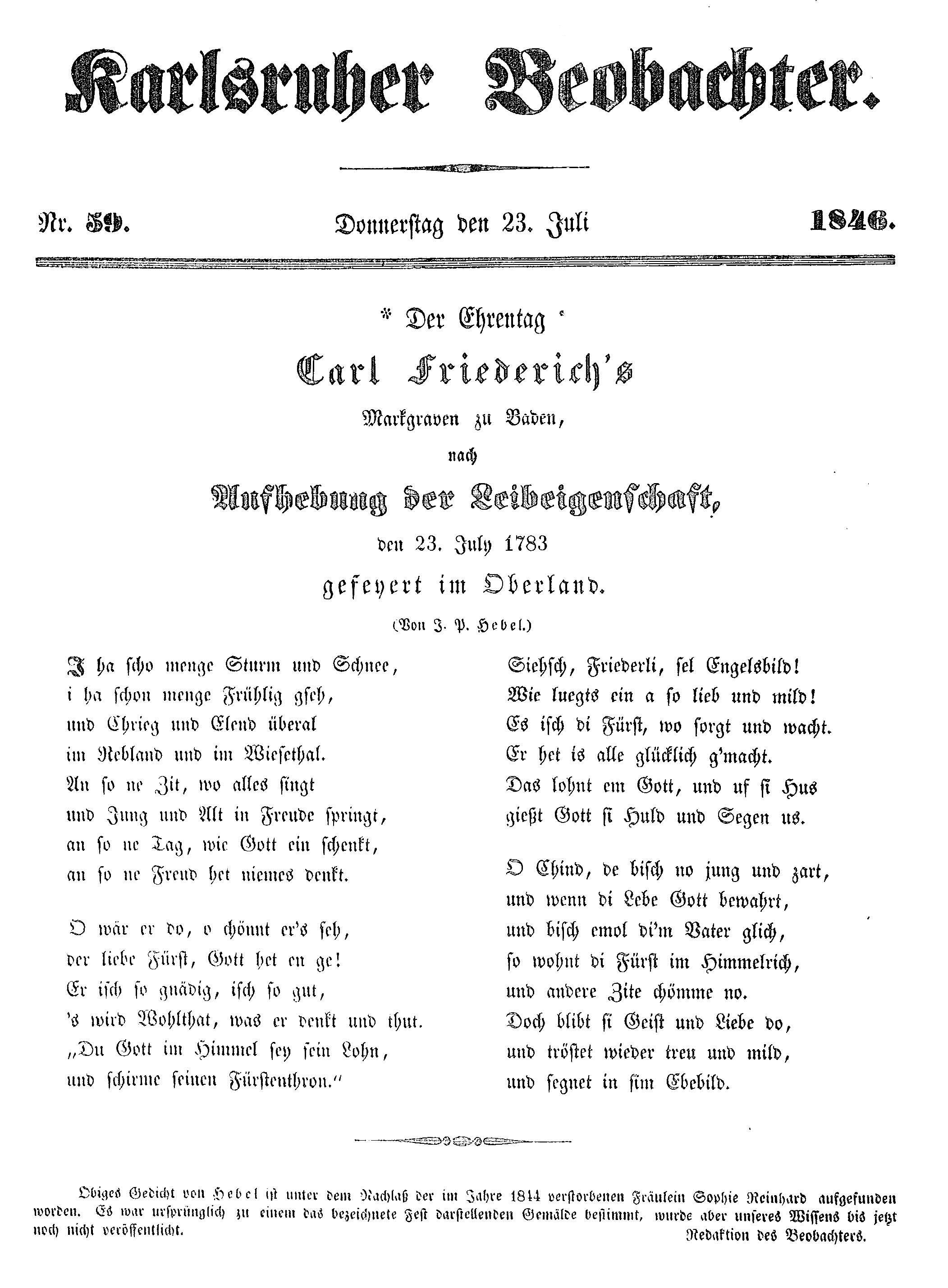
1
Laut
Redaktion des Karlsruher Beobachters Gedicht von Johann Peter Hebel.
Erstmals veröffentlicht im Karlsruher Beobachter, Nr. 59, 23. Juli 1846,
Beilage zum Karlsruher Tagblatt (Bildnachweis: E. Fecker, vergl. auch Wilhelm Zentner (Hrsg.), Johann
Peter Hebel, Gesamtausgabe, Band 3, Karlsruhe 1972, S. 220-221).
|